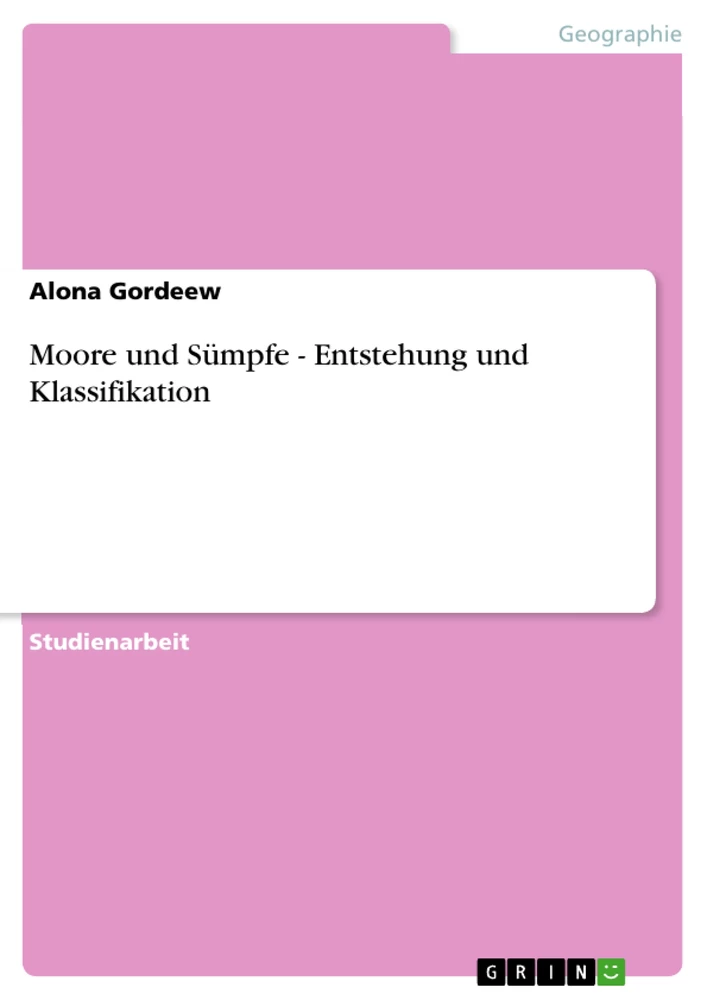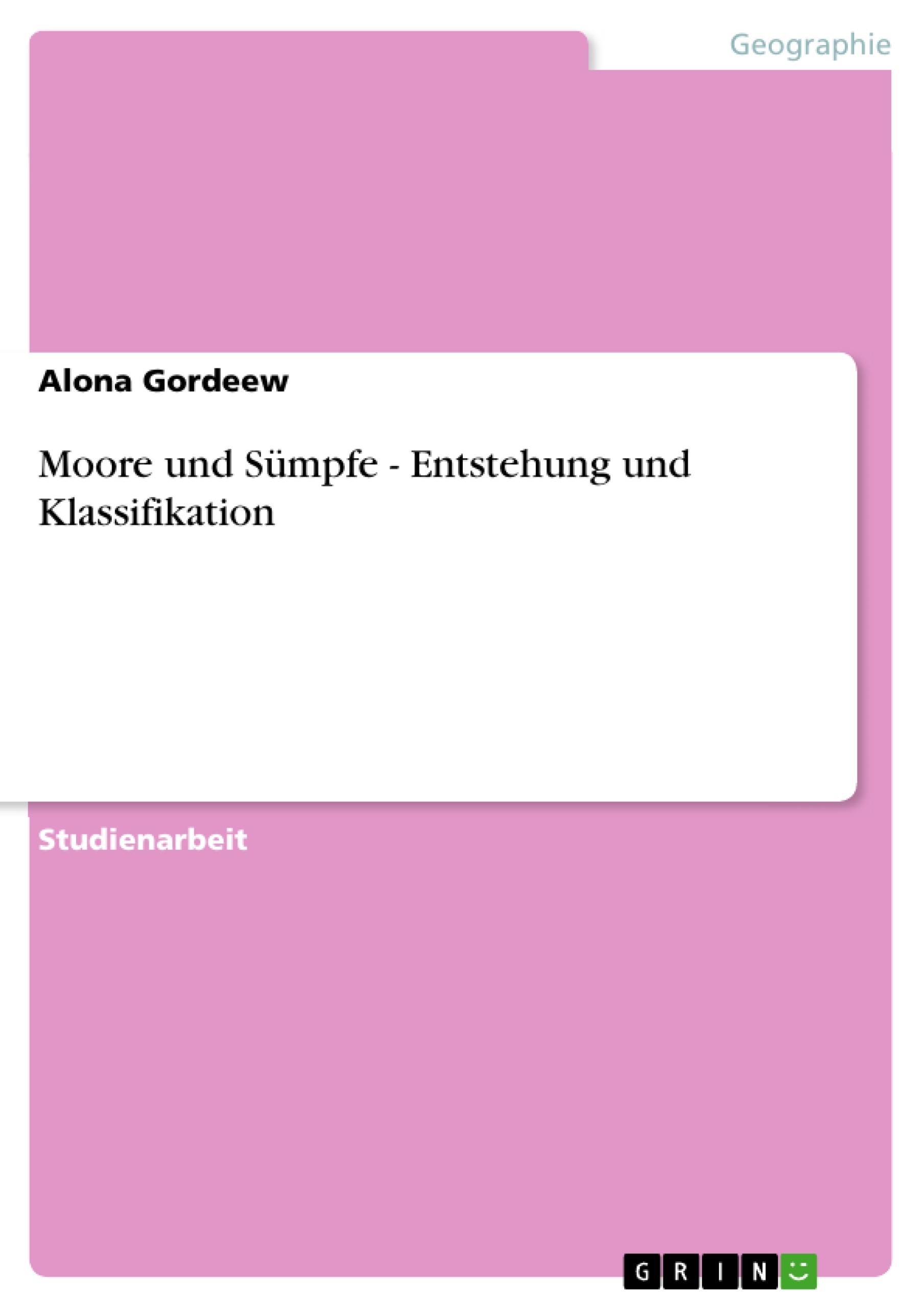Jeder kennt den Begriff Moor aus dem täglichen Sprachgebrauch. Doch schon bei der Unterscheidung zwischen Moor und Sumpf wird einem bewusst, dass man nur oberflächlich beantworten kann, was ein Moor ist und, dass sich die eigene Kenntnis auf ein Minimum beschränkt. Eher bestimmen vage Beschreibungen aus Märchen das Bild, das man von einem Moor hat. In ihnen wird das Moor als ein getränkter Untergrund geschildert, der Menschen verschlucken kann. Dem Moor wird mit seinem Nebel etwas Mystisches und Geheimnisvolles zugesprochen. In alten germanischen Sagen sollen dort „böse Geister“ gelebt haben. Dies sind jedoch nur Mythen, die entstanden sind, unter anderem, weil das Moor ein schwieriges Verkehrshindernis in vergangenen Tagen darstellte. Richtig jedoch ist, dass das Moor ein feuchter Lebensraum, ein „Zwischending“ zwischen nassem Boden und einem See ist und, dass es keinen festen Untergrund hat. Doch selbst wenn man ein Moor mit eigenen Augen gesehen hat, ist einem nicht ganz klar, was genau ein Moor ist.
Dabei ist das Moor ein verbreiteter Landschaftstyp in unseren Breiten, über den sich der Mensch schon in der Vergangenheit Gedanken gemacht hat. So fragte sich der Holländer H. Degner schon 1729, „ob der Torf etwa Faulholtz sey“ oder „ob er Erde sey“ (OVERBECK 1975, 24).
Um hinter das Geheimnis des Moores zu kommen, werde ich mich in dieser Hausarbeit damit beschäftigen, was ein Moor ist und wie es entsteht. Des weiteren führe ich aus, wie und nach welchen Kriterien man die einzelnen Moortypen klassifiziert. Daraufhin stelle ich ein Schema vor, das die beiden gängigen Klassifikationsformen vereint. Zuletzt geh ich auf die unverantwortliche Moornutzung in der Vergangenheit ein, erkläre, warum man Moore erhalten muss und stelle einige Projekte vor, die dies zum Ziel haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Moor
- 3. Verbreitung der Moore
- 4. Entstehung der Moore
- 5. Klassifikation von Mooren
- 5.1 Ökologische Moortypen
- 5.1.1 Nährstoffverhältnisse (Trophiestufe)
- 5.1.2 Säure-Basen-Verhältnis des Moorwassers
- 5.1.3 oligotroph-saure Moore = (Sauer-) Armmoore = Hochmoore
- 5.1.4 mesotroph-saure Moore = Sauer-Zwischenmoore
- 5.1.5 mesotroph-subneutrale Moore (unter Einschluss oligotroph-subneutraler Standortkomplexe) = Basen-Zwischenmoore
- 5.1.6 mesotroph-kalkhaltige Moore (unter Einschluss oligotroph-kalkhaltiger Standortkomplexe) = Kalk-Zwischenmoore
- 5.1.7 eutrophe Moore (in Vereinigung von subneutralen, kalkhaltigen und sauren Mooren) = Reichmoore Niedermoore
- 5.3 Hydrologische Moortypen
- 5.3.1 Regenmoore (auch Hochmoore genannt)
- 5.3.2 Versumpfungsmoore
- 5.3.3 Hangmoore
- 5.3.4 Quellmoore
- 5.3.5 Überflutungsmoore
- 5.3.6 Verlandungsmoore
- 5.3.7 Durchströmungsmoore
- 5.3.8 Kesselmoore
- 5.4 Schema aus beiden Klassifikationsformen
- 6. Moornutzung
- 7. Gründe für den Moorerhalt
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Ökosystem Moor. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Mooren zu vermitteln, von ihrer Definition und Entstehung bis hin zu ihrer Klassifizierung und der Bedeutung ihres Erhalts. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Moortypen und deren Entstehungsprozesse.
- Definition und Charakteristika von Mooren
- Verbreitung und Entstehung von Mooren
- Klassifizierung von Mooren nach ökologischen und hydrologischen Kriterien
- Die Bedeutung des Moorschutzes
- Historische und aktuelle Moornutzung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die oft oberflächliche Kenntnis über Moore, im Gegensatz zu den Mythen und vagen Vorstellungen, die oft mit ihnen verbunden sind. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der von der Definition und Entstehung über die Klassifizierung bis hin zur Moornutzung und dem Moorschutz reicht.
2. Definition Moor: Dieses Kapitel definiert Moore als nasse Lebensräume über undurchlässigem Untergrund mit positivem Wasserhaushalt und Sauerstoffmangel, der die vollständige Zersetzung organischer Stoffe verhindert und zur Torfbildung führt. Der Unterschied zu Sümpfen wird herausgestellt, und die besondere Rolle von Mooren in den Stoff- und Wasserkreisläufen wird betont, wobei insbesondere ihre Funktion als gewaltige Kohlenstoff- und Wasserspeicher hervorgehoben wird.
3. Verbreitung der Moore: Die Verbreitung von Mooren wird geografisch eingegrenzt, wobei die Bedeutung von ausreichend Niederschlag, geringer Verdunstung und undurchlässigen Böden betont wird. Die weltweite Verbreitung, insbesondere in der borealen Zone und den gemäßigten Klimazonen, wird dargestellt, mit besonderem Fokus auf Mitteleuropa und Deutschland. Karten verdeutlichen die regionalen Unterschiede der Moorverteilung.
4. Entstehung der Moore: Dieses Kapitel beschreibt die zwei Hauptentstehungsprozesse von Mooren: die Verlandung von Gewässern und die Versumpfung von terrestrischen Lebensräumen. Es erläutert den Prozess der Torfbildung durch unvollständigen Abbau organischer Substanzen aufgrund von Sauerstoffmangel. Die Bedeutung der Wasserversorgung, insbesondere die Rolle von nährstoffarmem Regenwasser und Torfmoosen bei der Hochmoorbildung, wird hervorgehoben.
5. Klassifikation von Mooren: Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Klassifizierungssysteme für Moore, ausgehend von der traditionellen Einteilung in Hoch-, Nieder- und Zwischenmoore. Es erläutert die Kriterien, die für eine differenziertere Einteilung verwendet werden, wie Nährstoffgehalt und pH-Wert des Wassers sowie die Art der Wasserversorgung. Ökologische und hydrologische Moortypen werden unterschieden und genauer beschrieben.
Schlüsselwörter
Moor, Torf, Torfbildung, Hochmoor, Niedermoor, Zwischenmoor, Ökologie, Hydrologie, Moorklassifikation, Moornutzung, Moorschutz, Wasserhaushalt, Nährstoffgehalt, pH-Wert, Verbreitung, Entstehung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Ökosystem Moor"
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit zum Thema "Ökosystem Moor"?
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Ökosystem Moor. Sie beginnt mit einer Definition und Beschreibung der Entstehung von Mooren, geht dann auf deren Verbreitung und verschiedene Klassifizierungssysteme ein (ökologisch und hydrologisch) und schließt mit der Moornutzung und der Bedeutung des Moorschutzes ab. Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, Schlüsselwörter und eine Beschreibung der Zielsetzung und der behandelten Themenschwerpunkte.
Wie werden Moore definiert und welche Rolle spielen sie im Stoff- und Wasserkreislauf?
Moore werden definiert als nasse Lebensräume über undurchlässigem Untergrund mit positivem Wasserhaushalt und Sauerstoffmangel. Dieser Sauerstoffmangel verhindert die vollständige Zersetzung organischer Stoffe und führt zur Torfbildung. Moore spielen eine wichtige Rolle im Stoff- und Wasserkreislauf, insbesondere als gewaltige Kohlenstoff- und Wasserspeicher.
Wo sind Moore verbreitet und welche Faktoren beeinflussen ihre Entstehung?
Moore sind weltweit verbreitet, insbesondere in der borealen Zone und den gemäßigten Klimazonen. Die Verbreitung wird durch Faktoren wie ausreichend Niederschlag, geringe Verdunstung und undurchlässige Böden beeinflusst. Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Verbreitung in Mitteleuropa und Deutschland.
Wie entstehen Moore?
Moore entstehen hauptsächlich durch zwei Prozesse: die Verlandung von Gewässern und die Versumpfung von terrestrischen Lebensräumen. Die Torfbildung resultiert aus dem unvollständigen Abbau organischer Substanzen aufgrund von Sauerstoffmangel. Die Wasserversorgung spielt eine entscheidende Rolle, insbesondere nährstoffarmes Regenwasser und Torfmoose bei der Hochmoorbildung.
Wie werden Moore klassifiziert?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Klassifizierungssysteme für Moore, beginnend mit der traditionellen Einteilung in Hoch-, Nieder- und Zwischenmoore. Sie erläutert die Kriterien für eine differenziertere Einteilung, wie Nährstoffgehalt und pH-Wert des Wassers sowie die Art der Wasserversorgung. Ökologische und hydrologische Moortypen werden unterschieden und detailliert beschrieben. Die Klassifizierung umfasst Aspekte wie Trophiestufe (Nährstoffverhältnisse), Säure-Basen-Verhältnis des Moorwassers und hydrologische Merkmale (z.B. Regenmoore, Versumpfungsmoore).
Welche Bedeutung hat der Moorschutz?
Die Hausarbeit betont die Bedeutung des Moorschutzes, obwohl die genauen Gründe im Detail nicht explizit in den FAQs aufgeführt sind. Dies ist ein wichtiges Thema, welches im Haupttext der Hausarbeit behandelt wird.
Welche historischen und aktuellen Moornutzungen werden behandelt?
Die Hausarbeit beleuchtet die historische und aktuelle Moornutzung, allerdings werden die spezifischen Nutzungen in diesen FAQs nicht im Detail aufgelistet. Diese Informationen finden sich im Haupttext der Hausarbeit.
- Quote paper
- Alona Gordeew (Author), 2006, Moore und Sümpfe - Entstehung und Klassifikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166506