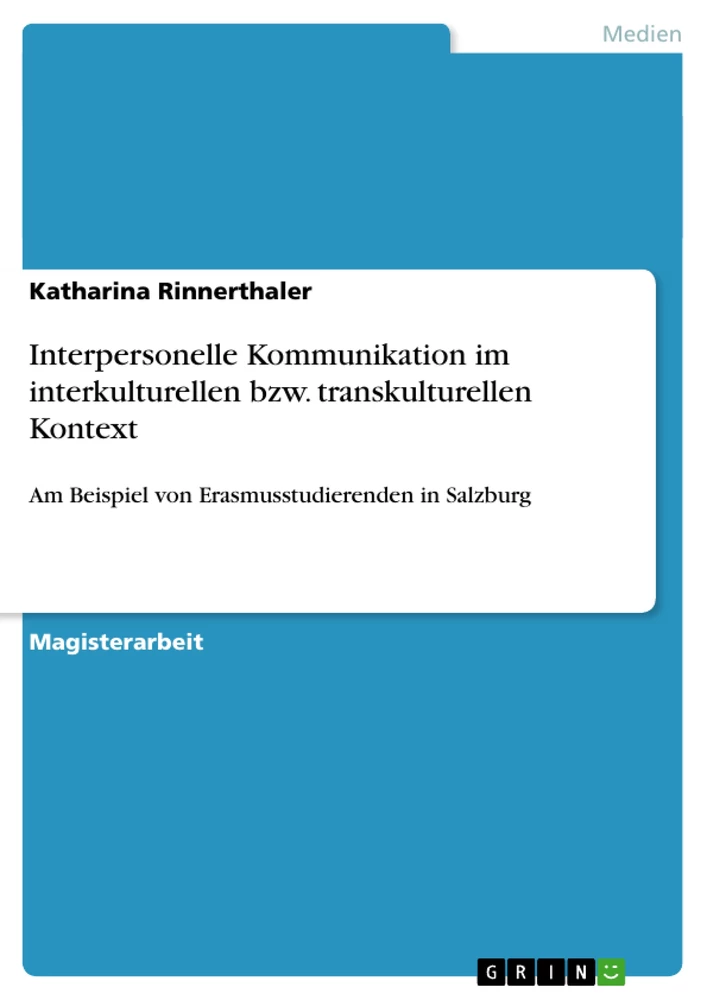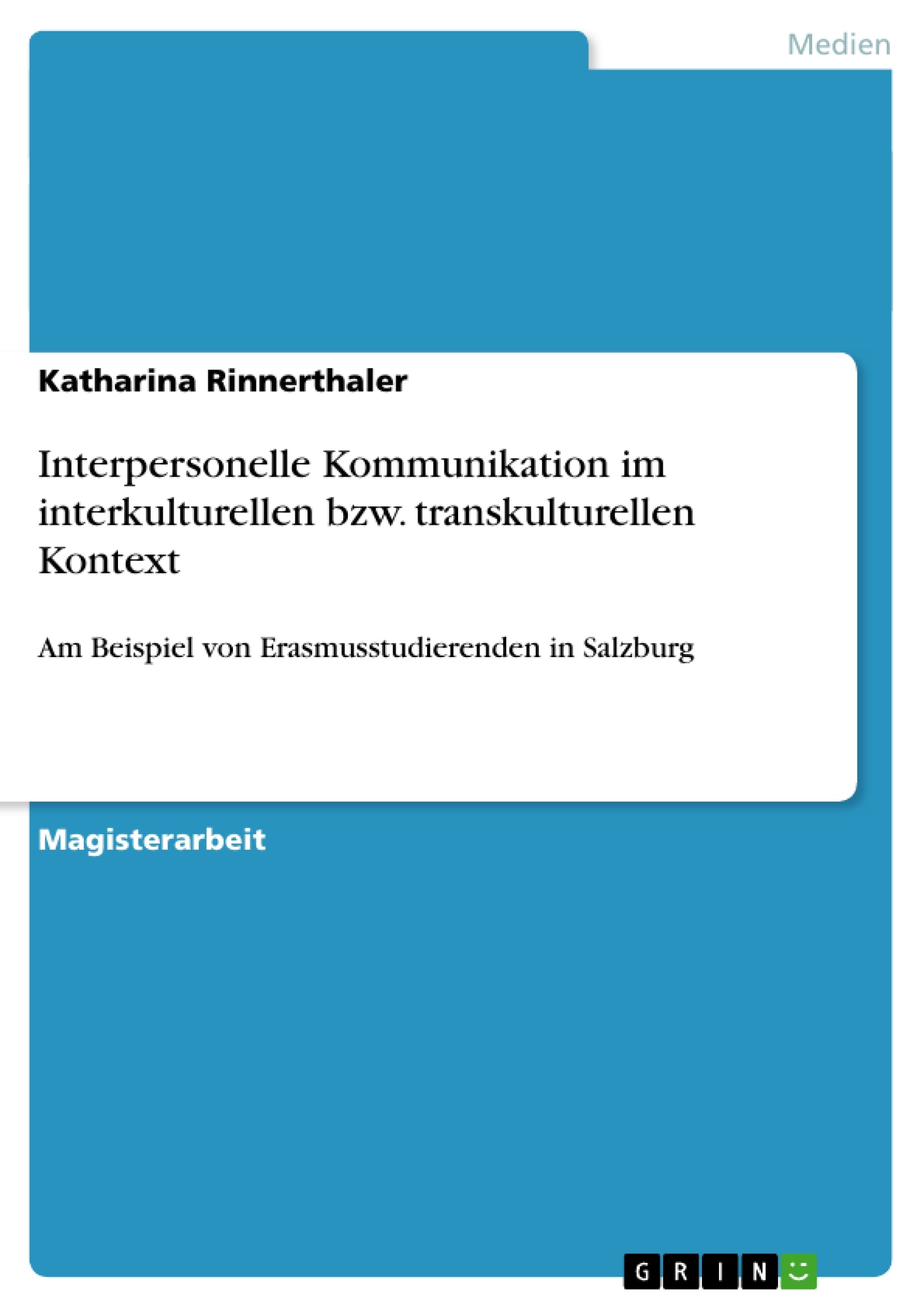Ausgangspunkt der Betrachtungsweise ist das Aufeinandertreffen verschiedener soziokultureller Systeme, bzw. verschiedener Kulturen. (Vgl. Luger 1994: 32)
Wenn sich Studierende dazu entschließen einen Teil ihrer Studienzeit im Ausland zu verbringen, ist das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen, bzw. soziokultureller Systeme vorprogrammiert. Viele tausende Studierende nützen die Chance im Rahmen des vielleicht bekanntesten und auch bei Studierenden sehr beliebten europäischen Bildungsprogramms ERASMUS ein oder zwei Semester im europäischen Ausland zu leben und zu studieren. Jene Studierenden treffen auf verschiedenste soziokulturelle Systeme, bzw. Kulturen und erfahren, was es bedeutet in einer fremden Lebenswelt einige Zeit zu leben.
Das Bildungsprogramm ERASMUS ist ein Teil des Aktionsprogrammes „Lebenslanges Lernen“, mit dem sowohl die Mobilität als auch die Bildung der Studierenden von der Europäischen Union gefördert wird. Auch an der Universität Salzburg konnten im Studienjahr 2008/2009 etliche Studierende die Chance ergreifen einen Teil ihres Studiums im Ausland zu absolvieren. Da es sich ursprünglich um einen Studienaustausch handelt, wurde auch zahlreichen europäischen StudentInnen ermöglicht einen Teil ihres Studiums in Salzburg zu absolvieren.
Wir leben in einer Zeit der Globalisierung, wo interkulturelle bzw. transkulturelle Kommunikation immer mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Die Ausbreitung und Entwicklung internationaler Unternehmen bringt eine zunehmende Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen mit sich. Das bedeutet, dass Menschen nun mit unterschiedlichen Kommunikationsformen direkt konfrontiert werden. Somit tritt das Thema der interkulturellen bzw. transkulturellen Kommunikation in den Vordergrund, um effektiv mit Personen aus verschiedenen Kulturkreisen kommunizieren zu können. Um Kommunikation zwischen Personen verschiedener Kulturen herzustellen, müssen erstmals verschiedenste Barrieren bewusst gemacht werden, wie beispielsweise Stereotypen, nonverbale Missverständnisse oder Übersetzungsschwierigkeiten.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich besonders auf jene Probleme und Schwierigkeiten konzentrieren, die bei der Kommunikation von Personen, die unterschiedlichen Kulturen angehören, auftreten. Effektive Kommunikation kann nur dann erfolgen, wenn sich die Kommunikationspartner dessen bewusst sind und jene Missverständnisse und Verständnisprobleme soweit wie möglich reduziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Heranführung an das Thema
- 1.2. Relevanz des Themas
- 1.3. Vorüberlegungen
- 1.4. Gliederung der Arbeit
- 1.5. Leitende Fragen und Forschungsziel
- 2. Bildungsmigration und die Mobilitätsprogramme der EU
- 2.1. Personenaustausch
- 2.1.1. Auslandsreisen und Bildungsprogramme als interkultureller Austausch
- 2.1.2. Defizite des Austausches im Allgemeinen
- 2.2. Rahmendaten der europäischen Bildungspolitik
- 2.3. Überblick der wichtigsten europäischen Bildungsprogramme
- 2.3.1. Comenius
- 2.3.2. Erasmus
- 2.3.3. Leonardo da Vinci
- 2.3.4. Grundvig
- 2.4. Das Programm Erasmus
- 2.5. Rahmendaten der Österreichischen Hochschulen und deren Studierenden im Bezug auf die Teilnahme am Erasmus-Programm
- 2.6. Die Universität Salzburg und Erasmus
- 2.1. Personenaustausch
- 3. Begriffsklärungen und Einbettung von Kultur in das Feld der interkulturellen bzw. transkulturellen Kommunikation
- 3.1. Kultur
- 3.1.1. Kulturmodelle
- 3.1.2. Kulturdefinition für das Feld der Kommunikationswissenschaft
- 3.1.3. Warum Kulturen sich unterscheiden
- 3.1.4. Kulturdistanzen und Verstehen fremder Kulturen
- 3.2. Kommunikation
- 3.2.1. Kommunikationsbegriff
- 3.2.2. Kommunikation als Element von Kultur
- 3.3. Formen der Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen
- 3.3.1. Interkulturelle Kommunikation
- 3.3.2. Transkulturelle Kommunikation
- 3.3.3. Internationale Kommunikation
- 3.1. Kultur
- 4. Verbindungen und Schnittstellen interpersoneller und interkultureller/transkultureller Kommunikation
- 4.1. Dimensionen kultureller Variabilität von Hofstede
- 4.1.1. Individualismus versus Kollektivismus
- 4.1.2. Maskulinität versus Femininität
- 4.1.3. Machtdistanz
- 4.1.4. Unsicherheitsvermeidung
- 4.1.5. Langfristige Orientierung versus Kurzfristige Orientierung
- 4.1.6. Die Bedeutung von Hofstedes Dimensionen kultureller Variabilität für den Vergleich ausgewählter Länder Europas
- 4.2. Kontextgebundene versus kontextungebundene Kultur
- 4.3. Organisationsmodell für das Studium von Kommunikation mit Fremden
- 4.3.1. Kodieren/ Dekodieren von Nachrichten
- 4.3.2. Kulturelle, soziokulturelle, psychokulturelle und Umwelteinflüsse
- 4.3.3. Kulturelle Strukturmerkmale
- 4.3.4. Der Besucher in einer fremden Kultur
- 4.4. Die offene Dimension
- 4.4.1. Sprache, Kultur und Kommunikation
- 4.4.2. Dialekte bzw. Österreichisches Deutsch
- 4.4.3. Sprache und Übersetzung in einem interkulturellen/transkulturellen Kontext
- 4.4.4. Kommunikationsbarrieren und Missverständnisse
- 4.5. Die versteckte Dimension von Kultur
- 4.5.1. Proxemik
- 4.5.2. Kinesik
- 4.5.3. Chronemik
- 4.5.4. Haptik
- 4.5.5. Stille
- 4.5.6. Parasprache
- 4.5.7. Kleider- und Körpererscheinung
- 4.5.8. Olfaktik
- 4.1. Dimensionen kultureller Variabilität von Hofstede
- 5. Methode
- 5.1. Definition und Erhebungsmethode
- 5.2. Das Leitfadeninterview
- 5.3. Stichprobe und Durchführung der Leitfadeninterviews
- 5.4. Themenbereiche des Leitfadens
- 5.4.1. Allgemeine Angaben und Motive bzw. Ziele für den Auslandsaufenthalt in Salzburg
- 5.4.2. Ankunft, Wohnsituation in Salzburg und Sprachkenntnisse
- 5.4.3. Soziale Kontakte und interpersonelle Beziehungen
- 5.4.4. Sprache, Kultur und Kommunikation in einem interkulturellen bzw. transkulturellen Kontext
- 5.4.5. Österreich-Bild, Stereotypen und nichtverbale Kommunikation der Österreicher
- 5.5. Datenaufbereitung der Leitfadeninterviews
- 6. Auswertung und Analyse der Ergebnisse
- 6.1. Motive und Ziele für den Auslandsaufenthalt in Salzburg
- 6.2. Wohnsituation in Salzburg und Sprachkenntnisse
- 6.2.1. Wohnsituation
- 6.2.2. Sprache in der interkulturellen bzw. transkulturellen Kommunikation
- 6.3. Soziale Kontakte und interpersonelle Beziehungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die interpersonelle Kommunikation von Erasmusstudierenden in Salzburg im Kontext der interkulturellen und transkulturellen Kommunikation. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Erfahrungen und Herausforderungen der Studierenden in Bezug auf Sprache, Kultur und Kommunikation in einem neuen Umfeld zu analysieren.
- Interkulturelle und transkulturelle Kommunikation
- Erfahrungen von Erasmusstudierenden in Salzburg
- Sprache und Kommunikation im interkulturellen Kontext
- Kulturelle Unterschiede und ihre Auswirkungen auf die Kommunikation
- Interpersonelle Beziehungen und soziale Kontakte im interkulturellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der interpersonellen Kommunikation im interkulturellen bzw. transkulturellen Kontext ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Kapitel zwei behandelt die Bildungsmigration und die Mobilitätsprogramme der EU, insbesondere das Erasmus-Programm. Kapitel drei widmet sich der Begriffsklärung von Kultur und Kommunikation, sowie der Einbettung von Kultur in das Feld der interkulturellen und transkulturellen Kommunikation. Kapitel vier untersucht die Verbindungen und Schnittstellen zwischen interpersoneller und interkultureller/transkultureller Kommunikation, wobei die Dimensionen kultureller Variabilität von Hofstede im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind interpersonelle Kommunikation, interkulturelle und transkulturelle Kommunikation, Bildungsmigration, Erasmus-Programm, Sprache, Kultur, soziale Kontakte, interkulturelle Beziehungen, Dimensionen kultureller Variabilität, Hofstede.
- Quote paper
- Katharina Rinnerthaler (Author), 2010, Interpersonelle Kommunikation im interkulturellen bzw. transkulturellen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166222