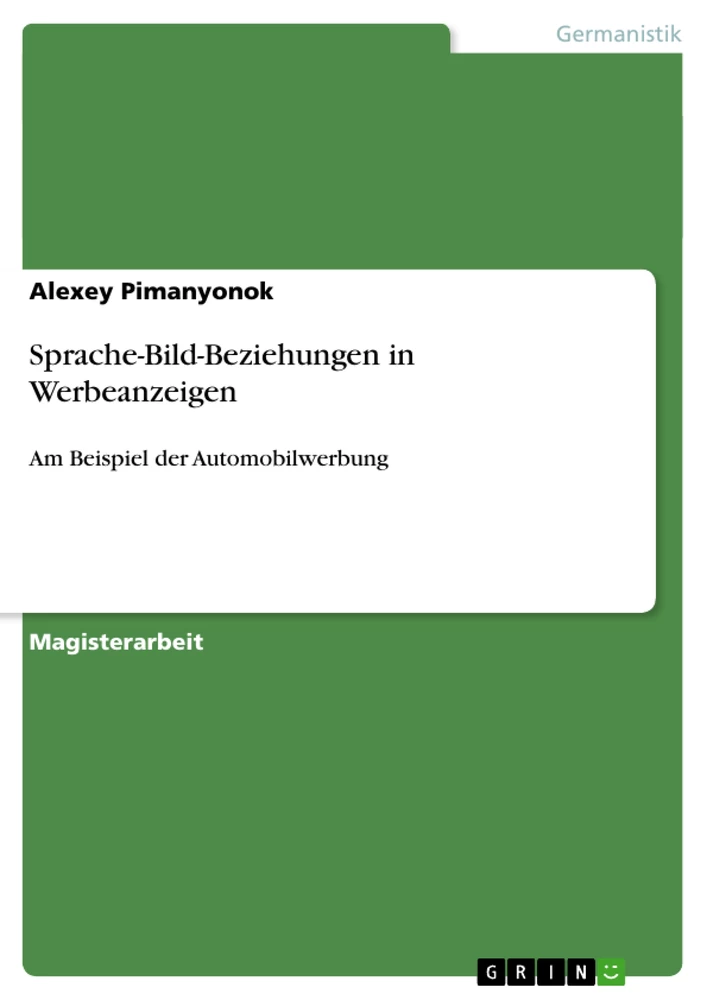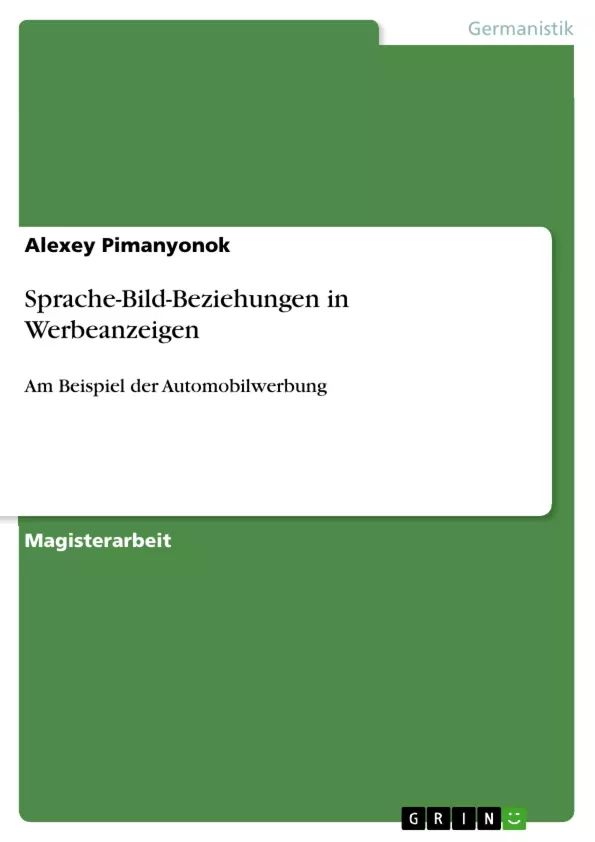Multimodale Verknüpfung verbaler, visueller und akustischer Kanäle ist das charakteristische Merkmal moderner Kommunikation. Insbesondere Sprache und Bild werden auf vielfältige Weise miteinander verkoppelt. In Anbetracht der seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der rasanten Technisierung der Kommunikation immens gestiegenen Gestaltungsmöglichkeiten und Qualität von Bildern sowie der gesunkenen Kosten für Bildherstellung und -verarbeitung greift unsere Kommunikationsgesellschaft verstärkt auf bildliche Darstellungen jeder Art zurück. Die alten Grenzen zwischen Sprache und Bild werden aufgelöst und „der prototypische Text ist eher ein bimodaler als ein rein verbaler“ (Stöckl 2004a: 246). Rein verbale Texte ohne visuelle Gestaltung und ohne Bilder werden selten oder bleiben aus traditionellen bzw. technischen Gründen auf bestimmte Textsorten und Kommunikationsformen beschränkt. Zahllose geschriebene Texte jedoch erscheinen in einer bildlichen Umgebung, die für ihr Verständnis notwendig ist.
Der Linguistik kommt nun die Aufgabe zu, das Bild in die sprachwissenschaftliche Analyse einzubeziehen und die Möglichkeiten der Verbindung von Sprache und Bild ausführlich zu beschreiben. Wenn nur die sprachliche Seite untersucht wird, besteht die Gefahr, dass Ergebnisse über die Sprache verzerrt werden, denn Sprache und Bild ergänzen sich in bimodalen Texten gegenseitig und sind aufeinander abgestimmt.
Doch gerade in der Textlinguistik wird das Verhältnis von Sprache und Bild oft ignoriert. Wenn dieses analysiert werden, dann entweder ganz knapp und oberflächlich oder mit herkömmlichen rein textlinguistischen Instrumentarien, die der besonderen Eigenart von Bildern nicht gerecht werden können (Schmitz 2005: 200ff).
Die Möglichkeiten, Sprache und Bild in Texten semantisch, syntaktisch und pragmatisch zu verknüpfen, sind nicht zuletzt aufgrund der inhärenten Mehrdeutigkeit der beiden Zeichensysteme äußerst vielfältig. Sprache und Bild sind häufig in ein komplexes Bedeutungsgeflecht eingebunden, so dass mannigfaltige intermodale Sinnbezüge entstehen, die in ihrer Gesamtheit einen textstrukturierenden und verständnisfördernden Effekt haben können. Die Werbung versucht, alle Möglichkeiten der Verbindung der beiden Zeichensysteme bei der Gestaltung der Werbeanzeigen auszuschöpfen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. WERBEANZEIGE
- 1.1 DEFINITION UND EIGENSCHAFTEN
- 1.2 KLASSISCHE UND REDAKTIONELLE ANZEIGEN
- 1.3 DIE KOMMUNIKATIVEN ELEMENTE DER ANZEIGE
- 1.3.1 Die Schlagzeile
- 1.3.2 Der Fließtext
- 1.3.3 Der Slogan
- 1.3.4 Besondere Formen von Textelementen
- 1.3.5 Bildelemente
- 2. DAS VERHÄLTNIS VON SPRACHE UND BILD
- 2.1 ZUM BEGRIFF DER SPRACHE-BILD-BEZIEHUNG
- 2.2 SPRACHE UND BILD ALS KOMMUNIKATIVER LEISTUNGSKOMPLEX
- 2.2.1 Ansatzpunkte zur Beschreibung von Sprache-Bild-Beziehungen
- 2.2.2 Gegenüberstellung von Sprache und Bild
- 2.2.3 Bilder als Texte
- 2.3 TYPOLOGIE VON SPRACHE-BILD-BEZIEHUNGEN
- 2.3.1 Syntaktisch-räumliche Aspekte
- 2.3.2 Informationsbezogene und global-semantische Aspekte
- 2.3.3 Aspekte einer visuell/verbalen Rhetorik (Visualisierungsmethoden)
- 2.4 DER „PICTURE RELATION TYPE“ – STÖCKLS ANALYSEMODELL FÜR SPRACHE-BILD-BEZIEHUNGEN IN WERBEANZEIGEN
- 3. ANALYSE DER SPRACHE-BILD-BEZIEHUNGEN IN AUTOWERBE-ANZEIGEN
- 3.1 MATERIAL UND METHODE
- 3.2 DIE POSITION DES BILDES IN BEZUG AUF DEN VERBALEN TEXT UND DIE SEMIOTISCHE KATEGORIE DES „VISUAL EMPHASIS“
- 3.3 DIE ART DER EINBETTUNG DES BILDES IN DAS GESAMTKOMMUNIKAT („ANCHORAGE“ UND „RELAY“)
- 3.4 SEMIOTISCHE UND TECHNISCHE BESCHAFFENHEIT DES BILDES
- 3.5 SEMIOTISCHE BESCHAFFENHEIT DES VERBALEN TEXTES
- 3.6 DIE GLOBALE SEMANTIK DES BILDES
- 3.7 DIE FUNKTION DES BILDES IN BEZUG AUF DEN VERBALEN TEXT (VISUALISIERUNGSMETHODEN)
- 3.8 DIE WIRKUNGSDIMENSION DER SPRACHE-BILD-BEZIEHUNG
- 3.9 DER VERBALISIERBARKEITSWERT DES BILDES
- 3.10 SCHLAGZEILE-BILD-BEZIEHUNGEN
- 3.11 ZUSAMMENFASSUNG DER UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
- SCHLUSSWORT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit setzt sich zum Ziel, die Sprache-Bild-Beziehungen in Werbeanzeigen, speziell in der Automobilwerbung, zu analysieren und zu beschreiben. Dabei werden die spezifischen Eigenschaften von Sprache und Bild als kommunikative Systeme und ihre vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten im Kontext von Werbekommunikaten untersucht.
- Das Verhältnis von Sprache und Bild als komplementäre und sich gegenseitig beeinflussende Systeme
- Die Rolle von Bildern in der Aufmerksamkeitserregung und in der Vermittlung von Emotionen und Assoziationen
- Typologisierung von Sprache-Bild-Beziehungen anhand von syntaktisch-räumlichen, informationsbezogenen und rhetorischen Aspekten
- Anwendung eines semiotischen Analysemodells zur Beschreibung der Sprache-Bild-Beziehungen in Werbeanzeigen
- Untersuchung der typischen Sprache-Bild-Konstellationen in Autowerbeanzeigen und der Unterschiede im Verhältnis von Sprache und Bild in verschiedenen Preisklassen von Autos
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Sprache-Bild-Beziehungen in der modernen Kommunikation dar, beleuchtet die Besonderheiten von Sprache und Bild als Zeichensysteme und skizziert die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
- 1. Werbeanzeige: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Werbeanzeige als Werbemittel, ihre Definition, Eigenschaften, Arten (klassische und redaktionelle Anzeigen) und die wichtigsten kommunikativen Elemente wie Schlagzeile, Fließtext, Slogan und Bildelemente.
- 2. Das Verhältnis von Sprache und Bild: Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik der Definition von Sprache-Bild-Beziehungen, stellt verschiedene Ansatzpunkte zur Beschreibung dieser Beziehungen dar, untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Sprache und Bild und geht auf die Rolle von Bildern als eigenständige Texte ein. Außerdem werden verschiedene typologische Ansätze zur Klassifizierung von Sprache-Bild-Beziehungen diskutiert.
- 3. Analyse der Sprache-Bild-Beziehungen in Autowerbeanzeigen: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Analyse von 50 Autowerbeanzeigen aus der Zeitschrift „Auto, Motor und Sport“. Dabei werden verschiedene Parameter des „picture relation type“ von Stöckl angewandt, um die syntaktische Verknüpfungsart, die semiotische Beschaffenheit des Bildes und die Funktion des Bildes in Bezug auf den verbalen Text zu untersuchen. Außerdem wird die Beziehung zwischen Schlagzeile und Werbebild analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Sprache-Bild-Beziehungen, multimodale Kommunikation, Werbekommunikation, Anzeigenwerbung, Automobilwerbung, Semiotik, Visualisierungsmethoden, „picture relation type“, anchorage, relay, „visual emphasis“, Typografie, globale Semantik, Verbalisierbarkeitswert, Schlagzeile-Bild-Beziehungen.
- Citation du texte
- Alexey Pimanyonok (Auteur), 2008, Sprache-Bild-Beziehungen in Werbeanzeigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166208