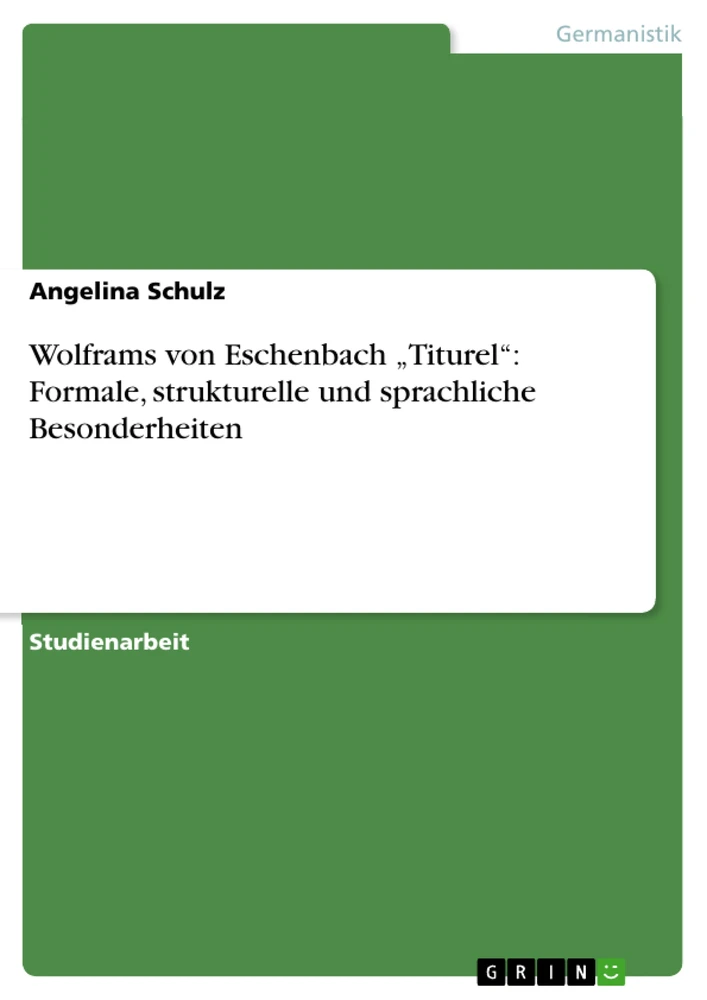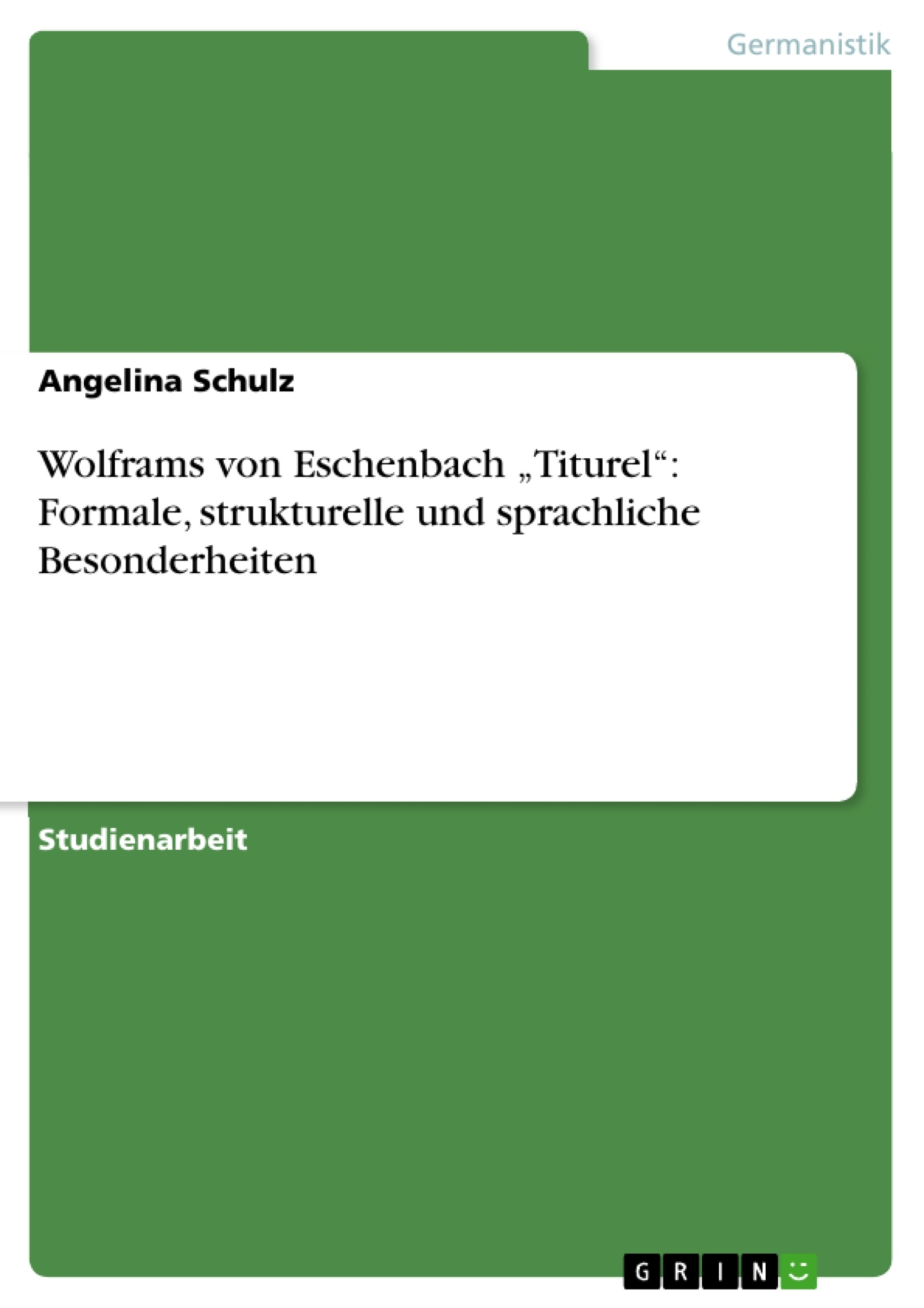Wolframs von Eschenbach „Titurel“ ist ein einzigartiges Werk, das bis heute seine Faszination auf die Leser nicht eingebüßt hat. Wolframs unvollendete Dichtung ist ein „Unicum“ : Der „Titurel“ besteht aus zwei inhaltlich nicht zusammenhängenden Fragmenten, einem längeren (125 Strophen) und einem kürzeren (39 Strophen) Fragment. Es ist das erste höfische Epos in strophischer Form. Strophisches Erzählen war zunächst ein Kennzeichen der Heldenepik. Daher nahm Wolfram auch seine Anregungen und verfasste seinen „Titurel“, in Anlehnung an das Nibelungenlied, auch in Strophen.
Die Form des „Titurel“, die Erzählerrolle, die Sprache und Bildlichkeit, alles erscheint neuartig und rätselhaft. Genau diese ungewöhnliche und zugleich faszinierende Poetik soll im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit stehen. Ich werde versuchen, der stilistischen Eigenart von Wolframs schwierigem Alterswerk näher zu kommen.
Dabei soll zunächst auf den Vorgeschichtencharakter des „Titurel“ eingegangen werden und das Verhältnis zum „Parzival“ geklärt werden. Danach wird der Fragmentcharakter des Werkes beleuchtet und die Überlieferung des „Titurel“ vorgestellt. Der „Titurel“ ist in drei Handschriften überliefert, die jedoch sehr stark voneinander abweichen. Hier soll auch der Frage nachgegangen werden, warum Wolfram seinen „Titurel“ nicht zu Ende gedichtet hat. Im Hauptteil dieser Arbeit soll die besondere sprachliche Form des „Titurel“ untersucht werden. Welches Strophenschema liegt dem „Titurel“ zu Grunde? Wurde der „Titurel“ singend nach einer ganz bestimmten Melodie vorgetragen? In welche Gattung lässt sich das Werk einordnen? Diese und andere Fragen sollen in dem Kapitel zur sprachlichen Form beantwortet werden.
Um ein Verständnis für Interpretationen älterer Werke zu entwickeln, ist es zweckmäßig, die Situation des Dichters in seiner Zeit zu betrachten. Daher soll kurz auf die Autorschaft des Mittelalters eingegangen werden, um dann das Verhältnis von Erzähler und Autor des „Titurel“ abzuleiten und eine mögliche Verschmelzung aufzudecken. Hier werde ich auch die unterschiedlichen Erzählerrollen des „Titurel“ gegenüber stellen. Zum Abschluss dieser Arbeit soll noch die außergewöhnliche Sprache des „Titurel“ in ihrer Besonderheit erfasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
- 2 Das Verhältnis zum „Parzival“ - Vorgeschichtencharakter
- 3 Zum Fragmentcharakter
- 3.1 Überlieferung
- 3.2 Problem der Abgeschlossenheit
- 4 Sprachliche Form - Abkehr vom höfischen Roman
- 4.1 Sprachliche Form und sprachliche Auswirkung des Strophenschemas
- 4.2 Melodie
- 4.3 Versuch einer Gattungsbestimmung
- 5 Verhältnis von Autor und Erzähler
- 5.1 Autorschaft im Mittelalter
- 5.2 Erzähler und Autor
- 5.3 Erzählerrollen
- 5.3.1 Zur Polyfunktionalität der Erzählerrede im Parzival
- 5.3.2 Gegensätzliche Ausformungen der Erzählerrolle
- 6 Der Erzählstil des „Titurel“
- 7 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die stilistische Eigenart von Wolframs von Eschenbach „Titurel“, einem unvollendeten und fragmentarischen Werk. Ziel ist es, der ungewöhnlichen Poetik des „Titurel“ näher zu kommen und Aspekte wie den Vorgeschichtencharakter im Verhältnis zum „Parzival“, den Fragmentcharakter mit seinen Überlieferungsproblemen, die sprachliche Form und die Erzählerrolle zu analysieren.
- Das Verhältnis von „Titurel“ zu Wolframs „Parzival“ als Vorgeschichte.
- Der Fragmentcharakter des „Titurel“ und die daraus resultierenden interpretatorischen Herausforderungen.
- Die sprachliche Gestaltung des „Titurel“ und deren Abweichung vom traditionellen höfischen Roman.
- Die Rolle des Erzählers und die daraus resultierende Perspektive auf die Geschichte.
- Die Gattung des „Titurel“ und seine Einordnung in die mittelalterliche Literatur.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit: Die Einleitung beschreibt Wolframs „Titurel“ als ein einzigartiges, unvollendetes und fragmentarisches Werk, das durch seine experimentelle Behandlung von Sprache, Stoff und Form sowie durch die Reflexivität und Gebrochenheit des Erzählvorgangs gekennzeichnet ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die stilistische Eigenart des „Titurel“, untersucht das Verhältnis zum „Parzival“, den Fragmentcharakter, die sprachliche Form und die Erzählerrolle, um der ungewöhnlichen Poetik näherzukommen.
2 Das Verhältnis zum „Parzival“ - Vorgeschichtencharakter: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung zwischen „Titurel“ und „Parzival“. „Titurel“ liefert die Vorgeschichte zu Szenen im „Parzival“, insbesondere die Geschichte von Sigune und Schionatulander. Der Autor setzt dabei die Kenntnis des „Parzival“ beim Leser voraus und erzählt die Geschichte von Sigunes und Schionatulanders Liebe, die mit Schionatulanders Tod endet. Die Positionierung von „Titurel“ als Vorgeschichte zu „Parzival“ ist untypisch und stellt ein besonderes Merkmal des Werkes dar.
3 Zum Fragmentcharakter: Dieses Kapitel befasst sich mit den Überlieferungsfragmenten des „Titurel“. Es werden die drei Handschriften (G, H, M) beschrieben, die das Werk überliefern, wobei die Unterschiede und Unvollständigkeiten der Überlieferung hervorgehoben werden. Die Diskussion über die Gründe, warum Wolfram sein Werk nicht vollendet hat, ist ein zentraler Punkt dieses Kapitels. Die Fragmentierung stellt eine wesentliche Herausforderung für die Interpretation des Textes dar.
4 Sprachliche Form - Abkehr vom höfischen Roman: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der sprachlichen Gestaltung des „Titurel“ und ihrer Abweichung von der traditionellen Sprache des höfischen Romans. Es werden das Strophenschema, die Melodie und der Versuch einer Gattungsbestimmung untersucht. Die Analyse der Sprache zielt darauf ab, die Besonderheiten und die stilistische Eigenart des Werkes aufzuzeigen.
5 Verhältnis von Autor und Erzähler: In diesem Kapitel wird das Verhältnis von Autor und Erzähler im „Titurel“ beleuchtet. Es wird ein kurzer Einblick in die Autorschaft im Mittelalter gegeben, um das Verhältnis von Erzähler und Autor im „Titurel“ zu klären und eine mögliche Verschmelzung aufzudecken. Die verschiedenen Erzählerrollen im Werk werden gegenübergestellt und analysiert. Die Betrachtung dieses Kapitels dient der Klärung der narrativen Perspektive und der Gestaltung des Erzählvorgangs.
6 Der Erzählstil des „Titurel“: Dieses Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse des Erzählstils des „Titurel“. Es untersucht die spezifischen Merkmale des Erzählens in diesem Werk, möglicherweise im Vergleich zu anderen Werken Wolframs oder der damaligen Epoche. Die Analyse wird die stilistischen Besonderheiten hervorheben und deren Bedeutung für das Verständnis des Werkes beleuchten. Es könnten Aspekt wie der Umgang mit Zeit, der Einsatz von Dialogen, die Erzählperspektive und der Grad an Detailliertheit beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Wolfram von Eschenbach, Titurel, Parzival, höfischer Roman, Fragment, Überlieferung, sprachliche Form, Strophenform, Erzähler, Autorschaft, Mittelalter, Minne, Sigune, Schionatulander.
Häufig gestellte Fragen zu Wolframs von Eschenbach "Titurel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die stilistische Eigenart von Wolframs von Eschenbachs unvollendetem Werk "Titurel". Im Fokus stehen das Verhältnis zu "Parzival", der Fragmentcharakter, die sprachliche Gestaltung und die Erzählerrolle. Ziel ist ein tieferes Verständnis der ungewöhnlichen Poetik des "Titurel".
Wie ist der Text strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung und Zielsetzung, das Verhältnis zu "Parzival" als Vorgeschichte, der Fragmentcharakter inklusive Überlieferungsprobleme, die sprachliche Form und ihre Abweichung vom höfischen Roman, das Verhältnis von Autor und Erzähler mit Analyse verschiedener Erzählerrollen, eine detaillierte Analyse des Erzählstils und abschließend eine Zusammenfassung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Welches Verhältnis besteht zwischen "Titurel" und "Parzival"?
"Titurel" dient als Vorgeschichte zu "Parzival", insbesondere zu der Geschichte von Sigune und Schionatulander. Die Kenntnis von "Parzival" wird beim Leser vorausgesetzt. Diese Positionierung als Vorgeschichte ist untypisch und kennzeichnet das Werk.
Wie ist der Fragmentcharakter von "Titurel" relevant für die Arbeit?
Der Fragmentcharakter mit seinen Überlieferungsproblemen (drei Handschriften: G, H, M mit Unterschieden und Unvollständigkeiten) stellt eine zentrale Herausforderung für die Interpretation dar. Die Arbeit untersucht die Fragmentierung und diskutiert mögliche Gründe für Wolframs Nicht-Vollendung des Werkes.
Wie unterscheidet sich die Sprache von "Titurel" vom höfischen Roman?
Die Arbeit analysiert die sprachliche Gestaltung von "Titurel" und deren Abweichung von der traditionellen Sprache des höfischen Romans. Untersucht werden das Strophenschema, die Melodie und der Versuch einer Gattungsbestimmung. Die Analyse soll die stilistische Eigenart des Werkes hervorheben.
Welche Rolle spielt die Erzählerrolle in "Titurel"?
Die Arbeit beleuchtet das Verhältnis von Autor und Erzähler, gibt einen Einblick in die mittelalterliche Autorschaft und analysiert verschiedene Erzählerrollen im Werk. Ziel ist die Klärung der narrativen Perspektive und die Gestaltung des Erzählvorgangs. Die Polyfunktionalität und gegensätzliche Ausformungen der Erzählerrede werden untersucht.
Wie wird der Erzählstil von "Titurel" beschrieben?
Ein Kapitel widmet sich einer detaillierten Analyse des Erzählstils, möglicherweise im Vergleich zu anderen Werken Wolframs oder der Epoche. Aspekte wie der Umgang mit Zeit, der Einsatz von Dialogen, die Erzählperspektive und der Detaillierungsgrad werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text und die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wolfram von Eschenbach, Titurel, Parzival, höfischer Roman, Fragment, Überlieferung, sprachliche Form, Strophenform, Erzähler, Autorschaft, Mittelalter, Minne, Sigune, Schionatulander.
- Quote paper
- Angelina Schulz (Author), 2009, Wolframs von Eschenbach „Titurel“: Formale, strukturelle und sprachliche Besonderheiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165925