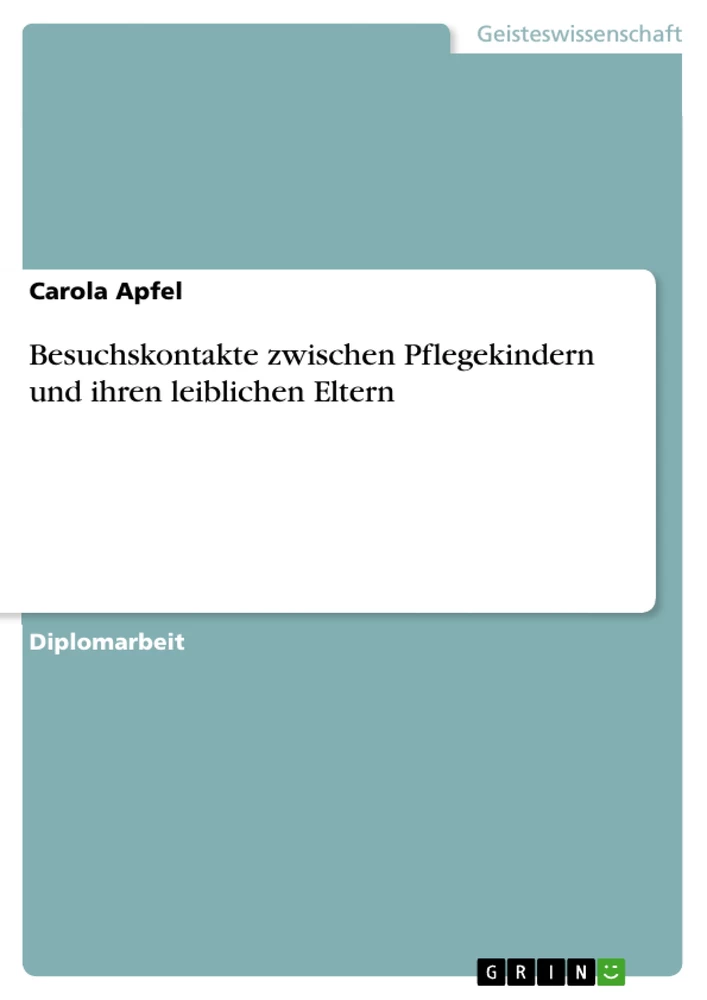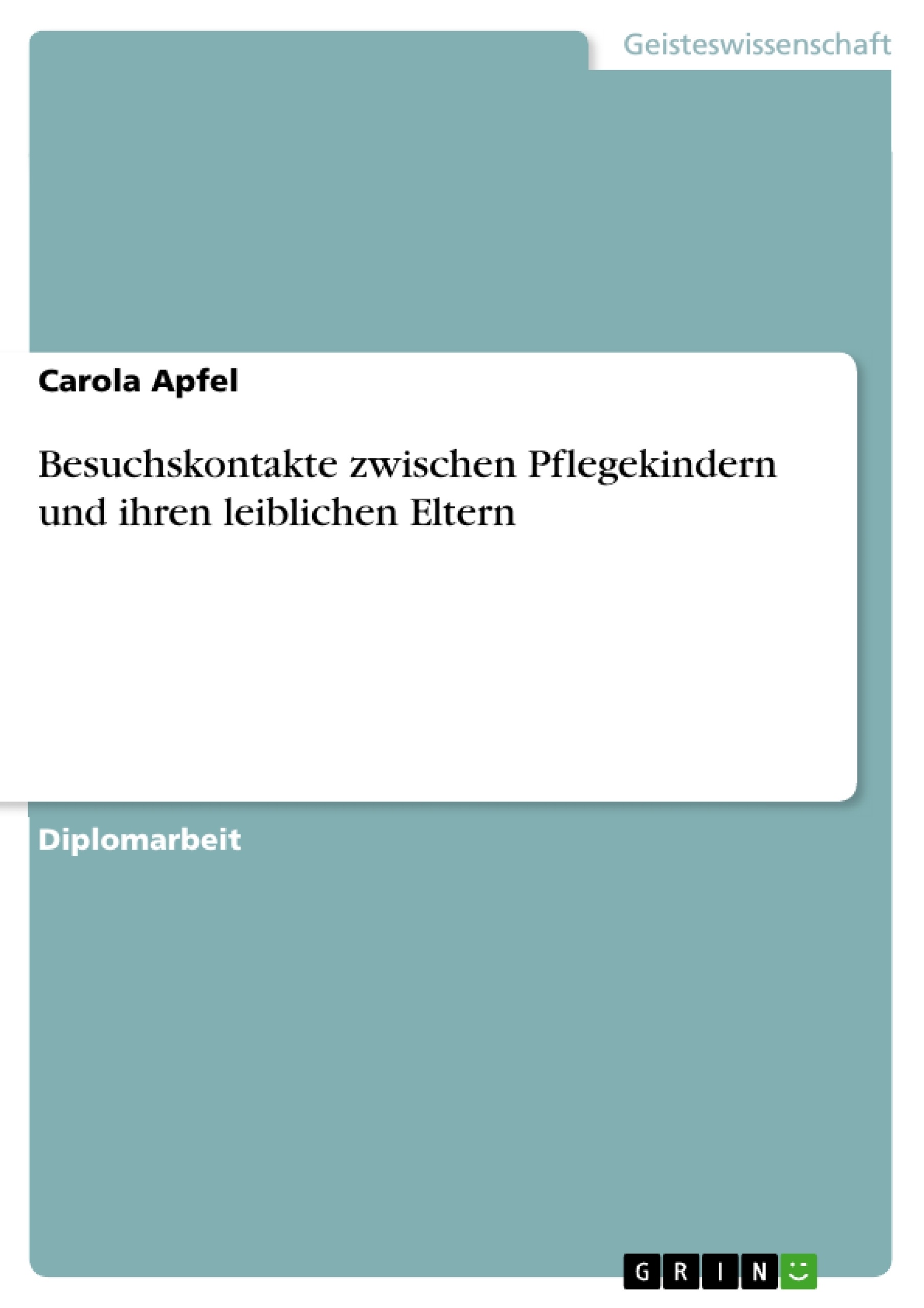Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Bedeutung von Besuchskontakten zwischen Pflegekindern und ihren Herkunftseltern für Kinder in Vollzeitpflege. Das zentrale Forschungsinteresse gilt der Frage, welche Umgangsregelung am wahrscheinlichsten eine positive Entwicklung des Kindes ermöglicht.
Dazu werden schwerpunktmäßig folgende Fragestellungen verfolgt:
Welchen Nutzen impliziert die Berücksichtigung theoretischer Pflegefamilienkonzepte bei der Entscheidung über die Regelung von Kontakten zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern?
Worin liegen die Chancen von Besuchskontakten, wo sind die Grenzen?
Welche Rolle spielen die Erfahrungen des Kindes in seiner Herkunftsfamilie für die Beziehung zu seinen leiblichen Eltern nach der Fremdunterbringung?
Durch welche Faktoren wird die förderliche oder belastende Auswirkung von Besuchskontakten beeinflusst?
Welche Konsequenzen für die Umgangsgestaltung ergeben sich aus auftauchenden Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Kontakten?
Das Ziel der Arbeit besteht zunächst darin, in einem ersten Teil theoriegeleitete Antworten auf diese Fragen herauszuarbeiten.
Grundlage des zweiten Teils sind Interviews mit Experten aus dem Pflegekinderbereich, die nach den Standards der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet werden. Das Untersuchungsinteresse gilt den fachlichen Einschätzungen sowie dem Erfahrungs- und Handlungswissen über Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und ihren Herkunftseltern.
Durch eine Zusammenführung der Erkenntnisse aus dem Theorieteil und aus den praxisbezogenen Aussagen eröffnet sich die Möglichkeit, das fachpraktische Handeln mit den relevanten theoretischen Grundlagen zu vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG
- 1.2. FORSCHUNGSSTAND
- 1.3. AUFBAU DER DIPLOMARBEIT
- 1.4. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND EINGRENZUNG
- 2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN VON UMGANGSREGELUNGEN
- 2.1. § 1684 BGB: UMGANG DES KINDES MIT DEN ELTERN
- 2.2. § 1685 BGB: UMGANG DES KINDES MIT ANDEREN BEZUGSPERSONEN
- 2.3. ZUSAMMENFASSUNG DER MÖGLICHKEITEN DES FAMILIENGERICHTS ZUR REGELUNG DES UMGANGS
- 3. KONKURRIERENDE PFLEGEFAMILIENKONZEPTE
- 3.1. DAS ERSATZFAMILIENKONZEPT
- 3.1.1 Die Objektbeziehungstheorie
- 3.1.2 Die Bindungstheorie
- 3.1.2.1 Bindungsqualitäten
- 3.1.2.2 Mütterliche Feinfühligkeit
- 3.1.2.3 Bindungsstörungen
- 3.1.3 Besuchskontakte aus der Perspektive des Ersatzfamilienkonzeptes
- 3.2. DAS ERGÄNZUNGSFAMILIENKONZEPT
- 3.2.1 Die Relevanz der Bindungstheorie für das Ergänzungsfamilienkonzept
- 3.2.2 Systemische Sicht von Pflegeverhältnissen
- 3.2.2.1 Strukturmerkmale in Pflegefamilien-Systemen
- 3.2.3 Besuchskontakte aus der Perspektive des Ergänzungsfamilienkonzeptes
- 3.3. GEGENÜBERSTELLUNG DER BEIDEN KONZEPTE
- 3.1. DAS ERSATZFAMILIENKONZEPT
- 4. TRAUMATISIERUNG VON KINDERN DURCH IHRE ELTERN
- 4.1. BEGRIFFSKLÄRUNG UND MÖGLICHE FOLGEN
- 4.1.1 Posttraumatische Belastungsstörung
- 4.1.2 Bindungsstörungen und deren Bedeutung für die kindliche Entwicklung
- 4.2. GÜNSTIGE UND HINDERLICHE BEDINGUNGEN BEI DER VERARBEITUNG VON TRAUMATISCHEN ERFAHRUNGEN
- 4.1. BEGRIFFSKLÄRUNG UND MÖGLICHE FOLGEN
- 5. ZENTRALE ASPEKTE VON BESUCHSKONTAKTEN
- 5.1. AUSWIRKUNGEN VON BESUCHSKONTAKTEN
- 5.1.1 Ergebnisse für die Pflegekinder
- 5.1.1.1 Ausgangsbedingungen des Pflegeverhältnisses
- 5.1.1.2 Auswirkungen von Kontakten auf den pflegekindlichen Integrationsprozess
- 5.1.1.3 Einfluss von Kontakten auf die Beziehung zwischen Pflegekind und Herkunftseltern
- 5.1.2 Ergebnisse für die Pflegeeltern
- 5.1.2.1 Ausgangsbedingungen des Pflegeverhältnisses
- 5.1.2.2 Auswirkungen von Kontakten auf die Pflegeeltern
- 5.1.2.3 Bewältigung der Belastungen
- 5.1.3 Ergebnisse für die Herkunftseltern
- 5.1.3.1 Klarheit der Perspektive des Pflegeverhältnisses
- 5.1.3.2 Verarbeitung der Kontakte
- 5.1.1 Ergebnisse für die Pflegekinder
- 5.2. DIE FUNKTION VON BESUCHSKONTAKTEN
- 5.2.1 Besuchskontakte bei zeitlich befristeter Pflege
- 5.2.2 Besuchskontakte bei Dauerpflege
- 5.3. FÖRDERLICHE UND BELASTENDE EINFLUSSFAKTOREN AUF BESUCHSKONTAKTE
- 5.3.1 Traumatisierung des Pflegekindes durch die leiblichen Eltern
- 5.3.2 Psychische Erkrankung der Herkunftseltern
- 5.3.3 Einstellung der Herkunftseltern
- 5.3.4 Einstellung der Pflegeeltern
- 5.3.5 Fazit
- 5.4. EINSCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS VON BESUCHSKONTAKTEN
- 5.4.1 Mögliche Indikationen für begleiteten Umgang
- 5.4.2 Die Rolle des Umgangsbegleiters
- 5.4.3 Ausschlusskriterien
- 5.4.4 Fazit
- 5.1. AUSWIRKUNGEN VON BESUCHSKONTAKTEN
- 6. METHODISCHES VORGEHEN
- 6.1. DIE ZIELSETZUNG UND FRAGESTELLUNG DER UNTERSUCHUNG
- 6.2. DIE FORSCHUNGSMETHODE: QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG
- 6.3. DIE INTERVIEWFORM: EXPERTENINTERVIEW
- 6.3.1 Die Leitfadenentwicklung
- 6.3.2 Die Interviewdurchführung und Transkription
- 6.3.3 Stichprobenbeschreibung
- 6.4. DAS AUSWERTUNGSVORGEHEN: QUALITATIVE INHALTSANALYSE
- 7. DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DES EMPIRISCHEN MATERIALS
- 7.1. DAS KATEGORIENSYSTEM
- 7.2. ALLGEMEINE BEDEUTUNG VON BESUCHSKONTAKTEN
- 7.2.1 Subkategorie: Zielsetzung
- 7.2.1.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.2.2 Subkategorie: Chancen und Funktionen
- 7.2.2.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.2.3 Subkategorie: Grenzen
- 7.2.3.1 Grenzen der Funktion
- 7.2.3.2 Grenzen der Indikation
- 7.2.3.3 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.2.1 Subkategorie: Zielsetzung
- 7.3. EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE AUSWIRKUNG VON BESUCHSKONTAKTEN
- 7.3.1 Günstige Faktoren
- 7.3.1.1 Rahmenbedingungen
- 7.3.1.2 Beziehungsaspekte
- 7.3.1.3 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.3.2 Belastende Faktoren
- 7.3.2.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.3.1 Günstige Faktoren
- 7.4. UMGANG MIT SCHWIERIGKEITEN
- 7.4.1 Verhaltensauffälligkeiten des Kindes
- 7.4.1.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.4.2 Kontaktverweigerung des Kindes
- 7.4.2.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.4.3 Traumatisierung
- 7.4.3.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.4.4 Einschränkung und Ausschluss von Kontakten
- 7.4.4.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.4.1 Verhaltensauffälligkeiten des Kindes
- 7.5. BESUCHSKONTAKTE UNTER DEM FOKUS DER THEORETISCHEN PFLEGEFAMILIENKONZEPTE
- 7.5.1 Grundsätzliche Überlegungen
- 7.5.1.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.5.2 Stellungnahmen zum Ersatzfamilienkonzept
- 7.5.2.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.5.3 Stellungnahmen zum Ergänzungsfamilienkonzept
- 7.5.3.1 Zusammenfassung und Diskussion
- 7.5.1 Grundsätzliche Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Kontakte auf die beteiligten Personen (Pflegekinder, Pflegeeltern, leibliche Eltern) zu analysieren und die Bedingungen für gelingende oder problematische Kontakte zu identifizieren.
- Rechtliche Grundlagen von Umgangskontakten
- Konkurrierende Pflegefamilienkonzepte (Ersatz- und Ergänzungsfamilienkonzept)
- Traumatisierung von Kindern durch ihre Eltern und deren Auswirkungen auf Besuchskontakte
- Auswirkungen von Besuchskontakten auf Pflegekinder, Pflegeeltern und leibliche Eltern
- Förderliche und belastende Einflussfaktoren auf Besuchskontakte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein, formuliert die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit, beschreibt den Forschungsstand und den Aufbau der Arbeit sowie die verwendeten Begrifflichkeiten und Eingrenzungen des Themas. Es legt den Grundstein für die nachfolgenden Kapitel und definiert den Rahmen der Untersuchung.
2. Gesetzliche Grundlagen von Umgangregelungen: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen von Umgangskontakten zwischen Kindern und ihren Eltern, basierend auf den Paragraphen 1684 und 1685 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Es analysiert die Möglichkeiten des Familiengerichts, den Umgang zu regeln und die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Besuchskontakten.
3. Konkurrierende Pflegefamilienkonzepte: Hier werden das Ersatzfamilienkonzept und das Ergänzungsfamilienkonzept gegenübergestellt. Es werden die relevanten Theorien (Objektbeziehungstheorie und Bindungstheorie) erläutert und deren Bedeutung für die beiden Konzepte im Kontext von Besuchskontakten herausgearbeitet. Die Kapitel analysieren die unterschiedlichen Perspektiven auf die Rolle der leiblichen Eltern und die Bedeutung von Besuchskontakten in beiden Konzepten.
4. Traumatisierung von Kindern durch ihre Eltern: Dieses Kapitel befasst sich mit der Traumatisierung von Kindern durch ihre Eltern und den möglichen Folgen, wie z.B. Posttraumatische Belastungsstörungen und Bindungsstörungen. Es werden sowohl die Auswirkungen der Traumatisierung auf die kindliche Entwicklung als auch günstige und hinderliche Bedingungen für die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen im Kontext der Besuchskontakte diskutiert.
5. Zentrale Aspekte von Besuchskontakten: In diesem Kapitel werden die Auswirkungen von Besuchskontakten auf Pflegekinder, Pflegeeltern und Herkunftseltern detailliert untersucht. Es werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert, die verschiedenen Perspektiven beleuchtet und die Funktion der Besuchskontakte in der zeitlich befristeten und Dauerpflege analysiert. Zudem werden förderliche und belastende Einflussfaktoren auf die Besuchskontakte identifiziert und diskutiert, inklusive Aspekten wie Einschränkungen und Ausschluss von Kontakten.
6. Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Diplomarbeit. Es erläutert die qualitative Forschungsmethode, die Wahl des Experteninterviews als Forschungsinstrument, die Leitfadenentwicklung, die Durchführung und Transkription der Interviews sowie das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse zur Auswertung des empirischen Materials. Es bietet eine detaillierte Beschreibung der angewandten Methoden und ihrer Begründung.
Schlüsselwörter
Besuchskontakte, Pflegekinder, leibliche Eltern, Pflegeeltern, Ersatzfamilienkonzept, Ergänzungsfamilienkonzept, Bindungstheorie, Traumatisierung, § 1684 BGB, § 1685 BGB, qualitative Sozialforschung, Experteninterview, Integrationsprozess.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Auswirkungen dieser Kontakte auf die beteiligten Personen (Pflegekinder, Pflegeeltern, leibliche Eltern) und die Identifizierung von Bedingungen für gelingende oder problematische Kontakte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Rechtliche Grundlagen von Umgangskontakten (basierend auf §§ 1684 und 1685 BGB), konkurrierende Pflegefamilienkonzepte (Ersatz- und Ergänzungsfamilienkonzept), Traumatisierung von Kindern durch ihre Eltern und deren Auswirkungen auf Besuchskontakte, Auswirkungen von Besuchskontakten auf alle Beteiligten und förderliche sowie belastende Einflussfaktoren auf die Kontakte.
Welche Forschungsmethoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, konkret das Experteninterview. Die Leitfadenentwicklung, die Durchführung und Transkription der Interviews sowie die qualitative Inhaltsanalyse zur Auswertung des empirischen Materials werden detailliert beschrieben.
Welche Theorien spielen eine Rolle in der Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf relevante Theorien wie die Objektbeziehungstheorie und die Bindungstheorie, insbesondere im Kontext der beiden konkurrierenden Pflegefamilienkonzepte (Ersatz- und Ergänzungsfamilienkonzept). Die Bindungsqualitäten, die mütterliche Feinfühligkeit und Bindungsstörungen werden ebenfalls thematisiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (Fragestellung, Zielsetzung, Forschungsstand, Aufbau, Begriffsbestimmung), Gesetzliche Grundlagen, Konkurrierende Pflegefamilienkonzepte, Traumatisierung von Kindern, Zentrale Aspekte von Besuchskontakten, Methodisches Vorgehen und Darstellung und Interpretation des empirischen Materials. Jedes Kapitel beinhaltet eine detaillierte Untersuchung des jeweiligen Themas.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse zur Auswirkung von Besuchskontakten auf Pflegekinder, Pflegeeltern und leibliche Eltern, identifiziert förderliche und belastende Einflussfaktoren und untersucht den Umgang mit Schwierigkeiten wie Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, Kontaktverweigerung und Traumatisierung. Die Ergebnisse werden im Kontext der theoretischen Pflegefamilienkonzepte diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen von Besuchskontakten und den Bedingungen für gelingende oder problematische Kontakte. Sie beleuchtet die Bedeutung der verschiedenen Perspektiven der Beteiligten und bietet einen Beitrag zum Verständnis und zur Optimierung von Besuchskontakten in Pflegefamilien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Besuchskontakte, Pflegekinder, leibliche Eltern, Pflegeeltern, Ersatzfamilienkonzept, Ergänzungsfamilienkonzept, Bindungstheorie, Traumatisierung, § 1684 BGB, § 1685 BGB, qualitative Sozialforschung, Experteninterview, Integrationsprozess.
- Quote paper
- Carola Apfel (Author), 2009, Besuchskontakte zwischen Pflegekindern und ihren leiblichen Eltern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165812