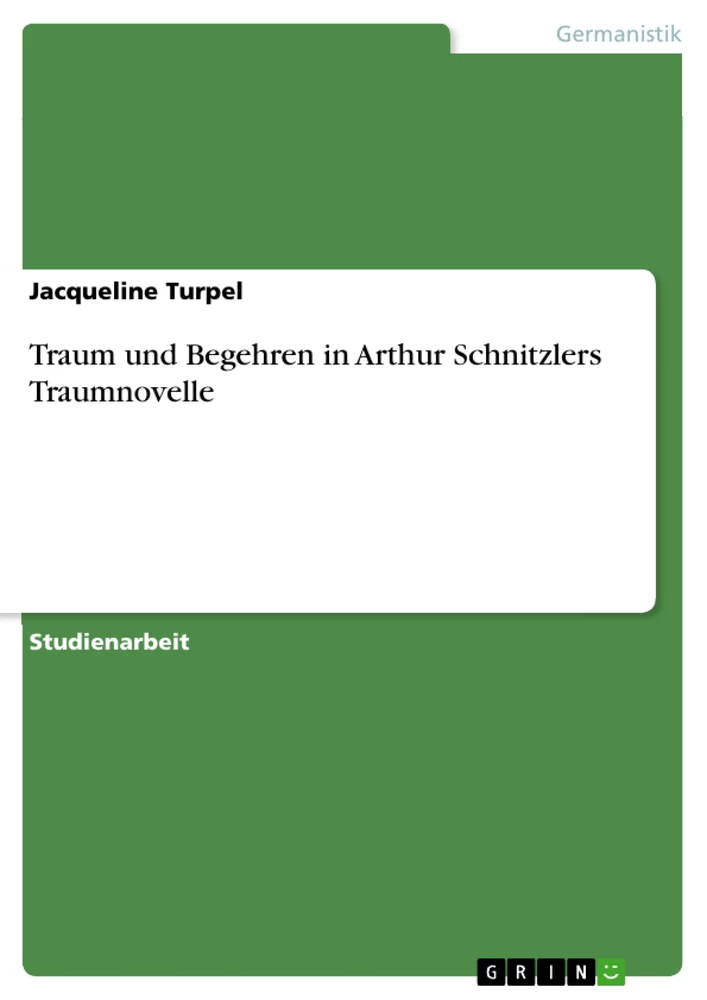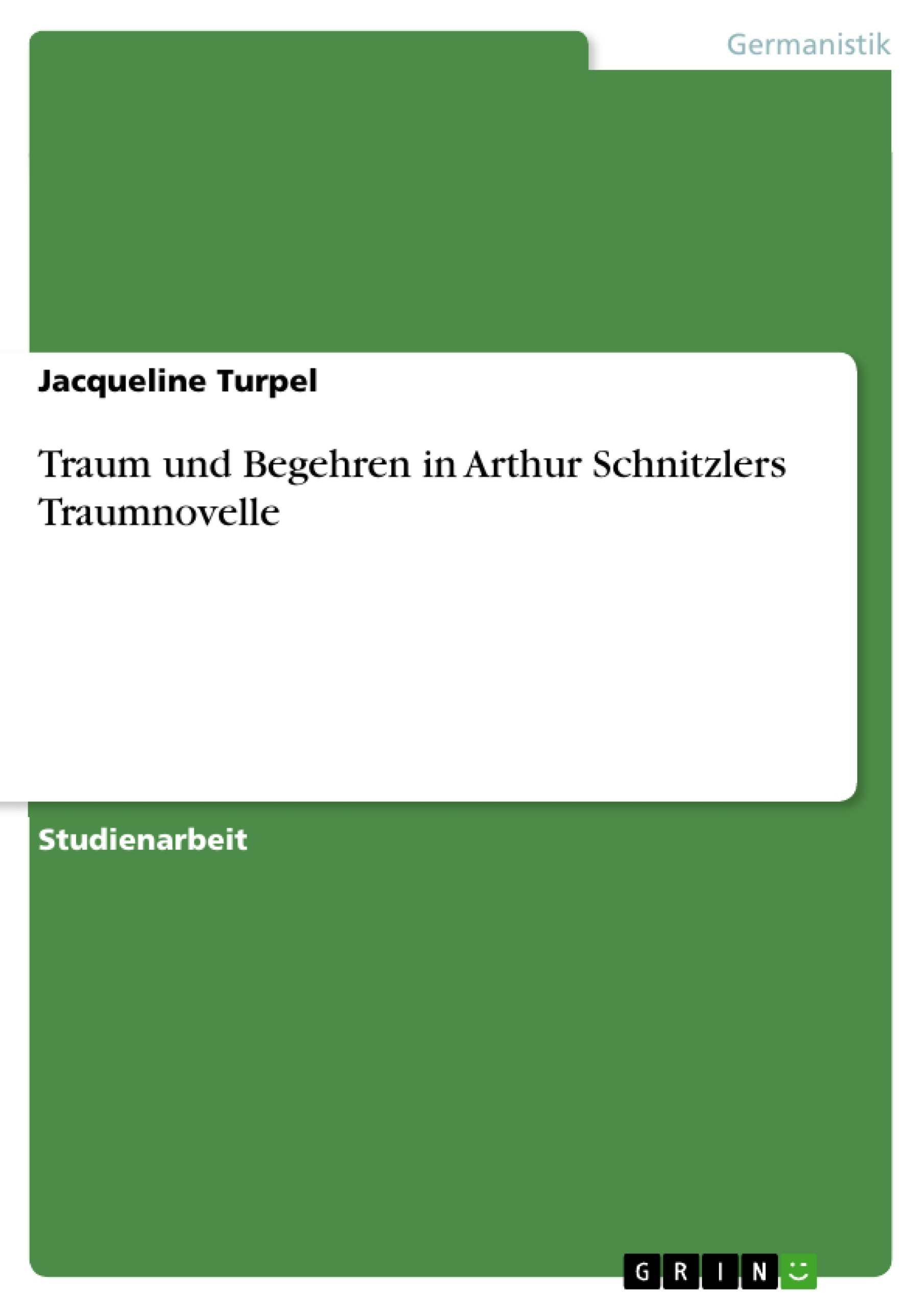Arthur Schnitzlers Traumnovelle erscheint im Jahre 1926. Für die damalige Zeit eckt Schnitzler mit seiner Themenwahl eng an die Grenzen der Moral der 20er Jahre an. Das Ehepaar Fridolin und Albertine, welches dem gehobenen Bürgertum angehört, führt eine vorbildliche Beziehung. Er ist berufstätig, sie Hausfrau und Mutter. Im Laufe der Novelle werden sich beide allmählich ihrer Unzufriedenheit und ihrem Unmut gegenüber ihrer nach außen hin fehlerfreien und perfekten Ehe bewusst, finden eine Lösung für den Konflikt und sind am Ende erneut vereint. So oder so ähnlich könnte eine Kurzfassung der Novelle nach einmaligem Lesen klingen. Die von Schnitzler erarbeitete Handlung erscheint auf dem ersten Blick logisch, die einzelnen Etappen chronologisch aufeinander folgend. Man könnte sogar fünf Akte eines klassischen Dramas herausarbeiten, mit einer Peripetie, verschiedenen Lösungszweigen und einer sich zum Guten wendenden Katastrophe am Ende. Doch Arthur Schnitzlers Traumnovelle ist weit vielschichtiger als dass man an diesem Punkt der Interpretation stehen bleiben könnte. Jedes einzelne Wort, jedes Schweigen, jedes Lichtspiel wurde von Schnitzler inszeniert und bildet einen Teil des Gesamtkunstwerks „Traumnovelle“. Unzählige Forscher haben sich mit ihr befasst, sind teilweise zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen und doch scheint noch nicht alles über dieses Werk gesagt zu sein. Zahlreiche Themen, Motive und Symbole müssen erörtert werden um einer Gesamtinterpretation gerecht zu werden. Die folgende Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was in diesem Fall den Rahmen sprengen würde. Das zu bearbeitende Gebiet musste also stark eingegrenzt werden und beschränkt sich hier auf die Rolle des Traumes in der Novelle, sowie das Begehren der Ehepartner. Wobei zuerst noch kurz der nicht zu verachtenden Einfluss der Psychoanalyse auf Schnitzlers Werk erläutert wird. Die im Jahre 1900 fast zeitgleich erschienene „Traumdeutung“ Freuds legt die Frage nahe inwieweit sich Schnitzler und Freud gegenseitig beeinflusst haben oder ob man gar von einer Art „Doppelgängertum“ sprechen kann. Welche Rolle fällt dem Traum in der Novelle aus psychoanalytischer Sicht zu? Nachdem sich beide Partner ihre Erlebnisse und Träume erzählt haben, scheint sich am Ende die Krise, in der sich die Ehe befand, zu lösen. Kann der Traum als eine Art Katharsis gesehen werden, ein Mittel also um Konflikte sichtbar zu machen und damit zu reduzieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Traum
- Schnitzler/Freud = Doppelgänger?
- Der Traum als Katharsis?
- „Kein Traum ist völlig Traum“
- Das Begehren Fridolins
- Widerstreit zwischen Wille und Können
- Eros oder Caritas?
- Das Begehren Albertine
- Albertines Traum als Wunschtraum?
- Aussprache und Ausblick in die Zukunft
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle des Traumes in Arthur Schnitzlers „Traumnovelle“ und dem Begehren der Ehepartner Fridolin und Albertine. Im Zentrum steht die Frage, inwieweit die Psychoanalyse von Sigmund Freud Schnitzlers Werk beeinflusst hat und welche Funktion der Traum in der Novelle aus psychologischer Sicht einnimmt.
- Der Einfluss der Psychoanalyse auf Schnitzlers Werk, insbesondere die Frage nach einem möglichen „Doppelgängertum“ zwischen Schnitzler und Freud.
- Die Funktion des Traumes in der Novelle und seine mögliche Rolle als Katharsis.
- Die Darstellung des Begehrens Fridolins und die Frage nach der Motivation seines Handelns.
- Die Interpretation von Albertines Traum und die Bedeutung ihrer Träume für die Beziehung.
- Die Aussprache der Eheleute und die Frage, ob die Krise die Beziehung irreparabel geschädigt hat oder sie gestärkt hat.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die „Traumnovelle“ und ihre zentrale Thematik vor. Sie hebt die Ambivalenz der Ehe zwischen Fridolin und Albertine und die Vielschichtigkeit des Werkes hervor.
Kapitel 2 analysiert die Funktion des Traumes in der Novelle im Kontext der Psychoanalyse und beleuchtet die mögliche Einflussnahme von Sigmund Freud auf Schnitzlers Werk. Es wird auf die Verschleierung der Trauminhalte und die Ambivalenz zwischen Traum und Realität eingegangen.
Kapitel 3 konzentriert sich auf Fridolins Begehren und dessen Entwicklung im Laufe der Handlung. Es beleuchtet die Motivationen für sein Verhalten und stellt die Frage nach der erotischen Natur seiner Erlebnisse.
Kapitel 4 widmet sich Albertines Traum und dessen Bedeutung für die Novelle. Es untersucht, ob in ihrem Traum verborgene sexuelle Sehnsüchte zum Ausdruck kommen und welche Rolle die Aussprache der Eheleute für ihre Beziehung spielt.
Schlüsselwörter
Schnitzlers Traumnovelle, Traumdeutung, Psychoanalyse, Sigmund Freud, Doppelgänger, Katharsis, Begehren, Fridolin, Albertine, Ehe, Krise, Traum und Realität, sexuelle Sehnsüchte, Verschiebung.
- Quote paper
- Jacqueline Turpel (Author), 2008, Traum und Begehren in Arthur Schnitzlers Traumnovelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165804