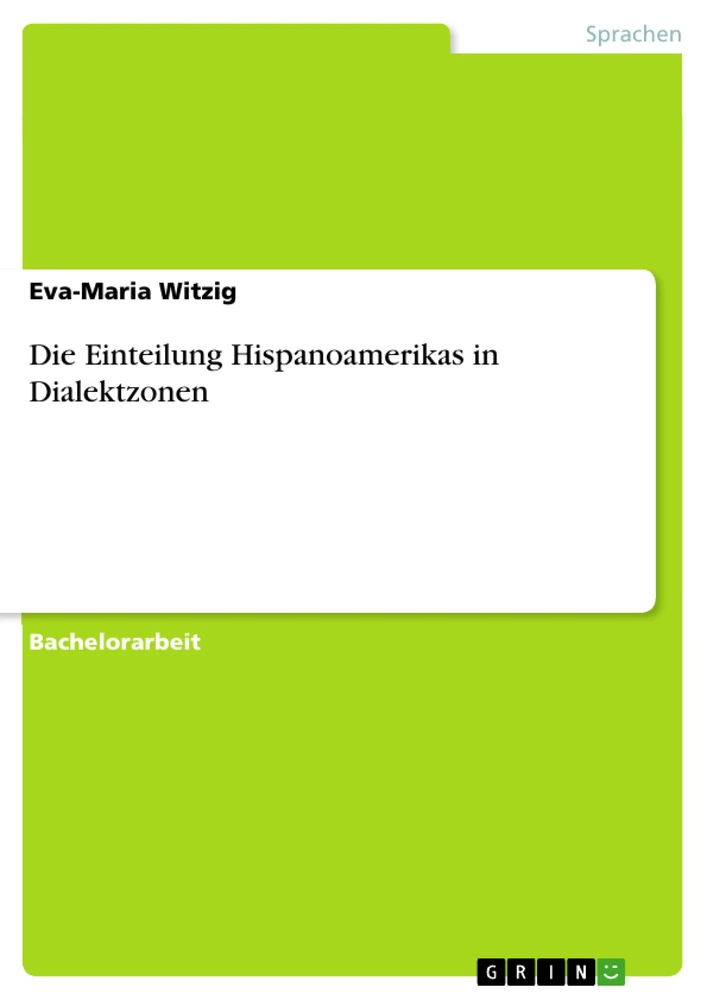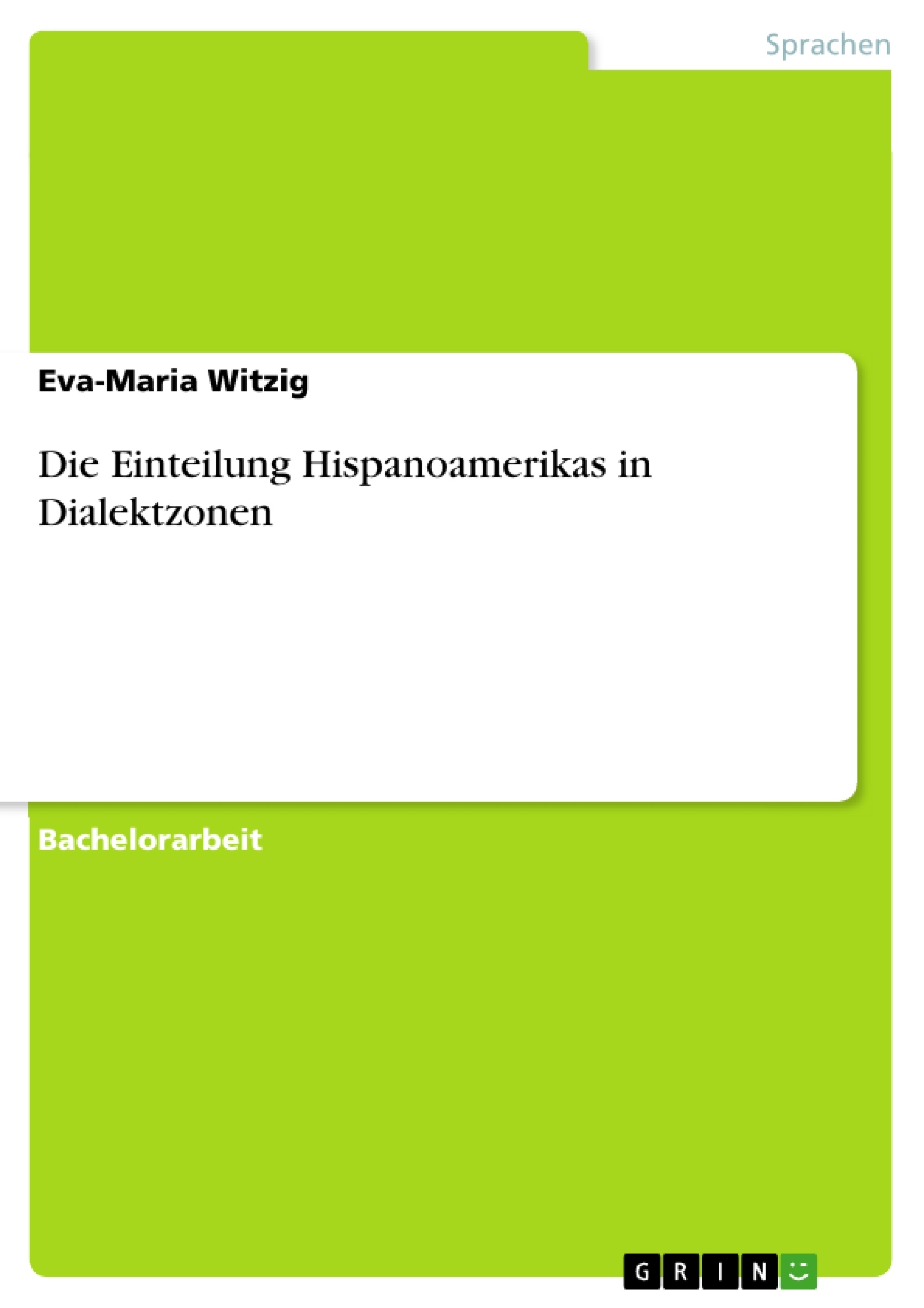Sprachgeographie bedeutet in der Sprachwissenschaft eine dialektologische und vergleichende Methode. Dabei wird in einem bestimmten Territorium eine verhältnismäßig hohe Anzahl an Sprechern direkt und einheitlich befragt. Danach werden die festgestellten sprachlichen Formen, die entweder lexikalischer, phonischer oder grammatischer Natur sein können, in einem Punktenetz aufgezeichnet. Diese Methode hat vor allem im romanischen Gebiet eine außerordentliche Entwicklung im 20. Jahrhundert erfahren. (Coseriu 1975:1)
Im romanischen Raum war die Erscheinung des Sprachatlasses Atlas linguistique de la France von Jules Gilliéron (1854-1925) eine Wende in der Geschichte der Sprachwissenschaft. Anhand eines Fragebogens mit etwa 1400 Fragen ging sein Gehilfe Edmond Edmont im August 1897 auf eine Forschungsreise quer durch Frankreich. In weniger als vier Jahren wurden in 550 Orten insgesamt 720 Sprecher befragt und dabei wurden mehr als eine Million Antworten notiert und später in 1920 Karten ausgewertet. So gelang es Jules Gilliéron die verschiedenen Dialekte und Mundarten Frankreichs zu erforschen. (Coseriu 1975:15f.)
Nun stellen Sie sich dieses immense Projekt in der Größenordnung Hispanoamerikas vor! Das extrem große Territorium und die gigantische Sprecheranzahl würden es extrem kostspielig und zeitaufwendig machen ganz Hispanoamerika nach einem einheitlichen Fragebogen zu untersuchen. Doch gerade diese Informationen wären extrem wichtig um Dialektgrenzen bzw. Isoglossenbündel ausfindig zu machen. In diesem Kontext ist es nicht erstaunlich, dass zunächst Sprachatlanten auf Landesebene erstellt wurden, Z.B. Atlas lingüístico- etnográfico de Colombia (1982- 1983), Atlas lingüístico de México (1994), El atlas lingüístico de Ecuador (1992) oder Documentos del PREDAL Argentino. El Atlas Lingüístico- Antropológico de la República Argentina (1987). Dabei ist auffallend, dass vor allem die Metropolen untersucht wurden und dass im Gegensatz zu Europa die Atlanten erst sehr spät publiziert wurden, nämlich erst zum Ende des 20. Jahrhunderts.
Aufgrund des Mangels an Informationen über die sprachlichen Phänomene ist es nicht überraschend, dass es im 20. Jahrhundert noch nicht gelungen ist Hispanoamerika in Dialektzonen einzuteilen, obwohl das Bestreben danach groß war. Bei dem Versuch Hispanoamerika in Dialektzonen einzuteilen, sind verschiedene Dialektologen immer wieder auf Hindernisse gestoßen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Henríquez Ureña
- Tierras bajas und tierras altas
- Canfield
- Rona
- Resnick
- Zamora Munné
- Cahuzac
- Fallbeispiele
- Mittelamerika: Eine geschlossene Dialektzone?
- Uruguay: Heterogen oder homogen?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Einteilung Hispanoamerikas in Dialektzonen und analysiert verschiedene Versuche, die in der Vergangenheit unternommen wurden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Mängel der bestehenden Einteilungen aufzuzeigen und die Herausforderungen bei der Entwicklung einer umfassenden und wissenschaftlich fundierten Klassifikation zu beleuchten.
- Die Geschichte der dialektologischen Forschung in Hispanoamerika
- Die verschiedenen Kriterien, die für die Einteilung von Dialektzonen verwendet wurden
- Die Probleme bei der Anwendung von Isoglossen und der Festlegung von Dialektgrenzen
- Die Bedeutung von extralinguistischen Faktoren, wie z.B. der Geschichte der Kolonialisierung und der indigenen Sprachen
- Die Bedeutung des Sprachbewusstseins der Sprecher bei der Definition von Dialektzonen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert die Methode der Sprachgeographie. Es werden historische Beispiele für Sprachatlanten vorgestellt und die Herausforderungen bei der Durchführung eines solchen Projekts in Hispanoamerika diskutiert.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Einteilung von Henríquez Ureña, die auf Substrateinflüssen der Amerindischen Sprachen basiert. Die Kritik an dieser Gliederung wird dargelegt und die Bedeutung von objektiven, sprachlichen Kriterien für die Dialektologie hervorgehoben.
- Das dritte Kapitel behandelt die Unterscheidung zwischen tierras altas und tierras bajas, die auf geografische Kriterien basiert. Die phonischen Unterschiede zwischen den beiden Regionen werden beschrieben, und es wird die Hypothese der "Acommodation climática" kritisch betrachtet.
- Das vierte Kapitel stellt die Einteilung von Canfield vor, die auf der Theorie der "accessibility" beruht. Es wird gezeigt, dass Canfield die Unterschiede zwischen den Dialekten auf die unterschiedlichen Entwicklungsstadien des andalucismo zurückführt.
- Das fünfte Kapitel analysiert die Einteilung von Rona, die auf einem System von Isoglossen basiert. Die Schwächen dieser Methode werden aufgezeigt, und es wird deutlich, dass Rona nur über ein begrenztes Wissen über die sprachlichen Merkmale bestimmter Regionen verfügte.
- Das sechste Kapitel behandelt die computergestützte Studie von Resnick, die auf der Identifizierung kleinster diatopischer Einheiten basiert. Die Vorteile und Nachteile dieser Methode werden diskutiert, und es wird deutlich, dass Resnick eine große Menge an Informationen ohne vergleichende oder analytische Auswertung präsentiert.
- Das siebte Kapitel stellt die Einteilung von Zamora Munné vor, die auf drei sprachlichen Merkmalen basiert: /-s/, /x/ und dem morphosyntaktischen Kriterium des voseo. Die geographischen Zuordnungen der verschiedenen Dialektzonen werden beschrieben.
- Das achte Kapitel beleuchtet die ethnolinguistische Studie von Cahuzac, die auf lexikalischen Kriterien basiert. Es wird gezeigt, dass Cahuzac die verschiedenen Bezeichnungen für "campesino" als Basis für seine Einteilung verwendet.
- Das neunte Kapitel behandelt zwei Fallbeispiele: Mittelamerika und Uruguay. Es wird gezeigt, dass die Einteilung dieser Regionen aufgrund von extralinguistischen Faktoren und des Mangels an zuverlässigen Informationen schwierig ist.
Schlüsselwörter
Hispanoamerika, Dialektologie, Sprachgeographie, Sprachatlas, Dialektzonen, Isoglossen, Yeísmo, Žeísmo, Voseo, Substrateinflüsse, Andalucismo, Accessibility, Lexik, Ethnolingüistik, Sprachbewusstsein, Tonführung (Entonación), Real Academia Española (RAE), Corpus de referencia del español actual (CREA).
- Quote paper
- Eva-Maria Witzig (Author), 2010, Die Einteilung Hispanoamerikas in Dialektzonen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165537