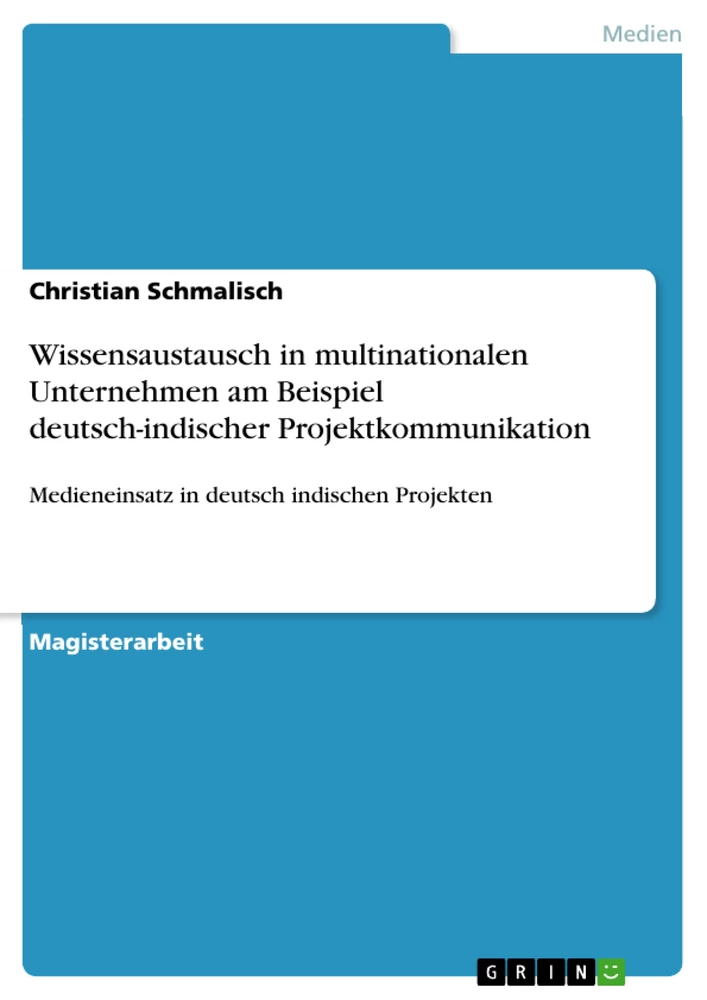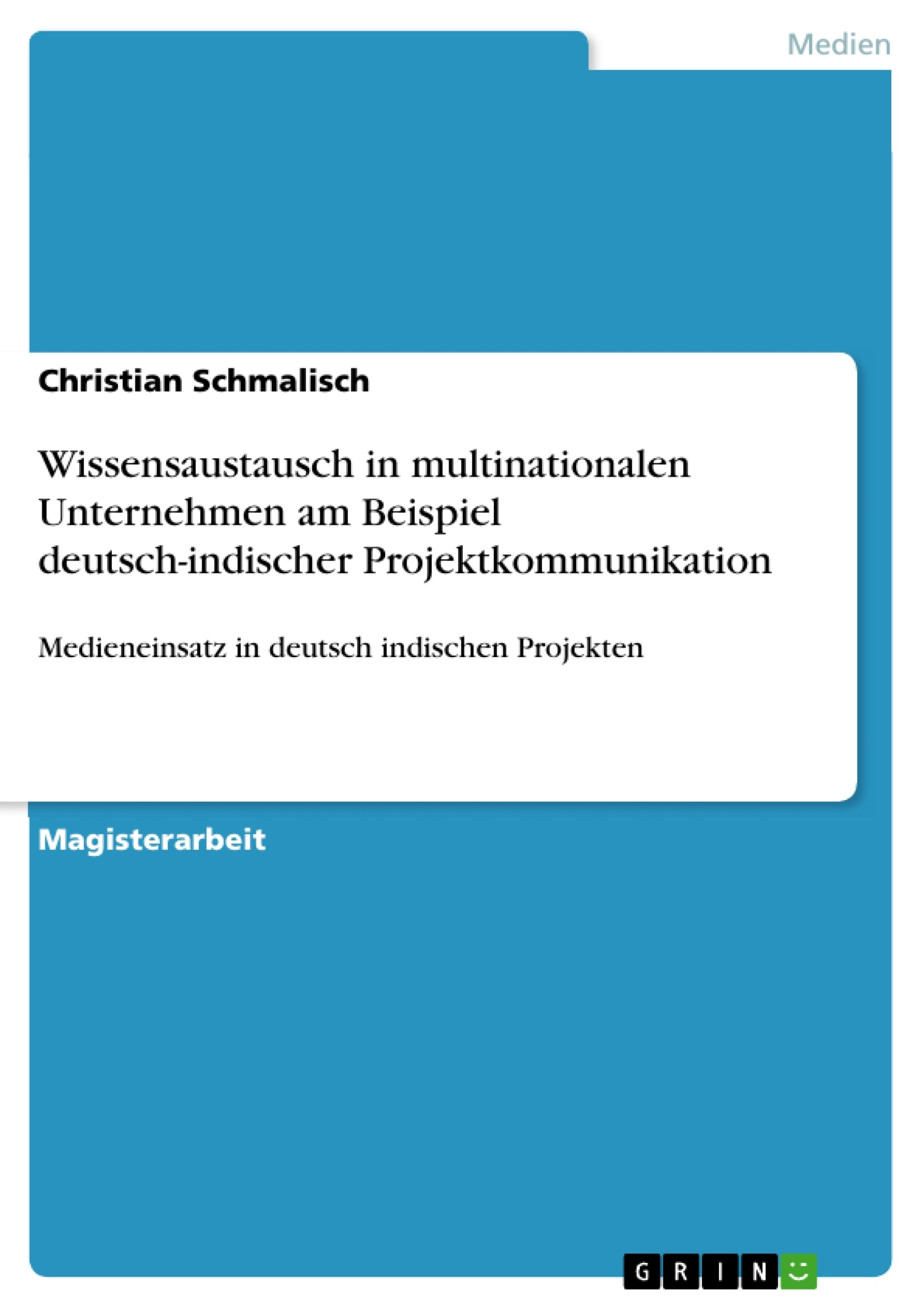Der Autor dieser Arbeit war in verschiedene deutsch-indische IT-Projekte involviert, in denen er immer wieder Kommunikationsprobleme feststellte (...). Diese Arbeit soll dazu beitragen, die Kommunikation zwischen beiden Kulturen zu verbessern.
Hintergrund und Fragestellungen
Vor dem Hintergrund stark wachsender dt.-i. Wirtschaftsbeziehungen hat das Thema um die Kommunikation beider Kulturen stark an Bedeutung zugenommen. Viele Arbeiten haben sich mit den kulturellen Unterschieden auseinandergesetzt, ihr akzeptieren und verstehen gelehrt, um Handlungsempfehlungen für ein besseres Miteinander geben zu können. Doch wie wirken sich diese Unterschiede in der konkreten Projektpraxis aus?
Hier wird die Kommunikation zwischen Deutschen und Indern innerhalb von dt.-i. Projekten fokussiert. Es wurde untersucht, wie verschiedene Medientypen eingesetzt werden, um unterschdl. anspruchsvolle Wissenstypen zwischen dt. und i. Organisationen bzw. Mitarbeitern während eines dt.-i. Projektes auszutauschen. Dabei wurde außerdem analysiert, inwiefern die Mediennutzung von bestimmten kulturellen Eigenschaften beeinflusst wird:
Eine prominente Theorie, welche die Mediennutzung in Abhängigkeit des zu transferierenden Wissens erklärt, ist die Media Richness Theorie (...).
Die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Deutschen und Inder wurden analysiert, gegen- übergestellt und in Handlungsempfehlungen für eine effiziente Kommunikation zwischen den internationalen Projektpartnern zusammengeführt.
Methoden
Um die oben angedeuteten Fragestellungen beantworten zu können, wurden die Daten von 77 dt. und i. Projektbeteiligten ausgewertet, die in einem Online-Fragebogen ermittelt
wurden. Um die Wirkung der Wissenstypen auf die Mediennutzung zu überprüfen, wurden verschiedene Häufigkeits- und Regressionsanalysen durchgeführt. Die kulturellen Eigenschaften wurden ebenso mittels Häufigkeitsanalyen explorativ auf ihre Wirkung auf die Mediennutzung untersucht.
Des Weiteren wurden 16 Interviews mit Deutschen und Indern geführt, die in die selben Projekte involviert miteinander kommunizierten, um Rückschlüsse auf den Erfolg eines Projektes durch die Mediennutzung zu ziehen.
Ergebnisse
Hinsichtlich der Auswertungen der empirischen Untersuchungen ergab sich, dass die Deutschen für den Transfer von einfach verständlichem Wissen den Medientyp einsetzen (...)
Diskussion
In der Diskussion wird darauf hingeführt, wie eine deutsch-indische Projektkommunikation verbessern werden könnte (...)
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- E Einleitung
- 1. Einleitende Worte
- 2. Geltungsbereich
- 3. Anleitung, diese Arbeit zu lesen
- T Theorie
- 1. Wissenstypen und Wissenstransfer
- 1.1. Wissenstypen
- 1.1.1. Explizites vs. implizites Wissen
- 1.1.2. Kanonisches vs. äquivokes Wissen
- 1.2. Wissenstransfer
- 1.2.1. Wissenstransfermechanismen
- 1.2.2. Barrieren
- 2. Mediennutzung
- 2.1. Media-Richness-Theory
- 3. Kulturelle Eigenschaften
- 3.1. Was ist Kultur?
- 3.2. Analyse und Operationalisierung kultureller Unterschiede
- Machtdistanz zum Vorgesetzten
- Individualität vs. Kollektivität
- Polychromes vs. Monochromes Zeitverständnis
- Hohe vs. Niedrige Kontextorientierung
- Harmoniebedürftigkeit
- Kommunikations-Empfangsgewohnheiten
- 3.3. Zusammenfassung: Kulturelle Unterschiede von deutscher und indischer Kultur
- 4. Zusammenfassung
- Empirische Analyse von deutsch-indischen Kooperationsprojekten:
- Z Zielstellung und Fragenstellungen bzw. Forschungsfragen
- 1. Zielstellung
- 2. Fragenstellungen
- 2.1. Welche Typen von Wissen werden in Projekten zwischen Deutschland und Indien ausgetauscht?
- 2.2. Welche Medien werden in welchem Ausmaß verwendet?
- 2.3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz verschiedener Medientypen und der Wissenscharakteristika?
- 2.4. Inwieweit wird die Mediennutzung von kulturellen Eigenschaften (in dem Zusammenhang: Unterschiede) beeinflusst?
- 2.5. Wie werden Medien von Deutschen und Indern genutzt, die jeweils im selben Projekt beteiligt miteinander/untereinander kommunizieren?
- M Methode
- 0. Triangulation
- 1. Online-Fragebogen (FF1 bis FF4)
- 1.1. Untersuchungsplan
- 1.2. Operationalisierung der unabhängigen Variable Mediennutzung
- 1.3. Hypothesenableitung
- 1.4. Gestaltung des Fragebogens
- 1.5. Design und Untersuchungsgruppe
- 2. Persönliche Interviews (FF5)
- 2.1. Leitfaden
- 2.2. Durchführung
- A Ergebnisse und Auswertungen
- 1. Onlinefragebogen
- 1.1. Forschungsfrage 1 (deskriptive Analysen)
- 1.1.1. Zusammenfassung
- 1.2. Forschungsfrage 2 (deskriptive Analysen)
- 1.2.1. Projektstart
- 1.2.2. Während des Projektes
- 1.2.3. Erwartungen
- 1.2.4. Privatleben
- 1.2.5. Zusammenfassung
- 1.3. Forschungsfrage 3 (Hypothesenanalyse)
- 1.3.1. Häufigkeitsdarstellungen
- 1.3.2. Hypothesenauswertung
- 1.3.3. Auswertung und Vergleich
- 1.3.4. Grafische Darstellungen
- 1.3.5. Zusammenfassung
- 1.4. Forschungsfrage 4 (explorative Datenanalyse)
- 1.4.1. Zusammenfassung
- 1.4.2. Kulturelle Eigenschaften der Deutschen und Inder
- 2. Forschungsfrage 5 (Interviews)
- 2.1. Zusammenfassung
- D Diskussion
- 1. Zusammenführung und Interpretation der Ergebnisse
- 1.1. Projektkommunikation zwischen Deutschen und Indern
- 1.2. Medieneinsatz bei verschiedenen Wissenstypen
- 1.3. Kulturelle Unterschiede von Indern und Deutschen
- 2. Schlussfolgerung – Interkulturelle Anwendbarkeit der Media-Richness-Theory
- 3. Handlungsableitungen zur Kommunikationsverbesserung
- 4. Offene Fragestellungen
- L Literaturverzeichnis
- A Anhang
- Arbeit zitieren
- Christian Schmalisch (Autor:in), 2010, Wissensaustausch in multinationalen Unternehmen am Beispiel deutsch-indischer Projektkommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165519