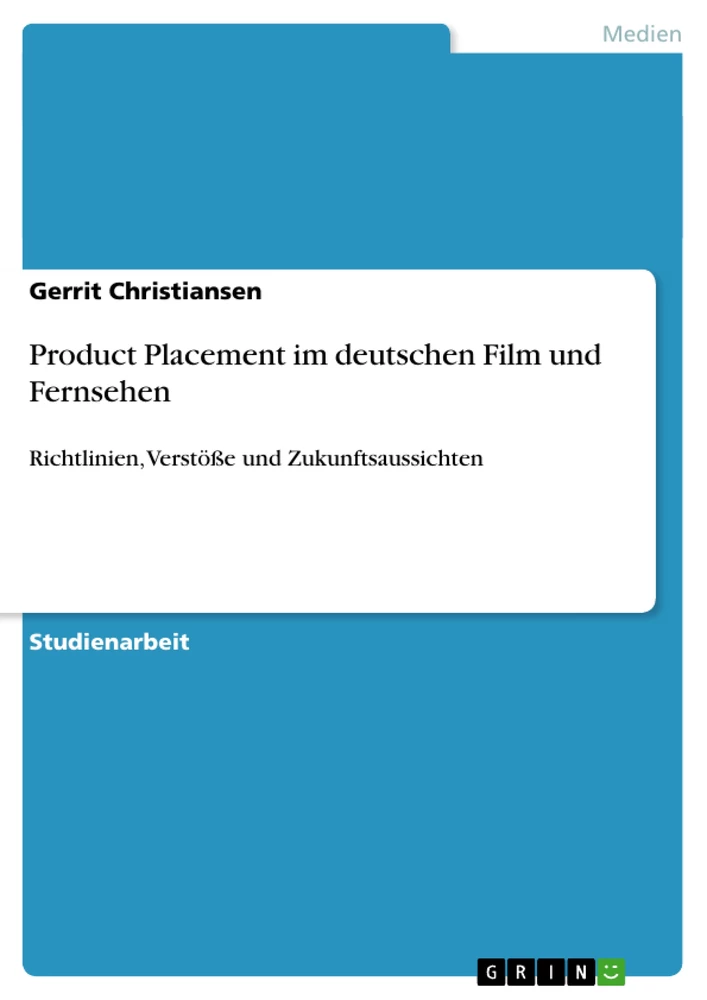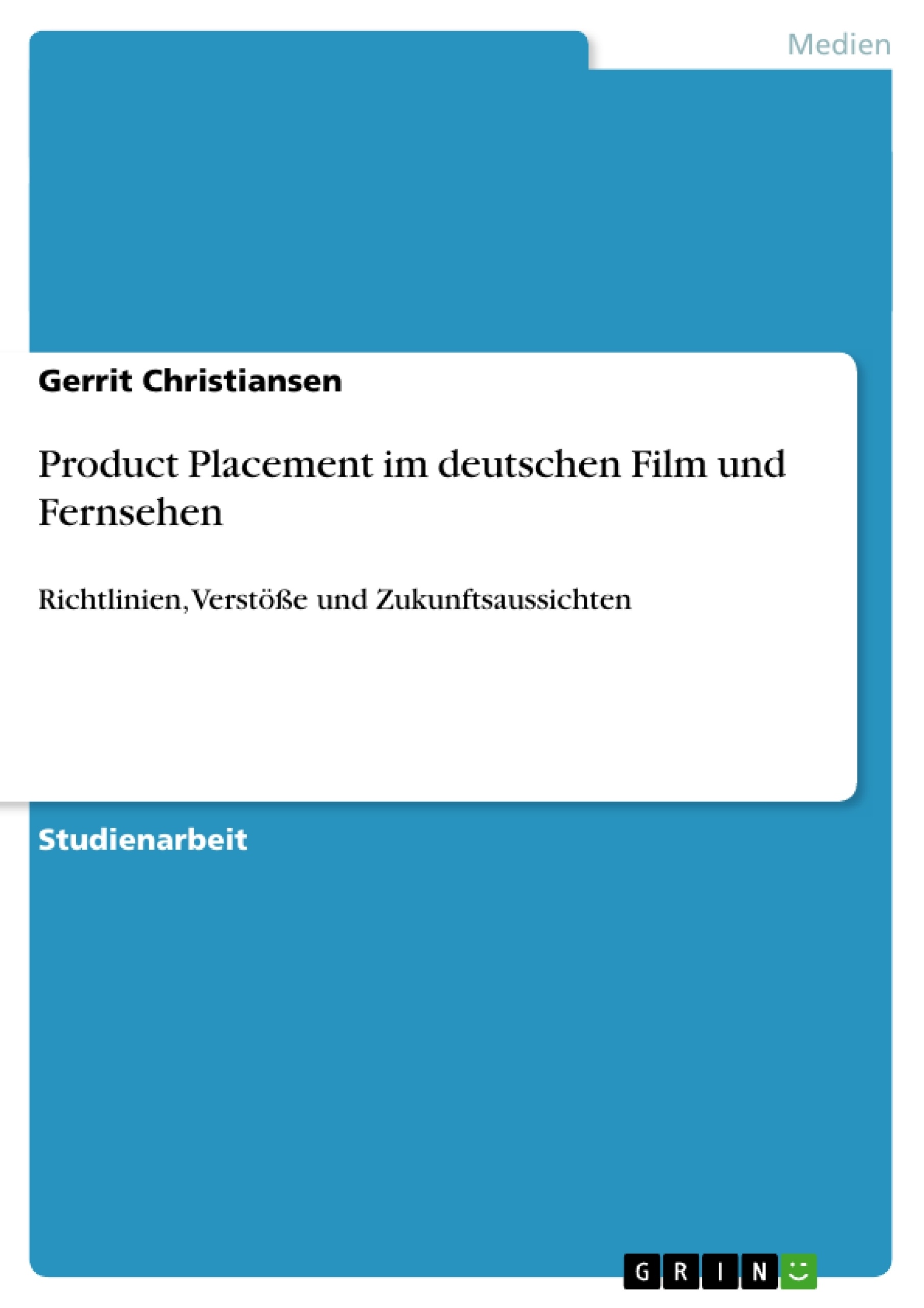Das Fernsehen steht seit vielen Jahren an der Spitze der meistgenutzten Medien in Deutschland. Zu Beginn diente es vorwiegend der Informationsverbreitung. Heute dient es dem Großteil aller deutschen Haushalte als Unterhaltungsmedium. Im Jahr 2010 sah der durchschnittliche deutsche Bürger 223 Minuten fern pro Tag. Dies sind immerhin fast vier Stunden täglich. Im vergangenen Jahr lag die Anzahl der frei empfangbaren TV- Sender, Private und Öffentlich-Rechtliche, bei 271. Diese Sender finanzieren sich bekanntlich komplett oder zu einem großen Teil über die Werbung. Diese ist grundsätzlich im Rundfunkstaatsvertrag geregelt und verlangt von privaten Fernsehanstalten, Werbung zusammenhängend zu schalten, wodurch einzelne Unterbrechungen zur Ausnahme gehören. Zwei Werbeblöcke sollen mindestens 20 Minuten auseinander liegen und dürfen die 15% Marke der kompletten Sendedauer nicht überschreiten. Die Richtlinien für Öffentlich-Rechtliche fallen etwas strenger aus. Lediglich 20 Minuten am Tag werden zugelassen. Keine Werbeschaltungen nach 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen. Diese gesetzlichen Vorschriften werden auf Grund niedriger Strafen zwar regelmäßig verletzt, motivieren die deutschen Fernsehanstalten jedoch trotzdem, neue sogenannte Sonderwerbeformen zu entwickeln. Hierzu zählt unter anderem das Product Placement (PP). Ob Effektivität oder verfassungs- und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit, kein angewandter Werbestil beschäftigte Betriebswirtschaftler und Juristen so wie PP. Und dies bereits seit Ende des zweiten Weltkriegs. 1956 erscheint der Vorläufer der Milka-Schokolade für 18 Sekunden im Heimatfilm „Und ewig rauschen die Wälder“. Das vorliegende Handout befasst sich mit dem Thema: „Product Placement im deutschen Film und Fernsehen - Richtlinien, Verstößen und Zukunftsaussichten.“ Darüber hinaus werden einige Beispiele aus der Vergangenheit für PP im Vertriebskanal Deutsches Fernsehen aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist Product Placement?
- 2.1. Definition
- 2.2. Erläuterung
- 3. Gesetzliche Richtlinien für das Product Placement in Deutschland
- 3.1. Gesetze zur Regelung der Bewerbung von Produkten und Dienstleistungen in Deutschland
- 3.2. Regelung des Product Placement in Deutschland
- 4. Geschichte und Entwicklung des Product Placement im deutschen Fernsehen
- 4.1. Verstöße in Form von Schleichwerbung
- 4.2. Bedeutung für die Film und Fernsehproduktionen
- 4.3. Zukunftsaussichten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Product Placement (PP) im deutschen Film und Fernsehen. Ziel ist es, die gesetzlichen Richtlinien, Verstöße gegen diese Richtlinien und die Zukunftsaussichten von PP zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Entwicklung von PP in Deutschland und seine Bedeutung für die Film- und Fernsehproduktion.
- Definition und Erläuterung von Product Placement
- Gesetzliche Rahmenbedingungen und Regulierung von Product Placement in Deutschland
- Entwicklung und Geschichte des Product Placement im deutschen Fernsehen
- Verstöße gegen die Richtlinien (Schleichwerbung)
- Zukunftsaussichten und Trends im Bereich Product Placement
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Product Placement im Kontext des deutschen Fernsehmarktes dar. Sie hebt die hohe Bedeutung des Fernsehens als Unterhaltungsmedium hervor und verdeutlicht, wie die Notwendigkeit neuer Werbeformen, wie Product Placement, aus der Notwendigkeit der Sender zur Finanzierung entsteht, angesichts strenger Regeln für klassische Werbeblöcke. Die Einleitung skizziert den Fokus der Arbeit auf Richtlinien, Verstöße und Zukunftsaussichten von Product Placement.
2. Was ist Product Placement?: Dieses Kapitel definiert Product Placement als die kreative Integration von Markenartikeln in Spielfilme und Fernsehsendungen, wobei die Marke für den Zuschauer klar erkennbar sein muss. Es wird erläutert, dass Product Placement ein Teil des Marketing-Mix ist, genauer der Kommunikationspolitik, und seine wesentlichen Eigenschaften – gezielte Platzierung mit werblicher Absicht, deutlich erkennbare Requisite, Integration in die Handlung und Entgeltlichkeit – werden detailliert beschrieben. Diskussionen um die Einordnung von PP als Teil des Sponsoring werden kurz angerissen.
3. Gesetzliche Richtlinien für das Product Placement in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt den rechtlichen Rahmen für Product Placement in Deutschland. Es hebt die fehlende umfassende Gesetzgebung hervor und benennt relevante Gesetze wie das UWG, den Rundfunkstaatsvertrag und das Telemediengesetz sowie Aspekte des Verbraucher- und Jugendschutzes. Es erklärt die Legalisierung von Product Placement seit dem 30.03.2010 durch den 13. Rundfunkstaatsvertrag und die Umsetzung der EU-Fernsehrichtlinie, die die Trennung von Product Placement und Schleichwerbung regelt. Die Bestimmungen zur "redaktionellen Rechtfertigung" und der Vermeidung einer "auffälligen Stellung" des Produkts im Sendungsverlauf werden detailliert dargestellt. Die Notwendigkeit der eindeutigen Kennzeichnung von Product Placement wird ebenfalls hervorgehoben.
4. Geschichte und Entwicklung des Product Placement im deutschen Fernsehen: Dieses Kapitel behandelt die historische Entwicklung des Product Placement im deutschen Fernsehen, einschließlich früherer Verstöße in Form von Schleichwerbung. Es analysiert die Bedeutung von Product Placement für Film- und Fernsehproduktionen in Bezug auf Finanzierung und kreative Gestaltung. Der Abschnitt geht auf Zukunftsaussichten ein und bewertet die zukünftige Rolle und Entwicklung von Product Placement im deutschen Fernsehmarkt unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben und der Entwicklungen im Medienkonsum.
Schlüsselwörter
Product Placement, Schleichwerbung, Rundfunkstaatsvertrag, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), Fernsehrichtlinie EU, Marketing-Mix, Kommunikationspolitik, deutsche Film- und Fernsehproduktion, Werbefinanzierung, gesetzliche Regulierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Product Placement im deutschen Film und Fernsehen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Product Placement (PP) im deutschen Film und Fernsehen. Sie beleuchtet die gesetzlichen Richtlinien, Verstöße gegen diese Richtlinien und die Zukunftsaussichten von PP. Die Arbeit analysiert die Entwicklung von PP in Deutschland und seine Bedeutung für die Film- und Fernsehproduktion.
Was sind die zentralen Themen der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf folgende Themen: Definition und Erläuterung von Product Placement, gesetzliche Rahmenbedingungen und Regulierung von Product Placement in Deutschland, Entwicklung und Geschichte des Product Placement im deutschen Fernsehen, Verstöße gegen die Richtlinien (Schleichwerbung) und Zukunftsaussichten und Trends im Bereich Product Placement.
Was wird in Kapitel 1 (Einleitung) behandelt?
Die Einleitung stellt die Relevanz von Product Placement im deutschen Fernsehmarkt dar, hebt die Bedeutung des Fernsehens als Unterhaltungsmedium hervor und erklärt, wie die Notwendigkeit neuer Werbeformen wie Product Placement aus der Finanzierungsnot der Sender entsteht. Sie skizziert den Fokus der Arbeit auf Richtlinien, Verstöße und Zukunftsaussichten von Product Placement.
Was wird in Kapitel 2 ("Was ist Product Placement?") erklärt?
Kapitel 2 definiert Product Placement als die kreative Integration von Markenartikeln in Filme und Sendungen, wobei die Marke für den Zuschauer klar erkennbar sein muss. Es erläutert PP als Teil des Marketing-Mix und beschreibt seine Eigenschaften: gezielte Platzierung, erkennbare Requisite, Integration in die Handlung und Entgeltlichkeit. Die Einordnung von PP als Teil des Sponsoring wird kurz diskutiert.
Welche gesetzlichen Richtlinien für Product Placement in Deutschland werden in Kapitel 3 behandelt?
Kapitel 3 beschreibt den rechtlichen Rahmen für Product Placement in Deutschland, die fehlende umfassende Gesetzgebung und relevante Gesetze wie UWG, Rundfunkstaatsvertrag und Telemediengesetz. Es erklärt die Legalisierung von Product Placement seit dem 30.03.2010 und die Umsetzung der EU-Fernsehrichtlinie zur Trennung von Product Placement und Schleichwerbung. Die Bestimmungen zur "redaktionellen Rechtfertigung" und der Vermeidung einer "auffälligen Stellung" des Produkts werden detailliert dargestellt, ebenso die Notwendigkeit der eindeutigen Kennzeichnung.
Was beinhaltet Kapitel 4 zur Geschichte und Entwicklung des Product Placement im deutschen Fernsehen?
Kapitel 4 behandelt die historische Entwicklung von Product Placement im deutschen Fernsehen, einschließlich früherer Verstöße als Schleichwerbung. Es analysiert die Bedeutung von Product Placement für Film- und Fernsehproduktionen hinsichtlich Finanzierung und kreativer Gestaltung und bewertet die zukünftige Rolle und Entwicklung von Product Placement unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben und Entwicklungen im Medienkonsum.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem Thema verbunden?
Schlüsselwörter sind: Product Placement, Schleichwerbung, Rundfunkstaatsvertrag, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), Fernsehrichtlinie EU, Marketing-Mix, Kommunikationspolitik, deutsche Film- und Fernsehproduktion, Werbefinanzierung, gesetzliche Regulierung.
- Quote paper
- Gerrit Christiansen (Author), 2011, Product Placement im deutschen Film und Fernsehen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165212