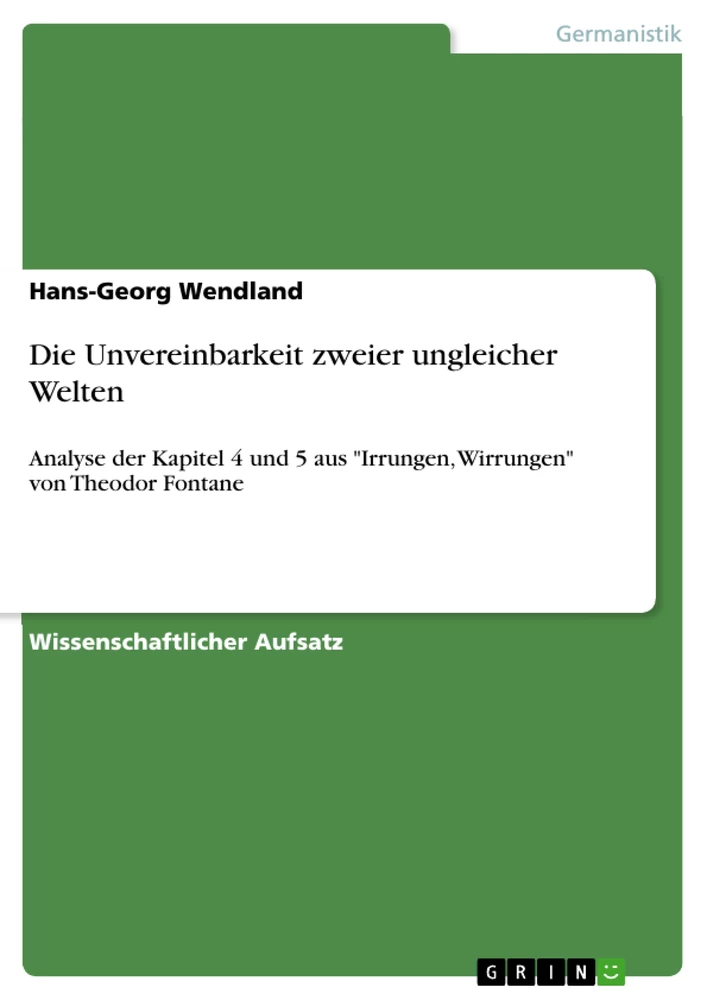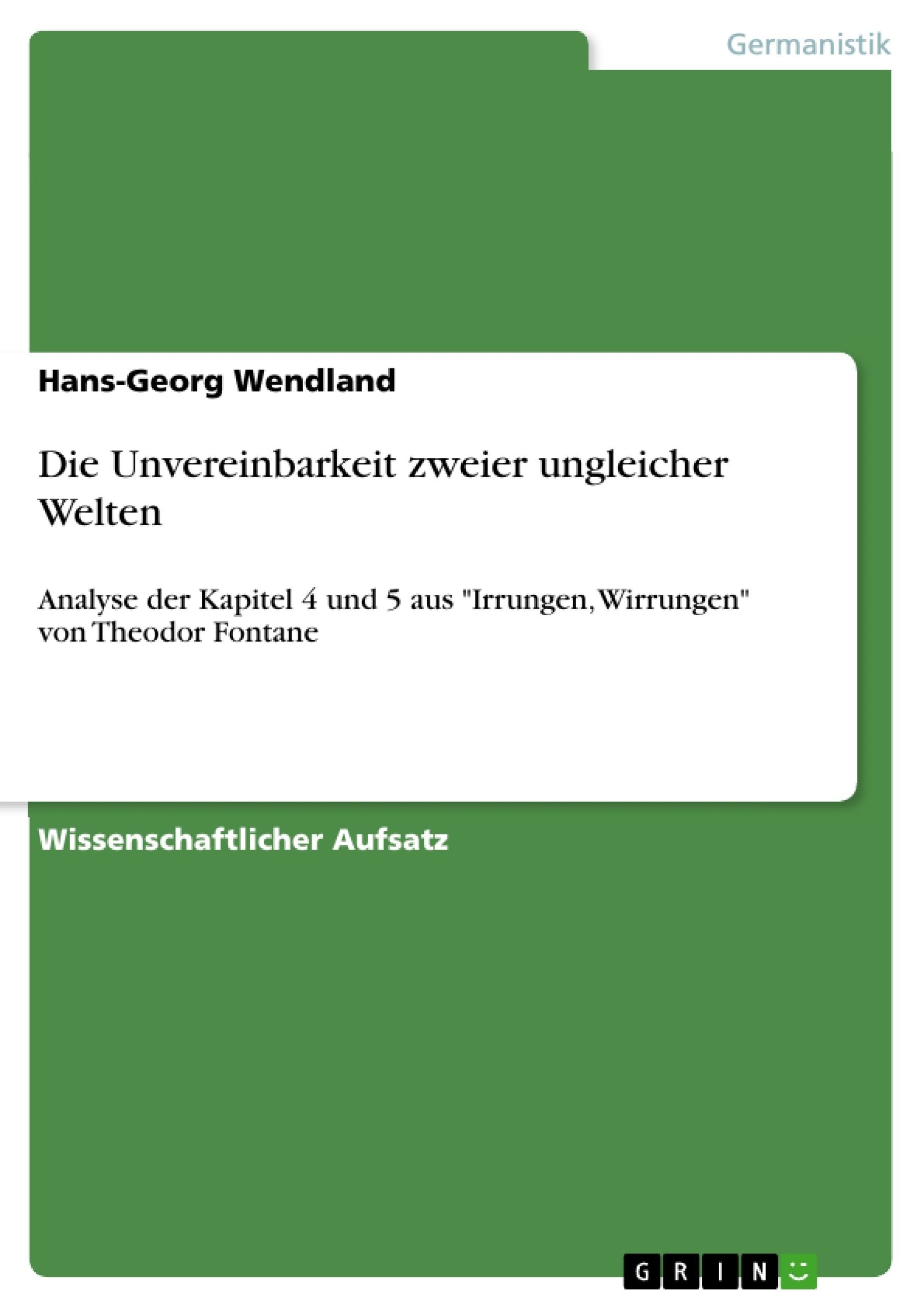In den Kapiteln 4 und 5 des Romans "Irrungen, Wirrungen" zeigt sich schon deutlich, dass Bothos und Lenes Denken und Handeln, ihr Gefühlsleben, ihre Sprechweise und damit auch ihr Verhältnis zueinander durch ihre soziale Herkunft geprägt und bestimmt werden. Ihre aufrichtige Zuneigung, die bei beiden gleich stark zu sein scheint, wird daher immer wieder gestört und durchbrochen. Unter diesem Aspekt betrachtet, kommt diesen beiden Kapiteln des Buches daher eine Schlüsselfunktion zu. Sie können auch als Vorwegnahme bzw. Vorausdeutung späterer Entwicklungen im Verhältnis von Lene und Botho aufgefasst werden, wie zwei Steine eines Mosaiks, die schon viele Komponenten des Ganzen enthalten, das sich im Laufe der Zeit vervollständigt und klarere Konturen bekommt. Dies an konkreten Beispielen aufzuzeigen, ist ein Anliegen dieser Arbeit.
In Kapitel 4 tritt Botho zum ersten Mal als handelnde Figur in Lenes häuslicher Umgebung auf. Er verhält sich nicht – wie man erwarten könnte – als höflicher Besucher, der sich mit der für ihn neuen kleinbürgerlichen Welt vertraut machen will, sondern greift aktiv gestaltend und bestimmend in den Verlauf der Handlung ein. Im darauffolgenden Kapitel 5 bekommt der Leser erste Eindrücke davon, wie sich Botho und Lene verhalten, wenn sie allein sind. Auch hier scheint Botho derjenige zu sein, der die Thematik und die Richtung des Gespräch entscheidend bestimmt. Diese scheinbare Dominanz hält jedoch keiner kritischen Überprüfung stand. Bei genauerem Hinsehen erweist sich seine „Überlegenheit“ als Anmaßung, als bloßer Schein und reine Rhetorik, die von Lene erkannt, richtig gedeutet und wiederholt zurückgewiesen wird. Lene bezieht in ihren Äußerungen klare Positionen und erweist sich ihm zumindest ebenbürtig, in den entscheidenden Punkten sogar überlegen.
INHALTSVERZEICHNIS
I. Einleitung
II. Kapitel 4: Die missglückte Verständigung (Botho in Lenes Welt)
III. Kapitel 5: Die missglückte Liebe (Botho und Lene)
IV. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick
Benutzte Literatur
I. Einleitung
In den Kapiteln 4 und 5 des Romans "Irrungen, Wirrungen" zeigt sich schon deutlich, dass Bothos und Lenes Denken und Handeln, ihr Gefühlsleben, ihre Sprechweise und damit auch ihr Verhältnis zueinander durch ihre soziale Herkunft geprägt und bestimmt werden. Ihre aufrichtige Zuneigung, die bei beiden gleich stark zu sein scheint, wird daher immer wieder gestört und durchbrochen. Unter diesem Aspekt betrachtet, kommt diesen beiden Kapiteln des Buches daher eine Schlüsselfunktion zu. Sie können auch als Vorwegnahme bzw. Vorausdeutung späterer Entwicklungen im Verhältnis von Lene und Botho aufgefasst werden, wie zwei Steine eines Mosaiks, die schon viele Komponenten des Ganzen enthalten, das sich im Laufe der Zeit vervollständigt und klarere Konturen bekommt. Dies an konkreten Beispielen aufzuzeigen, ist ein Anliegen dieser Arbeit.
In Kapitel 4 tritt Botho zum ersten Mal als handelnde Figur in Lenes häuslicher Umgebung auf. Er verhält sich nicht – wie man erwarten könnte – als höflicher Besucher, der sich mit der für ihn neuen kleinbürgerlichen Welt vertraut machen will, sondern greift aktiv gestaltend und bestimmend in den Verlauf der Handlung ein. Im darauffolgenden Kapitel 5 bekommt der Leser erste Eindrücke davon, wie sich Botho und Lene verhalten, wenn sie allein sind. Auch hier scheint Botho derjenige zu sein, der die Thematik und die Richtung des Gespräch entscheidend bestimmt. Diese scheinbare Dominanz hält jedoch keiner kritischen Überprüfung stand. Bei genauerem Hinsehen erweist sich seine „Überlegenheit“ als Anmaßung, als bloßer Schein und reine Rhetorik, die von Lene erkannt, richtig gedeutet und wiederholt zurückgewiesen wird. Lene bezieht in ihren Äußerungen klare Positionen und erweist sich ihm zumindest ebenbürtig, in den entscheidenden Punkten sogar überlegen.
II. Kapitel 4: Die missglückte Verständigung (Botho in Lenes Welt)
Bei Bothos Auftritt in Kapitel 4 ist nicht zu übersehen, dass er aus einer anderen Welt kommt: In seiner Welt arbeitet man nicht, sondern vertreibt sich die Zeit mit Annehmlichkeiten, die das Leben verschönern. Man pflegt die Geselligkeit, z. B. im Club, erfreut sich am Spiel, schließt Wetten ab, genießt dazu anregende Getränke und hat seinen Spaß dabei. Aber man achtet
auf die Form, d. h. man betrinkt sich nicht, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, sondern ist, wie Botho hier, allenfalls „angeheitert“ (21) (Hier wie in allen weiteren Zitaten aus „Irrungen,Wirrungen“ werden die Seitenzahlen jeweils in Klammern angegeben.)
Botho gibt sich zunächst bescheiden, leutselig und jovial. Er beansprucht keinen „Ehrenplatz“ (21), will niemanden verdrängen und vermeidet elitäre Verhaltensweisen. Vordergründig versucht er, sich in die kleinbürgerliche Umgebung seiner Gastgeber einzufügen, indem er an ihre Denk- und Verhaltensweisen anknüpft, die von nützlichen Tätigkeiten bestimmt werden. Er spricht zum Beispiel vom Wetter, weil ihm klar ist, dass es einen wichtigen Faktor im Leben eines Gemüsegärtners darstellt. Das Universalthema Wetter spielt auch in seiner Welt eine wichtige Rolle, allerdings überwiegend im Freizeitbereich, wenn es um Ausritte zu Pferde und Geselligkeiten im Freien geht. Alls Angehöriger des Adels sind der sportliche Umgang mit Pferden und die Pferdezucht ihm natürlich vertrauter als Obst- und Gemüseanbau. Hier und auch im weiteren Verlauf des Gesprächs zeigt sich, dass Botho als Vertreter seines Standes Universalbegriffe in einer ganz anderen Richtung ausdeutet als ein Angehöriger des Kleinbürgertums. Dem Leser wird klar, dass in Bothos Welt Maßstäbe gelten, die nicht vergleichbar sind mit den Normen der kleinbürgerlichen Welt, d. h. dass die Grundstrukturen seines Denkens und Verhaltens sich fundamental von denen seiner Gastgeber unterscheiden.
As Botho sich neben die alte Frau Nimptsch setzt, reagiert sie verlegen. Er versucht ihr zu schmeicheln und ihren sozialen Status aufzuwerten, ihm Glanz und Bedeutung zu verleihen, indem er auf einen „berühmten Dichter“ hinweist, „der ein Gedicht auf seine alte Waschfrau gemacht hat“ (22). Dieses Verhalten wirkt aufgesetzt und unaufrichtig und wird von Frau Nimptsch mit Befremden und Ungläubigkeit aufgenommen: „Ist es möglich?“ (22). Es mag möglich sein, aber es ändert nichts am Status und am Selbstverständnis einer Wasch- und Plättefrau. Doch Botho insistiert nicht nur, er versteigt sich sogar zu der Behauptung, seine Gastgeber lebten „wie Gott in Frankreich“, eine Floskel, die in manchen Kreisen seiner Welt angebracht sein mag. Hier wirkt sie anmaßend und deplatziert. Sie offenbart, dass Botho – gewollt oder ungewollt – Denk- und Sprachschemata aus seiner Welt in Lenes Welt transportiert, wo sie unpassend sind und nicht verstanden werden. 1)
Obwohl Botho jede Bevorzugung ablehnt und Gleicher unter Gleichen sein will, dringen diese durch seine soziale Herkunft geprägten Schemata immer wieder durch, und zwar bis an die Grenze der Takt- und Geschmacklosigkeit. Das ist zum Beispiel der Fall, als er von einer „großen Herren- und Damenfête“ (23) - auch die Wortstellung spricht Bände! – ein Mitbringsel
in Gestalt eines Knallbonbons präsentiert. Der kitschige Vers im Inneren verstärkt die Peinlichkeit der Situation, ohne dass Botho es zu merken scheint. Lene ist im wörtlichen Sinne getroffen („Lenes Zeigefinger blutete“, 23), ein äußerer Ausdruck ihrer offensichtlichen inneren Verletzung. Das Zerplatzen des Knallbonbons kann man als Vorausdeutung auf ihren zerplatzenden Traum von ihrer Liebe zu Botho auffassen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über "Irrungen, Wirrungen"?
Dieser Text ist eine Analyse der Kapitel 4 und 5 des Romans "Irrungen, Wirrungen" von Theodor Fontane. Er untersucht, wie die soziale Herkunft von Botho und Lene ihr Denken, Handeln und ihre Beziehung zueinander beeinflusst. Insbesondere wird untersucht, wie ihre Zuneigung durch soziale Unterschiede gestört wird.
Was ist das Hauptthema der Einleitung?
Die Einleitung betont, dass Bothos und Lenes Verhalten und Gefühle durch ihre unterschiedliche soziale Herkunft geprägt sind. Die Kapitel 4 und 5 werden als Schlüsselszenen betrachtet, die spätere Entwicklungen in ihrer Beziehung vorwegnehmen.
Was wird in Kapitel 4 analysiert?
In Kapitel 4 wird Bothos Verhalten in Lenes häuslicher Umgebung analysiert. Er tritt nicht als höflicher Gast auf, sondern greift aktiv in die Handlung ein. Dabei werden die Unterschiede zwischen seiner adligen Welt und Lenes kleinbürgerlicher Welt deutlich.
Wie wird Bothos Verhalten in Lenes Welt beschrieben?
Botho versucht zunächst, sich bescheiden und jovial zu geben, aber seine durch den Adel geprägten Denk- und Sprachmuster dringen immer wieder durch. Er verwendet Floskeln und Verhaltensweisen, die in Lenes Welt unpassend und unverstanden wirken.
Welche Bedeutung hat der Knallbonbon in Kapitel 4?
Der Knallbonbon, den Botho von einer "großen Herren- und Damenfête" mitbringt, wird als Beispiel für seine Taktlosigkeit und mangelndes Verständnis für Lenes Welt interpretiert. Lenes Verletzung beim Zerplatzen des Knallbonbons wird als Vorausdeutung auf ihren zerplatzenden Liebestraum gesehen.
Was wird über die Rolle von Frau Nimptsch gesagt?
Bothos Versuch, Frau Nimptsch mit Verweisen auf einen Dichter und seine Waschfrau zu schmeicheln, wird als aufgesetzt und unaufrichtig dargestellt. Es wird betont, dass diese Schmeicheleien nichts an ihrem sozialen Status und Selbstverständnis ändern.
Welche Schlussfolgerung wird über Bothos Dominanz gezogen?
Obwohl Botho scheinbar die Gespräche und Themen bestimmt, wird seine "Überlegenheit" als Anmaßung entlarvt. Lene wird als mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen, in ihren Äußerungen und Positionen dargestellt.
Welche Bedeutung hat das Wetter im Gespräch?
Das Thema Wetter dient als Beispiel, um zu zeigen, wie Universalbegriffe von Botho und Lenes Familie unterschiedlich interpretiert werden. Für Botho ist es eher ein Freizeitfaktor, während es für die Gärtnerfamilie von existenzieller Bedeutung ist.
Was bedeutet die Fußnote im Text?
Die Fußnote zitiert Müller-Seidel und erklärt, dass die Hervorhebung des Standes für Angehörige des Adels oft nur der "Verschönerung" des Daseins dient und Statussymbole betont werden, die nicht lebensnotwendig sind.
- Quote paper
- Hans-Georg Wendland (Author), 2010, Die Unvereinbarkeit zweier ungleicher Welten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165107