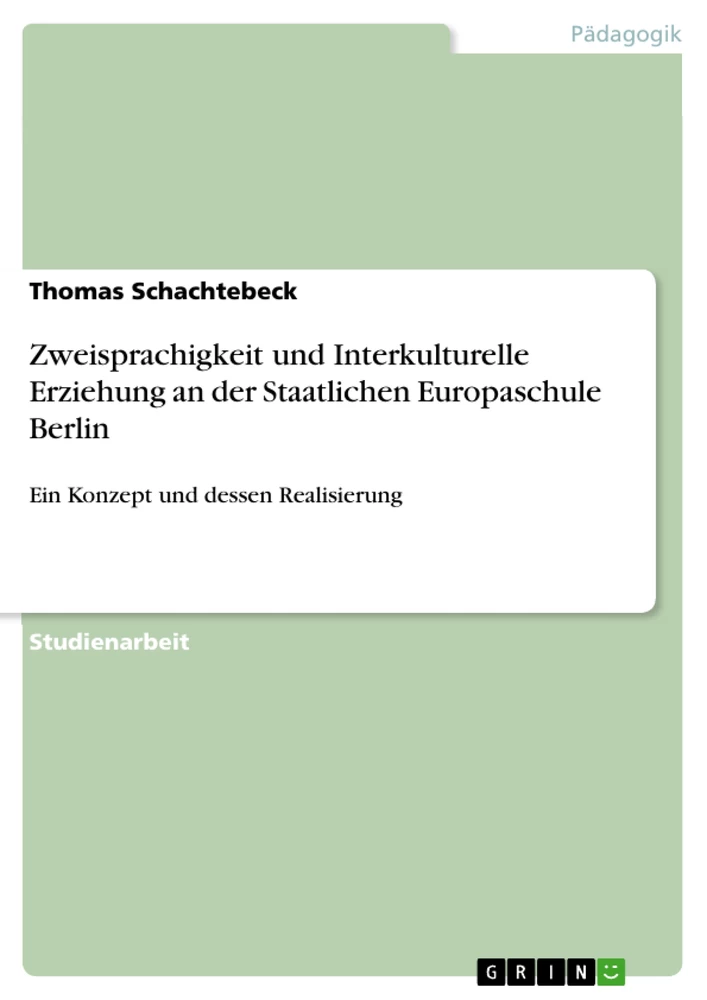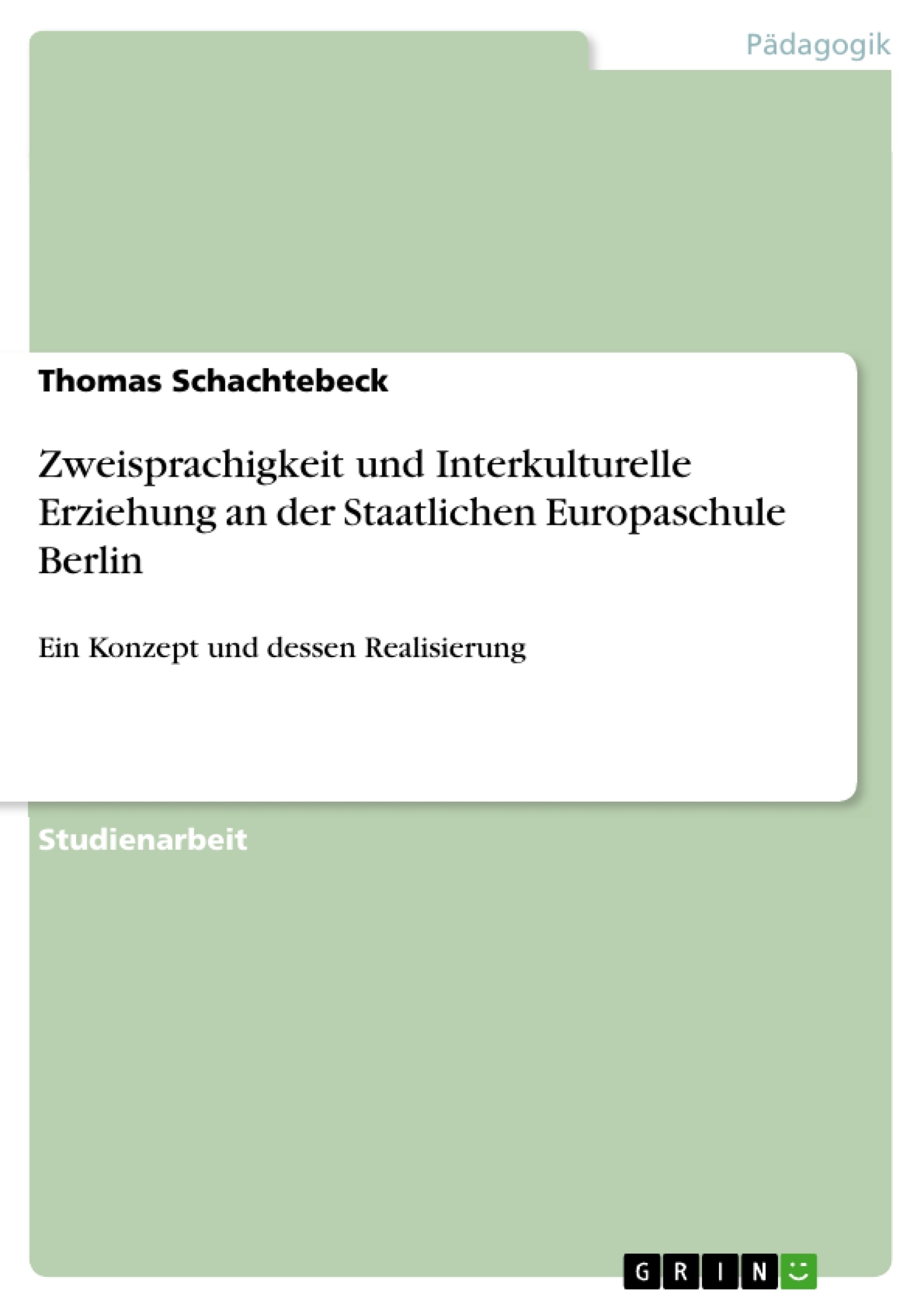Ein Leben im heutigen, vereinten Europa des 21. Jahrhunderts erfordert insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft und das stetige Anwachsen der EU von ursprünglich sechs auf mittlerweile 25 Mitgliedsstaaten die Fähigkeit der Bürger Europas, sich trotz unterschiedlicher Sprachzugehörigkeiten untereinander verständigen zu können. [...] Vor dem Hintergrund, dass „sich Deutschland zum Einwanderungsland entwickelt hat“ und eines der führenden Industrieländer Europas ist, werden in der Bundesrepublik gerade der Mehrsprachigkeit und der interkulturellen Kompetenz der Jugend besondere Bedeutung beigemessen, um den Ansprüchen eines vereinten und modernen Europas gerecht zu werden. Ausdruck dessen war der Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) von 1990 zur „Förderung der Europäischen Dimension“ durch das Schulwesen. Aus dieser Entscheidung der KMK ergaben sich diverse Unterrichtsversuchsmodelle im Grundschulwesen – eines davon ist das Modell der Staatlichen Europaschule Berlin (SESB). Das Konzept der SESB verfolgt einen Partnersprachenunterricht, bei dem alle Unterrichtsfächer in Deutsch und in einer weiteren Partnersprache wie z.B. Englisch gleichrangig verteilt unterrichtet werden. Die Schülerschaft setzt sich dabei im Idealfall zu 50% aus deutschen Muttersprachlern und zu 50% aus Muttersprachlern der Partnersprache des jeweiligen SESB Standortes zusammen. Ziel dieses Konzeptes der SESB ist es, die Schüler zur Mehrsprachigkeit zu erziehen und Toleranz sowie ein friedliches Zusammenleben in einem zusammenwachsenden Europa zu gewährleisten (vgl. Doye, P. 1996, S. 105).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Überblick über die Entwicklung der SESB
- 2.1 Die Gründungsgeschichte der SESB
- 2.2 Die SESB heute und ihre allgemeinen Rahmenbedingungen
- 3 Die Realisierung von Zweisprachigkeit und Interkultureller Erziehung im Grundschulunterricht an der Europaschule
- 3.1 Allgemeine Fächeraufteilung
- 3.2 Lernen in zwei Sprachen mit dem Ziel der Mehrsprachigkeit
- 3.3 Gemischte Kulturen mit dem Ziel der Interkulturellen Erziehung
- 4 Von der Regelschule zur SESB: Ein Sichtwechsel in der bilingualen Erziehung
- 4.1 Der allgemeine Unterschied im Ansatz
- 4.2 Was bedeutet der Sichtwechsel für die Schüler?
- 4.3 Was bedeutet der Sichtwechsel für die Lehrer?
- 4.4 Was bedeutet der Sichtwechsel für die Eltern?
- 5 Probleme und Grenzen des Zweisprachigen Unterrichts am Beispiel der deutsch-italienischen Finow-Grundschule in Berlin-Schöneberg
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Konzept und die Umsetzung der Staatlichen Europaschule Berlin (SESB) als Modell für zweisprachigen und interkulturellen Unterricht. Das Ziel ist es, die Entwicklung, den aktuellen Stand und die Herausforderungen des SESB-Konzepts zu beleuchten.
- Entwicklung und Geschichte der SESB
- Realisierung von Zweisprachigkeit und interkultureller Erziehung im Unterricht
- Vergleich zwischen dem Ansatz der Regelschule und der SESB
- Herausforderungen und Probleme des zweisprachigen Unterrichts
- Rahmenbedingungen und Organisation der SESB
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und interkultureller Kompetenz im vereinten Europa, besonders angesichts der Globalisierung und der wachsenden kulturellen Vielfalt. Sie führt das Konzept der SESB als Antwort auf diese Herausforderungen ein und hebt die Bedeutung von Toleranz und Akzeptanz verschiedener Kulturen hervor. Anhand von Beispielen werden die potenziellen Konflikte durch kulturelle Unterschiede illustriert und die Notwendigkeit von interkultureller Kompetenz verdeutlicht. Der Beschluss der Kultusministerkonferenz von 1990 zur „Förderung der Europäischen Dimension“ wird als Kontext für die Entstehung der SESB genannt. Das Modell der SESB, mit seinem partnersprachlichen Unterricht, wird als ein Versuch vorgestellt, Mehrsprachigkeit und interkulturelles Verständnis zu fördern.
2. Überblick über die Entwicklung der SESB: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehungsgeschichte der SESB, beginnend mit ihrer Gründung als Reaktion auf den Abzug alliierter Truppen aus Berlin und dem Wunsch, die sprachliche und kulturelle Vielfalt zu erhalten. Es wird der Unterschied zwischen dem SESB-Ansatz und dem der Regelschule hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet die anfängliche Fokussierung auf Sprachen der ehemaligen Besatzungsmächte und die spätere Integration von Migrantensprachen als Reaktion auf die Forderungen von Eltern. Die Erweiterung des Angebots an Partnersprachen und die Entwicklung des SESB-Konzepts bis zu seinem heutigen Stand mit neun verschiedenen Sprachkombinationen werden detailliert dargestellt.
3 Die Realisierung von Zweisprachigkeit und Interkultureller Erziehung im Grundschulunterricht an der Europaschule: Dieses Kapitel befasst sich mit der konkreten Umsetzung der Zweisprachigkeit und interkulturellen Erziehung im Unterricht der SESB. Es beschreibt die Fächeraufteilung, die Methoden des zweisprachigen Lernens mit dem Ziel der Mehrsprachigkeit, und die Ansätze zur Förderung des interkulturellen Verständnisses. Die Kapitelteile beleuchten, wie die Schule die sprachliche und kulturelle Vielfalt aktiv im Schulalltag integriert, und diskutieren wahrscheinlich die didaktischen und methodischen Ansätze, um dieses Ziel zu erreichen.
4 Von der Regelschule zur SESB: Ein Sichtwechsel in der bilingualen Erziehung: Dieser Abschnitt vergleicht den Ansatz der Regelschule mit dem der SESB und analysiert die Auswirkungen dieses „Sichtwechsels“ auf Schüler, Lehrer und Eltern. Die Unterschiede in der Pädagogik und im didaktischen Ansatz zwischen beiden Schulformen werden im Detail untersucht. Es wird wahrscheinlich untersucht, welche Herausforderungen und Chancen sich für die verschiedenen Akteure ergeben und wie sich die veränderte Perspektive auf den Bildungsprozess auswirkt.
5 Probleme und Grenzen des Zweisprachigen Unterrichts am Beispiel der deutsch-italienischen Finow-Grundschule in Berlin-Schöneberg: Dieses Kapitel analysiert die Herausforderungen und Grenzen des zweisprachigen Unterrichts an einem konkreten Beispiel, der deutsch-italienischen Finow-Grundschule. Es werden wahrscheinlich konkrete Probleme und Schwierigkeiten des zweisprachigen Unterrichts beleuchtet, sowie die möglichen Ursachen und Lösungsansätze diskutiert. Der Fokus liegt auf den realen Schwierigkeiten und Limitationen bei der Umsetzung des Modells.
Schlüsselwörter
Staatliche Europaschule Berlin (SESB), Zweisprachigkeit, Interkulturelle Erziehung, Bilingualer Unterricht, Mehrsprachigkeit, Partnersprachen, Integrationsmodell, Globalisierung, Migrantensprachen, Konfliktfähigkeit, Toleranz, Weltoffenheit, interkulturelle Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Staatlichen Europaschule Berlin (SESB)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Konzept und die Umsetzung der Staatlichen Europaschule Berlin (SESB) als Modell für zweisprachigen und interkulturellen Unterricht. Sie beleuchtet die Entwicklung, den aktuellen Stand und die Herausforderungen des SESB-Konzepts.
Was sind die Ziele der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung, den aktuellen Stand und die Herausforderungen des SESB-Konzepts zu beleuchten. Dabei werden die Realisierung von Zweisprachigkeit und interkultureller Erziehung im Unterricht, ein Vergleich mit dem Ansatz der Regelschule und die Herausforderungen des zweisprachigen Unterrichts untersucht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Entwicklung und Geschichte der SESB, die Realisierung von Zweisprachigkeit und interkultureller Erziehung im Unterricht, den Vergleich zwischen dem Ansatz der Regelschule und der SESB, Herausforderungen und Probleme des zweisprachigen Unterrichts sowie die Rahmenbedingungen und Organisation der SESB.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Überblick über die Entwicklung der SESB, Realisierung von Zweisprachigkeit und interkultureller Erziehung im Grundschulunterricht an der Europaschule, Vergleich Regelschule vs. SESB, Probleme und Grenzen des zweisprachigen Unterrichts am Beispiel der deutsch-italienischen Finow-Grundschule in Berlin-Schöneberg und Fazit.
Was wird in der Einleitung besprochen?
Die Einleitung betont die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und interkultureller Kompetenz im vereinten Europa und führt das Konzept der SESB als Antwort auf diese Herausforderungen ein. Sie hebt die Bedeutung von Toleranz und Akzeptanz verschiedener Kulturen hervor und nennt den Beschluss der Kultusministerkonferenz von 1990 zur „Förderung der Europäischen Dimension“ als Kontext.
Was ist der Inhalt des Kapitels über die Entwicklung der SESB?
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehungsgeschichte der SESB, beginnend mit ihrer Gründung als Reaktion auf den Abzug alliierter Truppen aus Berlin. Es wird der Unterschied zwischen dem SESB-Ansatz und dem der Regelschule hervorgehoben, die anfängliche Fokussierung auf Sprachen der ehemaligen Besatzungsmächte und die spätere Integration von Migrantensprachen dargestellt.
Wie wird Zweisprachigkeit und interkulturelle Erziehung an der SESB umgesetzt?
Kapitel 3 befasst sich mit der konkreten Umsetzung von Zweisprachigkeit und interkultureller Erziehung. Es beschreibt die Fächeraufteilung, Methoden des zweisprachigen Lernens und Ansätze zur Förderung des interkulturellen Verständnisses. Es wird die Integration der sprachlichen und kulturellen Vielfalt im Schulalltag beleuchtet.
Wie unterscheidet sich der Ansatz der SESB von dem der Regelschule?
Kapitel 4 vergleicht den Ansatz der Regelschule mit dem der SESB und analysiert die Auswirkungen dieses „Sichtwechsels“ auf Schüler, Lehrer und Eltern. Die Unterschiede in der Pädagogik und im didaktischen Ansatz werden untersucht, sowie Herausforderungen und Chancen für die verschiedenen Akteure.
Welche Probleme und Grenzen des zweisprachigen Unterrichts werden behandelt?
Kapitel 5 analysiert Herausforderungen und Grenzen des zweisprachigen Unterrichts am Beispiel der deutsch-italienischen Finow-Grundschule in Berlin-Schöneberg. Konkrete Probleme und Schwierigkeiten, mögliche Ursachen und Lösungsansätze werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Staatliche Europaschule Berlin (SESB), Zweisprachigkeit, Interkulturelle Erziehung, Bilingualer Unterricht, Mehrsprachigkeit, Partnersprachen, Integrationsmodell, Globalisierung, Migrantensprachen, Konfliktfähigkeit, Toleranz, Weltoffenheit, interkulturelle Kompetenz.
- Quote paper
- Master of Education Thomas Schachtebeck (Author), 2005, Zweisprachigkeit und Interkulturelle Erziehung an der Staatlichen Europaschule Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/165042