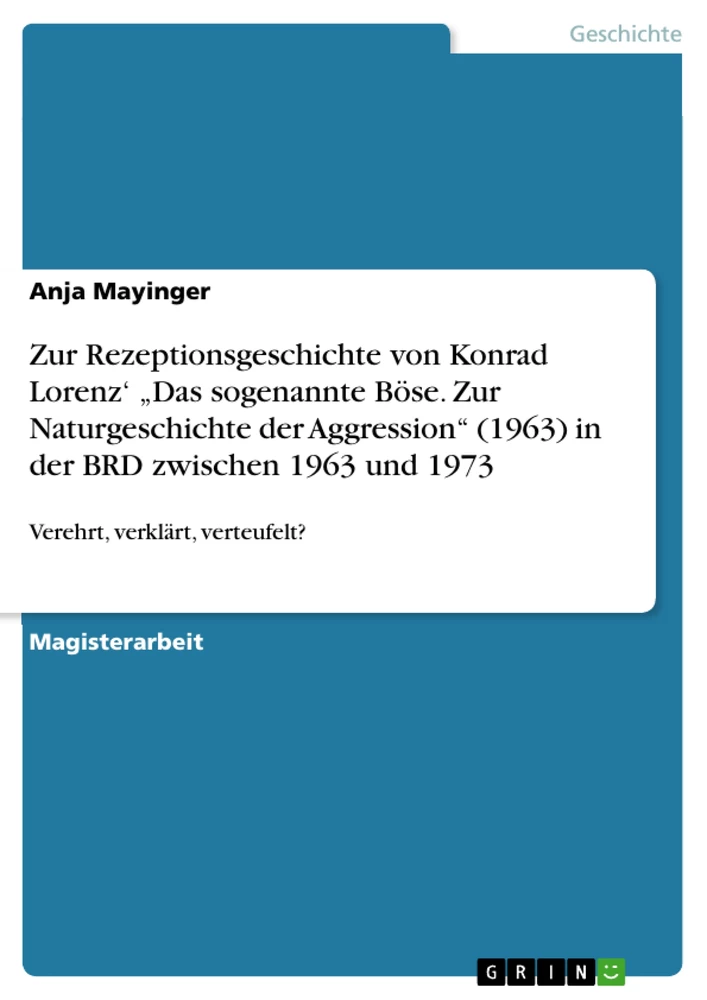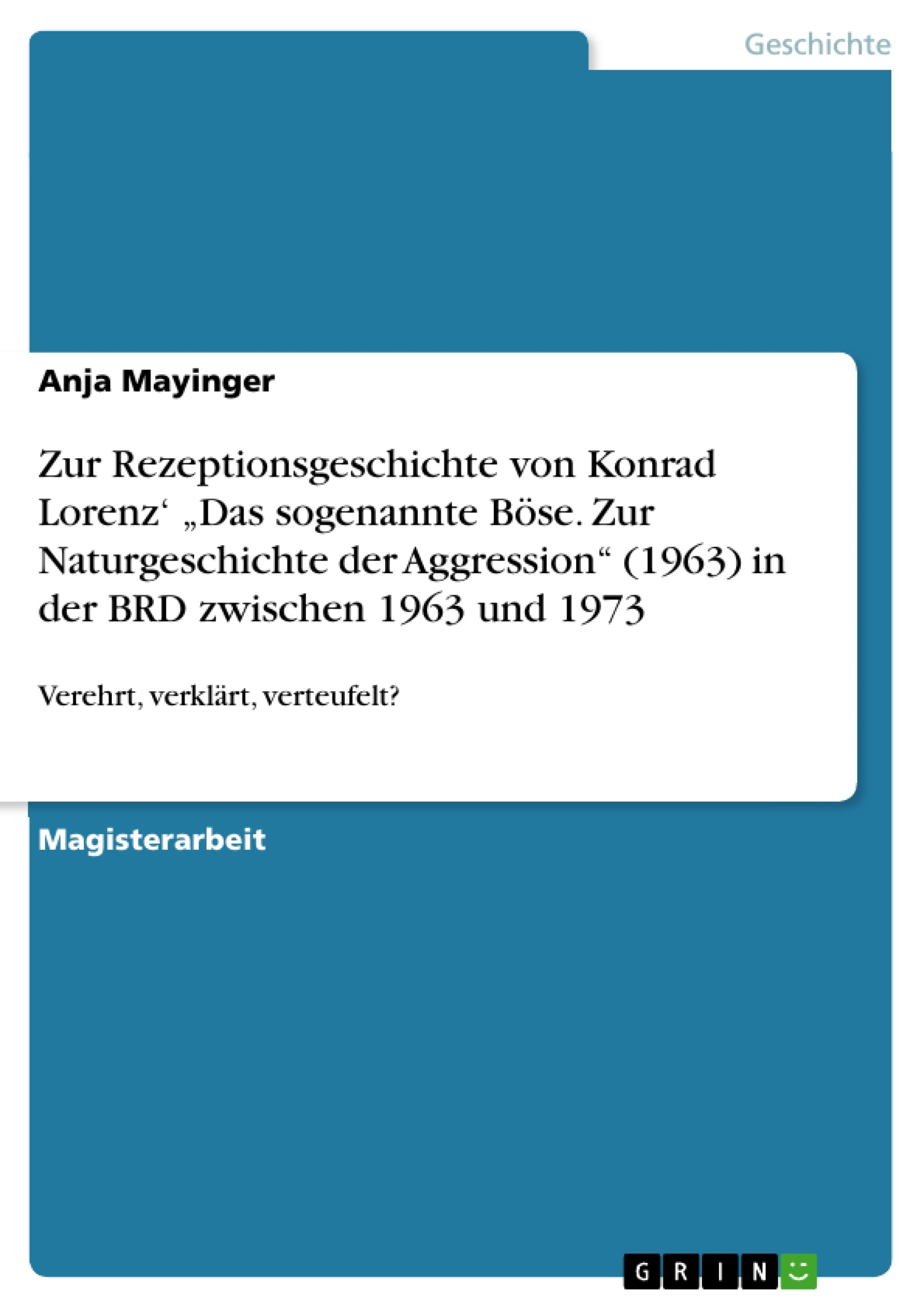Das mechanistisches Konzept vom Menschen als Dampfkessel, der regelmäßig ein „Ventil“ braucht, um „Dampf abzulassen“, weil „sich Wut aufgestaut“ hat, ist ein fester Bestandteil der Alltagssprache. Das Instinkt-Modell der Aggression des Verhaltensforschers Konrad Lorenz scheint sich als Teil des allgemeinen Weltbildes etabliert zu haben.
Das Populärwissenschaftliche Buch „Das sogenannte Böse“ (1963), in dem Lorenz sein Konzept vom Aggressionstrieb vorlegte, wurde in den Jahren nach seinem Erscheinen stark beachtet, rege besprochen und gleichermaßen gelobt wie kritisiert. Die Frage nach den Gründen für den Erfolg des Buches wurde bisher noch nicht gestellt. Einen ersten Schritt zur Erforschung der ideengeschichtlichen Voraussetzungen und Folgen der Lorenz’schen Aggressionstheorie in den 1960er- und 1970er-Jahren in der Bundesrepublik Deutschland möchte nun diese Arbeit gehen. Dabei stützt sie sich vorwiegend auf Quellen der wissenschaftlichen Rezeption des Buches. Daneben werden auch exemplarische Buchbesprechungen der allgemeinen Publizistik ausgewertet. Um die Rezeption des „Sogenannten Bösen“ kulturgeschichtlich einordnen zu können, werden auch die geistesgeschichtlichen Rahmenbedingungen der Phase 1963 bis 1973 erläutert: die global-politischen Hauptmerkmale, die Positionen der Anlage-Umwelt-Debatte, biografische Informationen über den Autor und die Kernaussagen seines Buches sowie die Entstehungsgeschichte der Verhaltensforschung.
Das Hauptziel dieser Arbeit liegt zwar in der Darstellung und Zusammenschau der Rezensionen aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen: vornehmlich aus den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Naturwissenschaft. Jedoch ermöglichten die Quellen eine Analyse der mehrdimensionalen Funktionen, die das Buch zu erfüllen in der Lage war: als interdisziplinärer Angriff der Biologie auf die Psychologie, als Ausdruck einer anti-aufklärerischen Tendenz zur Substitution einer Gottesvorstellung durch Wissenschaftsgläubigkeit, als naturwissenschaftlicher Erklärungsansatz sowohl für die NS-Verbrechen als auch für die feindliche Blockbildung im Kalten Krieg sowie als ideologisches Kampfmittel gegen den Kommunismus.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konrad Lorenz und die Rezeption seiner Aggressionstheorie
- Das „kollektive Unbewusste“ und der Erfolg von „Das sogenannte Böse“
- Die Rezeption von „Das sogenannte Böse“ in der BRD
- Die Entstehung der Aggressionstheorie
- Die biologische Grundlage der Aggression
- Die Ethologie und die Evolution des Verhaltens
- Die Rezeption der Aggressionstheorie in der BRD
- Die Rezeption in der Psychologie
- Die Rezeption in der Soziologie
- Die Rezeption in der Biologie
- Kritik an der Aggressionstheorie
- Die Kritik an der biologischen Grundlage der Aggression
- Die Kritik an der Ethologie
- Die Kritik an der Evolutionstheorie
- Die Rezeption von „Das sogenannte Böse“ in der Gegenwart
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeptionsgeschichte von Konrad Lorenz' Buch „Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression“ (1963) in der BRD zwischen 1963 und 1973. Sie analysiert die Rezeption des Buches in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere in der Psychologie, Soziologie und Biologie. Darüber hinaus wird die Kritik an Lorenz' Aggressionstheorie untersucht.
- Die Rezeption von „Das sogenannte Böse“ in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen
- Die Kritik an Lorenz' Aggressionstheorie
- Die ideengeschichtlichen Voraussetzungen und Folgen der Lorenz'schen Aggressionstheorie
- Die Rolle des „kollektiven Unbewussten“ in der Rezeption des Buches
- Die Bedeutung von „Das sogenannte Böse“ für die heutige Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Forschungsstand dar. Sie erläutert die Bedeutung des Buches „Das sogenannte Böse“ für die heutige Gesellschaft und die Notwendigkeit der Untersuchung seiner Rezeptionsgeschichte.
Kapitel 2 beleuchtet die Entstehung der Aggressionstheorie von Konrad Lorenz und ihre wissenschaftlichen Grundlagen. Es werden die wichtigsten Elemente der Theorie dargestellt und ihre Rezeption in der BRD analysiert.
Kapitel 3 untersucht die Rezeption von „Das sogenannte Böse“ in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Die Analyse der Rezeption in der Psychologie, Soziologie und Biologie zeigt die unterschiedlichen Perspektiven auf die Lorenz'sche Aggressionstheorie auf.
Kapitel 4 widmet sich der Kritik an Lorenz' Aggressionstheorie. Es werden die wichtigsten Kritikpunkte dargestellt und die Debatte um die wissenschaftliche Gültigkeit der Theorie beleuchtet.
Kapitel 5 untersucht die ideengeschichtlichen Voraussetzungen und Folgen der Lorenz'schen Aggressionstheorie. Es wird untersucht, wie die Theorie in den gesellschaftlichen Diskurs der 1960er- und 1970er-Jahre eingebettet war und welche Auswirkungen sie auf die heutige Gesellschaft hat.
Kapitel 6 analysiert die Rolle des „kollektiven Unbewussten“ in der Rezeption von „Das sogenannte Böse“. Es wird untersucht, wie die Theorie in das kollektive Bewusstsein der Gesellschaft eingegangen ist und welche Bedeutung sie für die heutige Zeit hat.
Das Kapitel 7 beleuchtet die Bedeutung von „Das sogenannte Böse“ für die heutige Gesellschaft. Es werden die aktuellen Debatten um die Lorenz'sche Aggressionstheorie dargestellt und ihre Relevanz für die heutige Zeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Konrad Lorenz, Aggression, Ethologie, Evolution, Instinkt, „Das sogenannte Böse“, Rezeptionsgeschichte, BRD, Psychologie, Soziologie, Biologie, Kritik, „kollektives Unbewusstes“, wissenschaftlicher Diskurs, gesellschaftlicher Diskurs, 1960er-Jahre, 1970er-Jahre.
- Quote paper
- Anja Mayinger (Author), 2010, Zur Rezeptionsgeschichte von Konrad Lorenz‘ „Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression“ (1963) in der BRD zwischen 1963 und 1973, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164836