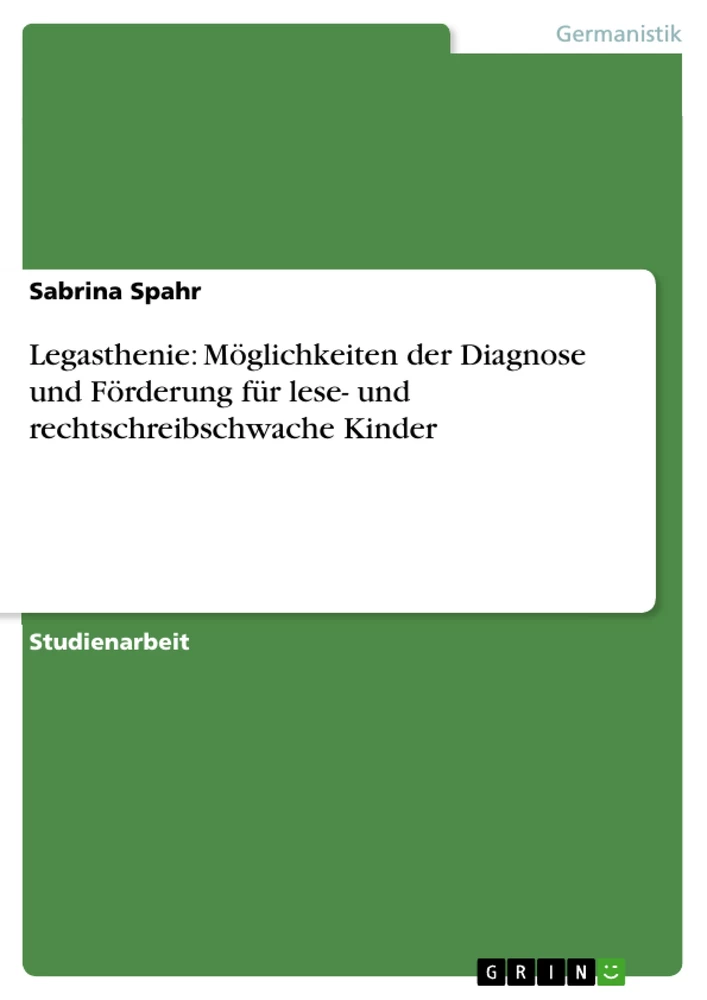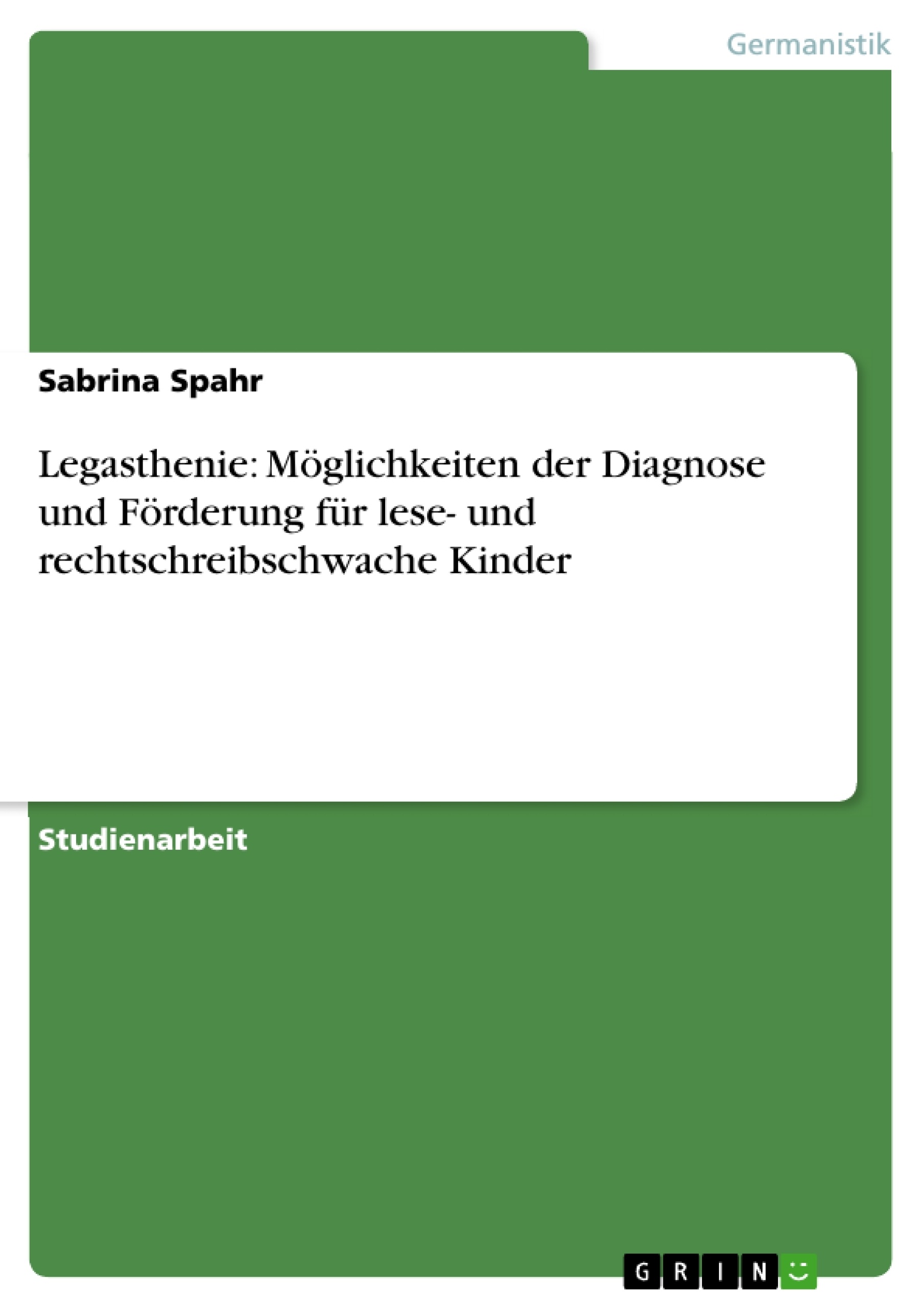Die Fähigkeiten des Lesens und Rechtschreibens sind in den industrialisierten Ländern hoch eingeschätzte Kulturtechniken. Daher ist ein Scheitern auf diesem Gebiet häufig mit generellen Schwierigkeiten während der gesamten Schullaufbahn verbunden. Schlechte Rechtschreib-leistungen wurden im naiven psychologischen Verständnis lange Zeit als Zeichen verminderter Intelligenz betrachtet. Nicht selten wurde von der Rechtschreibleistung eines Kindes unmittelbar auf seine Begabung geschlossen, sodass auch der Übertritt auf eine weiterführende Schule erheblich von den schriftsprachlichen Konsequenzen eines Schülers abhing. Auch wenn in den letzten Jahren verstärkt Bemühungen unternommen wurden, das schulische Fortkommen weniger von den schriftsprachlichen Leistungen abhängig zu machen, ist die Annahme eines engen Zusammenhangs zwischen Intelligenz und Lese- Rechtschreibleistung nach wie vor präsent. Deutlich wird dies am Beispiel der Legasthenie, da die Diskrepanzdefinition letztendlich auf der Annahme gründet, dass der IQ ein gutes Maß zur Vorhersage der Lese-Rechtschreibleistung ist und ein zumindest normal intelligentes Kind ohne größere Schwierigkeiten, Lesen und Schreiben erlernen müsste.
In der folgenden Arbeit möchte ich mich mit dem Thema Legasthenie auseinandersetzen und vor allem Fragen klären, wie „Welche Rolle spielt die Intelligenz eines Kindes beim Schriftspracherwerb tatsächlich?“ oder „Ist der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Lese- Rechtschreibleistung wirklich so hoch, dass sich damit Schlussfolgerungen auf das Bildungsniveau oder das Diskrepanzkonzept der Legasthenie rechtfertigen ließen?“
Bevor ich auf die Ursachen einer Legasthenie und das Verhalten eines Legasthenikers eingehen werde, möchte ich einige bekannte Modelle des ungestörten Schriftspracherwerbs betrachten und einen kurzen Abriss über die wichtigsten Veränderungen geben, die sich in den letzten Jahren in der Lese- Rechtschreibforschung vollzogen haben. Im letzten Teil meiner Arbeit werde ich verschiedene Diagnose- und Fördermöglichkeiten darstellen, da das Thema Diagnose und Förderung sehr wichtig für mich als spätere Grundschullehrerin ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Entwicklung des Lesens und Schreibens
- 2.1 Die Lese- Rechtschreibforschung im Wandel
- 2.2 Modelle zum Schriftspracherwerb
- 2.2.1 Das Modell von Frith (1986)
- 2.2.2 Der Ansatz von May (1986)
- 2.2.3 Das Modell von Scheerer- Neumann (1987)
- 2.3 Kritische Betrachtung der Modelle
- 3. Das Konzept Legasthenie
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Ursachen von Lese- Rechtschreibstörungen
- 3.2.1 Entwicklung der Integration
- 3.2.2 Entwicklung der Hirndominanz
- 3.2.3 Entwicklung der visuellen und auditiven Wahrnehmung
- 3.2.4 Entwicklung der Motorik
- 3.3 Das Verhalten von Legasthenikern
- 3.3.1 Konzentration und Ausdauer
- 3.3.2 Frustrationstoleranz
- 3.3.3 Schulische Leistung
- 3.3.3.1 Anzeichen im Vorschulalter
- 3.3.3.2 Anzeichen im Alter von 6 bis 9 Jahren
- 3.3.3.3 Anzeichen im Alter von 9 bis 12 Jahren
- 3.3.3.4 Anzeichen bei Kindern mit 12 Jahren und älter
- 3.3.4 Umgang mit einem Legastheniker
- 3.4 Die Intelligenzentwicklung
- 3.4.1 Korrelative Zusammenhänge zwischen Intelligenz/ Rechtschreibleistung
- 3.4.2 Die Vorhersage der Lese- Rechtschreibleistung
- 3.4.3 Die Bedeutung beim Schriftspracherwerb
- 4. Diagnose
- 4.1 Fragebögen
- 4.2 Informelle Diagnosemöglichkeiten
- 4.2.1 Begriffliche Abgrenzung
- 4.2.2 Lernzielkontrollen diagnostisch nutzen
- 4.2.3 Lesen
- 4.2.4 Rechtschreiben
- 4.3 Standardisierte Testverfahren
- 4.3.1 Auswahl einiger Testverfahren
- 4.3.2 Hamburger Schreibprobe (HSP)
- 5. Förderung
- 5.1 Spielerische Förderung im Vorschulalter - Das Würzburger Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit
- 5.2 Fördermöglichkeiten in der Grundschule
- 5.2.1 Entwicklung eines Förderkonzepts
- 5.2.2 Organisation von Förderunterricht
- 5.2.3 Fördermaterialien
- 5.2.4 Förderprogramme
- 5.2.4.1 Marburger Rechtschreibtraining
- 5.2.4.2 Kieler Lese- und Rechtschreibaufbau
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Legasthenie und untersucht die Rolle der Intelligenz beim Schriftspracherwerb. Sie beleuchtet die Frage, ob ein enger Zusammenhang zwischen Intelligenz und Lese- Rechtschreibleistung besteht und ob sich daraus Schlussfolgerungen auf das Bildungsniveau oder das Diskrepanzkonzept der Legasthenie ziehen lassen.
- Die Entwicklung des Lesens und Schreibens und die wichtigsten Veränderungen in der Lese- Rechtschreibforschung
- Das Konzept Legasthenie, inklusive Begriffsklärung und Ursachenanalyse
- Das Verhalten von Legasthenikern und die Bedeutung der Intelligenzentwicklung im Zusammenhang mit dem Schriftspracherwerb
- Verschiedene Diagnose- und Fördermöglichkeiten für Legastheniker
- Zusammenhänge zwischen Intelligenz und Lese- Rechtschreibleistung und deren Bedeutung für die Legasthenie-Diagnose
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Legasthenie ein und beleuchtet die Bedeutung des Schriftspracherwerbs in der heutigen Gesellschaft. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit dar, die sich auf den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Lese- Rechtschreibleistung sowie auf die Rolle der Intelligenz beim Schriftspracherwerb konzentrieren.
Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung des Lesens und Schreibens und den wichtigsten Veränderungen in der Lese- Rechtschreibforschung. Es werden verschiedene Modelle des Schriftspracherwerbs vorgestellt, wie das Modell von Frith (1986), der Ansatz von May (1986) und das Modell von Scheerer- Neumann (1987).
Kapitel 3 befasst sich mit dem Konzept Legasthenie. Es werden die Begriffsklärung, die Ursachen von Lese- Rechtschreibstörungen und das Verhalten von Legasthenikern behandelt.
Kapitel 4 widmet sich der Diagnose von Legasthenie. Es werden verschiedene Diagnosemöglichkeiten vorgestellt, darunter Fragebögen, informelle Diagnosemöglichkeiten und standardisierte Testverfahren.
Kapitel 5 behandelt die Förderung von Legasthenikern. Es werden verschiedene Fördermöglichkeiten vorgestellt, darunter spielerische Förderung im Vorschulalter, Fördermöglichkeiten in der Grundschule und verschiedene Förderprogramme.
Schlüsselwörter
Legasthenie, Schriftspracherwerb, Lese- Rechtschreibstörungen, Intelligenz, Diagnose, Förderung, Modelle, Forschung, Verhalten, Ursachen, Integration, Hirndominanz, Wahrnehmung, Motorik, Schreibprobe, Trainingsprogramm, Förderkonzepte, Fördermaterialien, Marburger Rechtschreibtraining, Kieler Lese- und Rechtschreibaufbau.
- Quote paper
- Sabrina Spahr (Author), 2008, Legasthenie: Möglichkeiten der Diagnose und Förderung für lese- und rechtschreibschwache Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164797