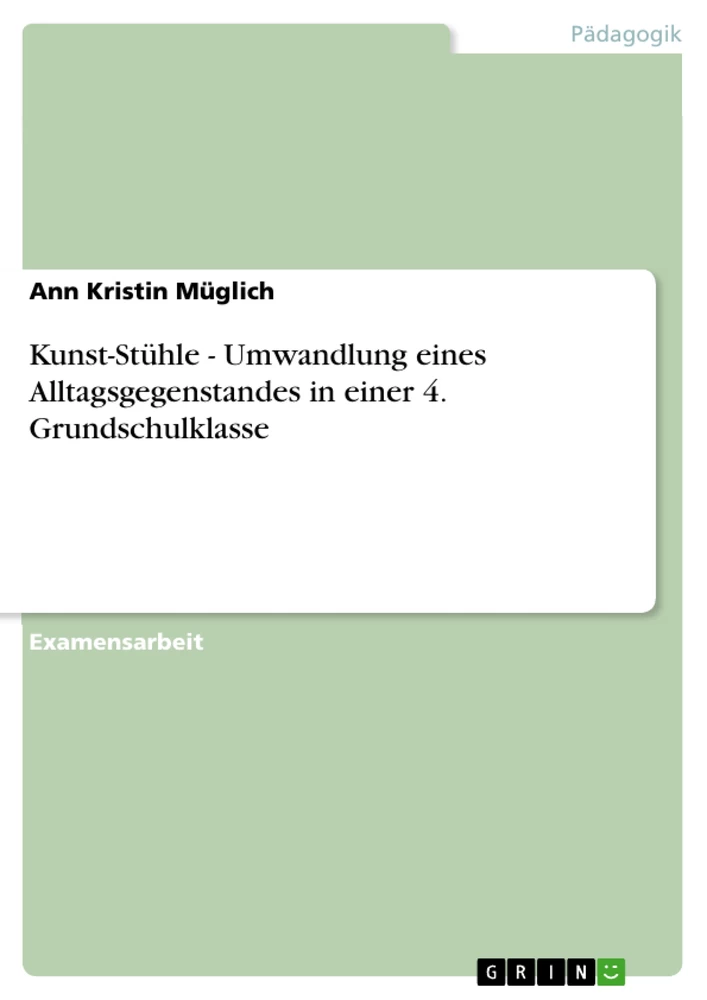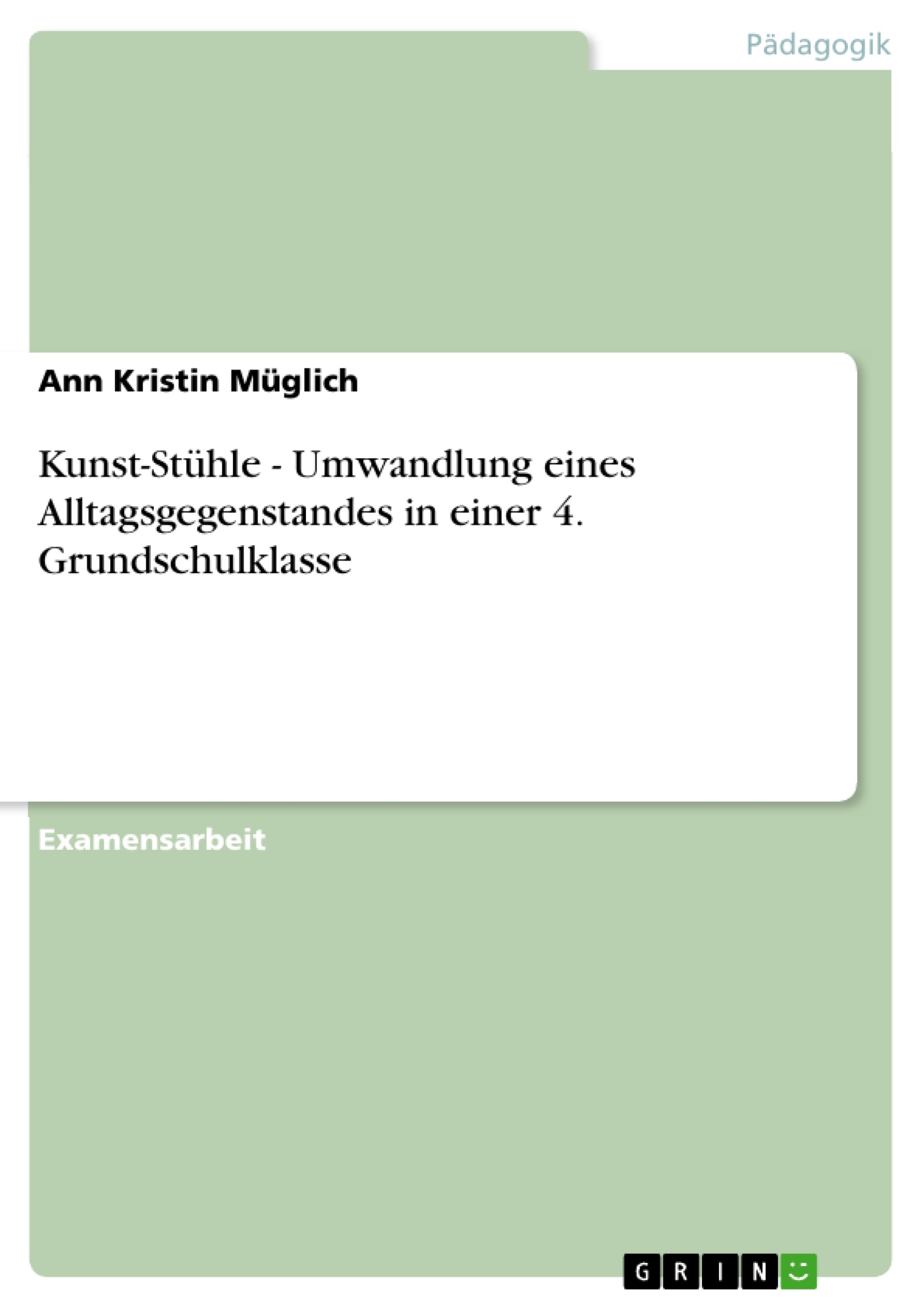"Wir neigen dazu, in einer Welt von Gewissheit, von unbestreitbarer Stichhaltigkeit der Wahrnehmung zu leben, in der unsere Überzeugungen beweisen, dass die Dinge nur so sind, wie wir sie sehen. Wenn wir jedoch nur sehen, was wir wissen, ist es sinnlos,
die Wahrnehmung schärfen zu wollen."
Das Zitat von Humberto R. Maturana verdeutlicht die dieser Arbeit zugrunde liegende Kernidee. Unter dem Gesichtspunkt der gegenwärtigen Entwicklung der veränderten Kindheit erhält die Sensibilisierung der Wahrnehmung für den Kunstunterricht besondere Bedeutung. In der vorliegenden Arbeit geht es darum, Kindern die Möglichkeit zu ästhetischem Erfahrungslernen in einem dafür geeignetem Lernarrangement zu bieten.
Die dargestellte Unterrichtseinheit "Kunst-Stühle – Umwandlung eines Alltagsgegenstandes" ist geprägt von dem Leitgedanken, Schülern die Lebenswelt transparenter zu machen und zum genauen Hinsehen anzuregen. Die Umwandlung eines gewöhnlichen Gegenstandes evoziert eine bewusste Neuinszenierung der Wahrnehmung, indem durch das künstlerische Mittel der Verfremdung neue Sichtweisen auf scheinbar Altbekanntes eröffnet werden. Durch die intensive, künstlerisch- ästhetische Auseinandersetzung verschwimmt die Grenze zwischen Alltäglichkeit und Einzigartigkeit. Somit werden eine neue Art der Wahrnehmung sowie eine erhöhte Form der Aufmerksamkeit erschaffen.
In der vorliegenden Unterrichtseinheit zeigen Schülerinnen und Schüler einer vierten Grundschulklasse den Versuch, auf der Schwelle zwischen Wirklichkeitserfahrung und Fantasie den Alltagsgegenstand Stuhl neu zu sehen, indem sie aus ihm Neues erschaffen.Die Einheit steht unter dem Anspruch, sowohl der Vielfalt der ästhetischen Materialien und Techniken, als auch der Individualität der kindlichen Sichtweisen gerecht zu werden und Differenzierung bzw. Individualisierung der bildnerischen Arbeit sowie eine größere Vielfalt der ästhetischen Zugriffsweisen zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Allgemeine Überlegungen zur Sache
- 2.1 Der Alltagsgegenstand
- 2.2 Umwandlung
- 2.3 Ästhetisches Erfahrungslernen
- 2.4 Plastisches Gestalten
- 3 Planung der Unterrichtseinheit
- 3.1 Ziele der Unterrichtseinheit
- 3.2 Organisatorische Rahmenbedingungen
- 3.3 Beschreibung der Lerngruppe
- 3.3.1 Arbeits- und Sozialverhalten
- 3.3.2 Lernvoraussetzungen
- 3.4 Begründungszusammenhänge
- 3.4.1 Begründung der Themenwahl
- 3.4.2 Begründung der Entscheidung für plastisches Gestalten
- 3.4.3 Begründung der methodischen Entscheidungen
- 4 Durchführung der Unterrichtseinheit
- 4.1 Sequenz 1: Kunstrezeption
- 4.1.1 Verlaufsplanung
- 4.1.2 Verlauf und Reflexion
- 4.2 Sequenz 2: Der Stuhl als Alltagsgegenstand
- 4.2.1 Verlaufsplanung
- 4.2.2 Verlauf und Reflexion
- 4.3 Sequenz 3: Entwicklung einer Gestaltungsidee
- 4.3.1 Verlaufsplanung
- 4.3.2 Verlauf und Reflexion
- 4.4 Sequenz 4: Konkretisierung der Ideen
- 4.4.1 Verlaufsplanung
- 4.4.2 Verlauf und Reflexion
- 4.5 Sequenz 5: Organisation der praktischen Arbeit
- 4.5.1 Verlaufsplanung
- 4.5.2 Verlauf und Reflexion
- 4.6 Sequenz 6: Künstlerisch-ästhetische Praxis
- 4.6.1 Verlaufsplanung
- 4.6.2 Verlauf und Reflexion
- 4.7 Sequenz 7: Haptische Materialqualitäten
- 4.7.1 Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit
- 4.7.2 Schwerpunktziel der Stunde
- 4.7.3 Einordnung der Stunde ins Kerncurriculum
- 4.7.4 Bemerkungen zur Lerngruppe und zu den Rahmenbedingungen
- 4.7.5 Überlegungen zur Sache
- 4.7.6 Didaktisch-methodische Überlegungen
- 4.7.7 Verlaufsplanung
- 4.7.8 Verlauf und Reflexion
- 4.8 Sequenz 8: Zwischenreflexion
- 4.8.1 Verlaufsplanung
- 4.8.2 Verlauf und Reflexion
- 4.9 Sequenz 9: Künstlerisch-ästhetische Praxis
- 4.9.1 Verlaufsplanung
- 4.9.2 Verlauf und Reflexion
- 4.10 Sequenz 10: Schreiben zu den Kunst-Stühlen
- 4.10.1 Verlaufsplanung
- 4.10.2 Verlauf und Reflexion
- 4.11 Sequenz 11: Abschlussreflexion
- 4.11.1 Verlaufsplanung
- 4.11.2 Verlauf und Reflexion
- 4.12 Sequenz 12: Präsentation
- 4.12.1 Verlaufsplanung
- 4.12.2 Verlauf und Reflexion
- 5 Abschlussreflexion der Unterrichtseinheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dokumentiert die Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema "Kunst-Stühle" in einer vierten Grundschulklasse. Ziel ist es, den Prozess der Umwandlung eines Alltagsgegenstandes (des Stuhls) in ein künstlerisches Objekt zu beschreiben und zu reflektieren. Die Arbeit beleuchtet die didaktisch-methodischen Entscheidungen und deren Begründung im Kontext des ästhetischen Erfahrungslernens und plastischen Gestaltens.
- Umwandlung eines Alltagsgegenstandes in ein Kunstwerk
- Ästhetisches Erfahrungslernen in der Grundschule
- Plastisches Gestalten als Methode
- Didaktisch-methodische Reflexion der Unterrichtseinheit
- Dokumentation des Unterrichtsprozesses
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt den Kontext der schriftlichen Hausarbeit im Rahmen der Zweiten Staatsprüfung. Sie skizziert kurz den Inhalt und die Struktur der Arbeit.
2 Allgemeine Überlegungen zur Sache: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden Überlegungen zum Alltagsgegenstand "Stuhl", verschiedene Möglichkeiten der Umwandlung, das ästhetische Erfahrungslernen und die Bedeutung des plastischen Gestaltens im Kunstunterricht erörtert. Es liefert ein umfassendes Verständnis des theoretischen Rahmens für die anschließende praktische Umsetzung im Unterricht.
3 Planung der Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Planung der Unterrichtseinheit. Es beinhaltet die Definition der Lernziele, die Beschreibung der organisatorischen Rahmenbedingungen, eine Charakterisierung der Lerngruppe (einschließlich Arbeits- und Sozialverhalten sowie Lernvoraussetzungen), und eine ausführliche Begründung der Themenwahl, der methodischen Entscheidungen und der Wahl des plastischen Gestaltens als Schwerpunkt.
4 Durchführung der Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel dokumentiert die einzelnen Sequenzen der Unterrichtseinheit. Für jede Sequenz wird die Verlaufsplanung und eine anschließende Reflexion der Durchführung vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Verlaufs, der Beobachtungen während des Unterrichts und einer kritischen Reflexion der Planung und Umsetzung im Hinblick auf die angestrebten Lernziele.
Schlüsselwörter
Kunst, Grundschule, Alltagsgegenstand, Stuhl, Umwandlung, plastisches Gestalten, ästhetisches Erfahrungslernen, Unterrichtseinheit, Didaktik, Methodik, Reflexion, Lernziele, Lerngruppe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtseinheit "Kunst-Stühle"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit dokumentiert die Planung und Durchführung einer Unterrichtseinheit zum Thema „Kunst-Stühle“ in einer vierten Grundschulklasse. Der Fokus liegt auf der Umwandlung eines Alltagsgegenstandes (des Stuhls) in ein künstlerisches Objekt und der Reflexion des gesamten Prozesses.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Umwandlung von Alltagsgegenständen in Kunstwerke, ästhetisches Erfahrungslernen in der Grundschule, plastisches Gestalten als Methode, didaktisch-methodische Reflexion und die Dokumentation des Unterrichtsprozesses. Konkret wird der Stuhl als Alltagsgegenstand untersucht und seine Umwandlung in ein Kunstobjekt im Unterricht umgesetzt und reflektiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, allgemeine Überlegungen zur Sache (theoretische Grundlagen), Planung der Unterrichtseinheit (Ziele, Organisation, Lerngruppe), Durchführung der Unterrichtseinheit (detaillierte Beschreibung der einzelnen Sequenzen mit Planung und Reflexion) und Abschlussreflexion der Unterrichtseinheit. Das Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte und Unterabschnitte.
Welche Ziele werden in der Unterrichtseinheit verfolgt?
Die Unterrichtseinheit zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern ästhetisches Erfahrungslernen zu ermöglichen und sie im plastischen Gestalten zu fördern. Sie sollen den Prozess der Umwandlung eines Alltagsgegenstandes in ein Kunstwerk verstehen und selbst kreativ umsetzen. Die Arbeit reflektiert die didaktisch-methodischen Entscheidungen, die zur Erreichung dieser Ziele getroffen wurden.
Wie ist der Ablauf der Unterrichtseinheit?
Die Durchführung der Unterrichtseinheit ist in zwölf Sequenzen unterteilt, die jeweils eine Verlaufsplanung und eine anschließende Reflexion umfassen. Die Sequenzen umfassen Phasen der Kunstrezeption, der Auseinandersetzung mit dem Stuhl als Alltagsgegenstand, der Entwicklung von Gestaltungsideen, der praktischen Arbeit, der Reflexion der haptischen Materialqualitäten und der Präsentation der Ergebnisse. Jede Sequenz wird detailliert beschrieben und reflektiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kunst, Grundschule, Alltagsgegenstand, Stuhl, Umwandlung, plastisches Gestalten, ästhetisches Erfahrungslernen, Unterrichtseinheit, Didaktik, Methodik, Reflexion, Lernziele, Lerngruppe.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen dar. Es werden Überlegungen zum Alltagsgegenstand „Stuhl“, Möglichkeiten der Umwandlung, ästhetisches Erfahrungslernen und die Bedeutung des plastischen Gestaltens im Kunstunterricht erörtert. Dies liefert den theoretischen Rahmen für die praktische Umsetzung im Unterricht.
Wie wird die Lerngruppe beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Lerngruppe im Hinblick auf Arbeits- und Sozialverhalten sowie Lernvoraussetzungen. Diese Beschreibung dient dazu, die didaktisch-methodischen Entscheidungen zu kontextualisieren und zu begründen.
Wie wird die Arbeit im Kontext der Zweiten Staatsprüfung eingeordnet?
Die Einleitung ordnet die Arbeit in den Kontext der Zweiten Staatsprüfung ein und beschreibt den Hintergrund und die Zielsetzung der schriftlichen Hausarbeit.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel findet sich im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel". Dieser Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
- Quote paper
- Ann Kristin Müglich (Author), 2010, Kunst-Stühle - Umwandlung eines Alltagsgegenstandes in einer 4. Grundschulklasse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164617