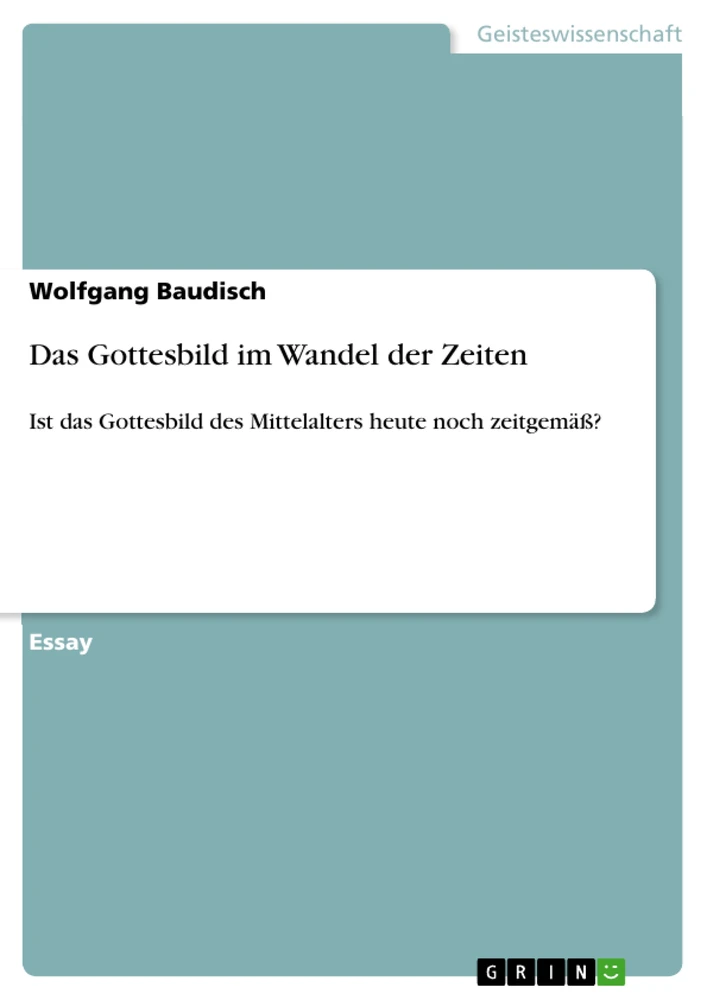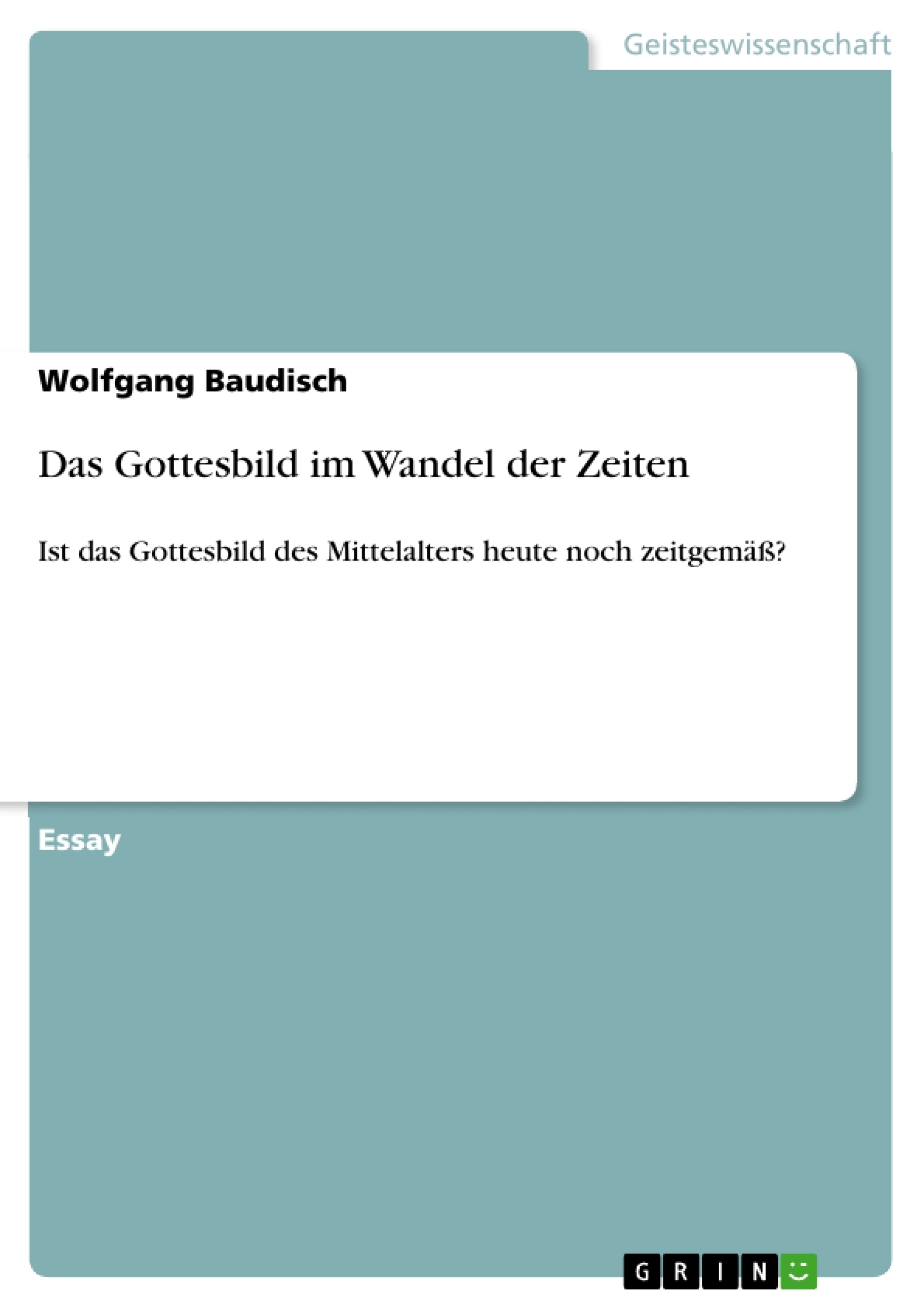Dieser kleine Essay behandelt vorwiegend das Gottesbild im christlichen Abendland und geht nur marginal auf jenes in außereuropäischen Religionen ein. Im abendländischen Kulturkreis hat die damals nur katholische Kirche bis zum Beginn der Neuzeit, der etwa mit 1500 n.Chr. angesetzt wird, nicht nur die Religion, sondern auch alle Wissenschaften dominiert und so ein geschlossenes Weltbild geprägt. Seit der Zeit der großen Welt-Entdeckungen haben sich jedoch die sogenannten exakten Naturwissenschaften unaufhaltsam weiter entwickelt, während die christlichen Kirchen starr an den seit dem Mittelalter überlieferten Lehren und Dogmen festgehalten haben. Die Wissenschaft hat beginnend mit Galileo Galilei immer mehr Tatsachen entdeckt, die in diametralem Gegensatz zur kirchlichen Lehre gestanden sind. Dadurch hat sich das Weltbild aufgespalten in ein theologisches Gottesbild und ein davon gänzlich losgelöstes wissenschaftliches Weltbild, wobei beide Disziplinen vermeintlich ohne Wechselwirkung zwischen einander ihre eigene Suche nach der Wahrheit betrieben haben. Es soll nun versucht werden, ein neues Gottesbild, das nicht mehr im Widerspruch zur wissenschaftlichen Erkenntnis steht, zu entwickeln, so dass sich daraus zum ersten Mal wieder ein geschlossenes, die Metaphysik und die Physik gleichermaßen umfassendes Weltbild ergeben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Geschichtlicher Rückblick
- Gott als Schöpfer
- Gott als Beschützer
- Gott als Richter
- Gott als Wundertäter
- Der transzendente Gott
- Das Gebet
- Der Teufel
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert die Entwicklung des Gottesbilds im Laufe der Geschichte und stellt die Frage nach seiner zeitgemäßen Relevanz. Der Fokus liegt dabei auf dem Gottesbild im christlichen Abendland, wobei nur marginal auf außereuropäische Religionen eingegangen wird.
- Die Beziehung zwischen Weltbild und Gottesvorstellung
- Der Wandel des Gottesbilds von der Antike bis zur Moderne
- Die Rolle der Naturwissenschaften in der Entwicklung des Gottesbilds
- Die Auswirkungen des heliozentrischen Weltbilds auf die Theologie
- Ansätze für ein neues Gottesbild im Kontext der wissenschaftlichen Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil beleuchtet die Entwicklung des Gottesbilds in verschiedenen Kulturen und Epochen, beginnend mit dem Gottesbild der Naturvölker über das geozentrische Weltbild des Mittelalters bis hin zur modernen, wissenschaftlichen Perspektive. Der Fokus liegt dabei auf der Entstehung des Gottesbilds aus den jeweiligen Weltbildern und den Einflüssen von Wissenschaft und Erfahrung. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Rolle des Gottesbilds im Alltag des Menschen und analysiert die verschiedenen Funktionen Gottes, wie Schöpfer, Beschützer, Richter und Wundertäter. Der dritte Teil erörtert den transzendenten Gott, das Gebet und die Rolle des Teufels in der christlichen Tradition.
Schlüsselwörter
Gottesbild, Weltbild, Geschichte, Kultur, Religion, Wissenschaft, Theologie, Naturwissenschaft, Philosophie, Deismus, Schöpfung, Transzendenz, Kopernikanische Wende, Heliozentrismus, Geozentrismus, Mittelalter, Moderne, Zeitgeist
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Wolfgang Baudisch (Author), 2011, Das Gottesbild im Wandel der Zeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164533