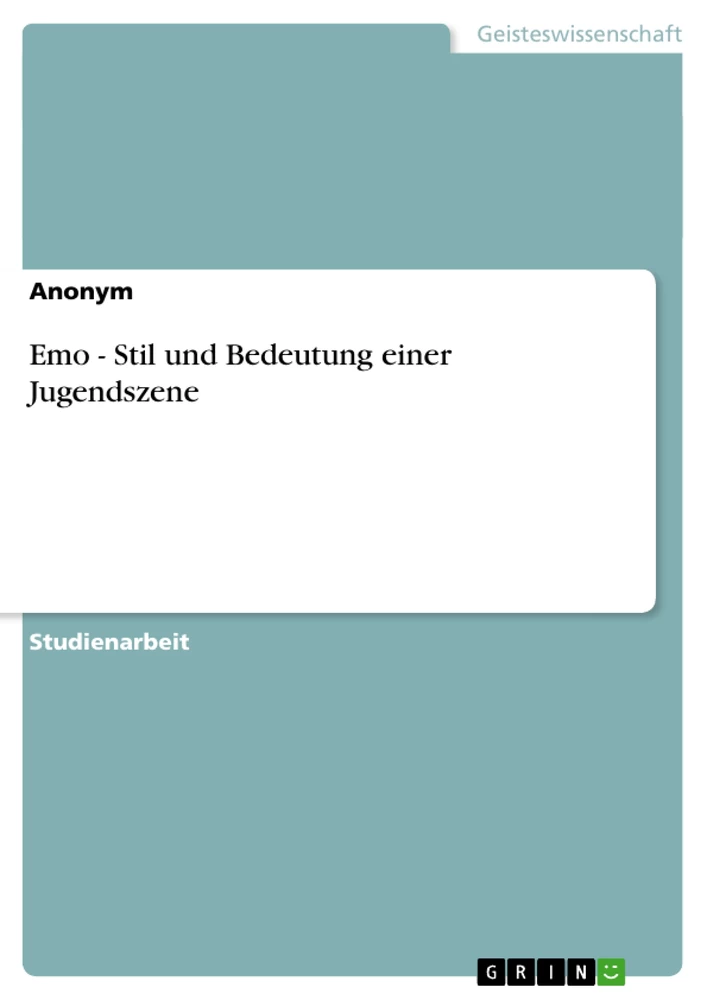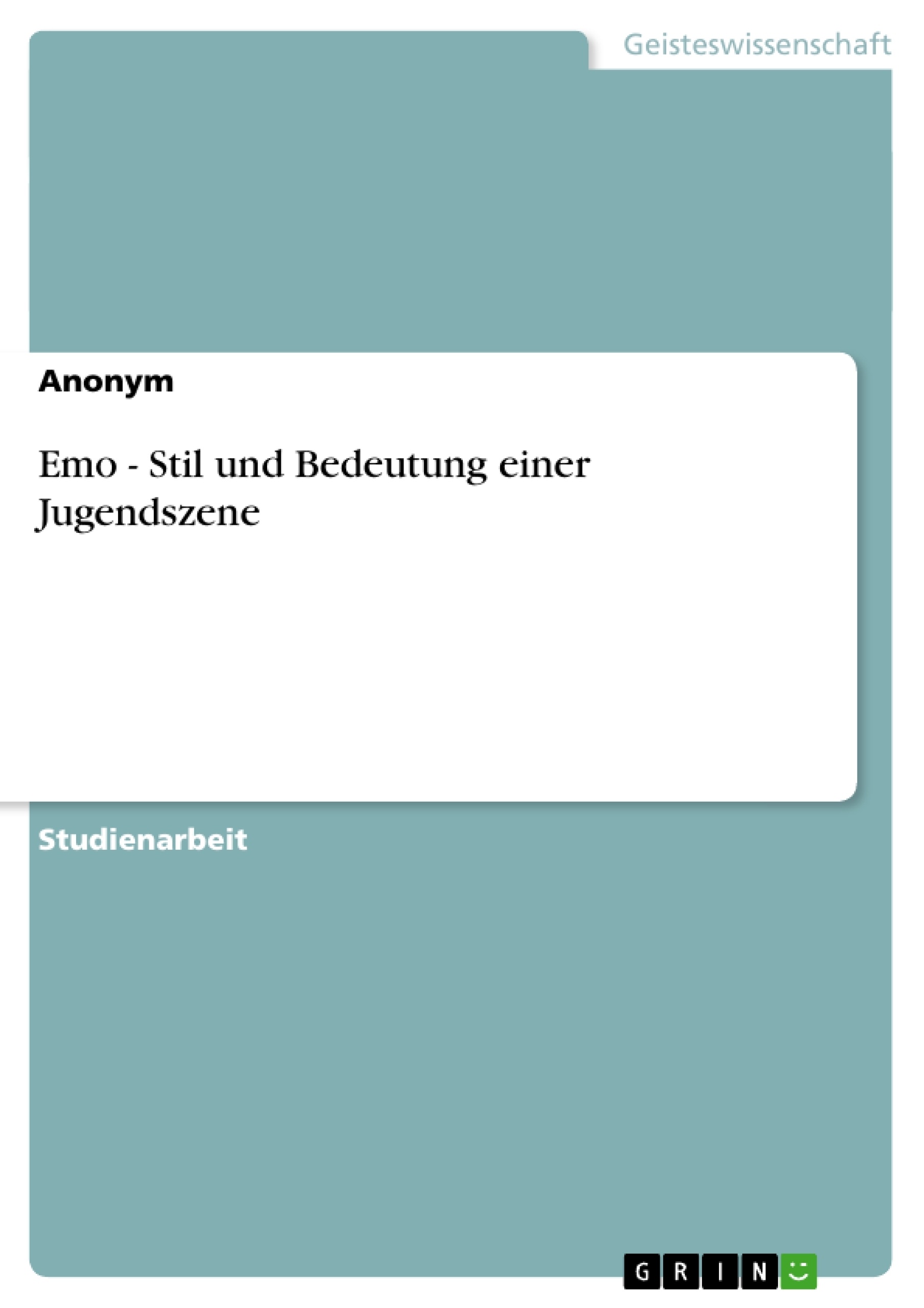Ich werde mich in der vorliegenden Arbeit mit der Emo-Jugendszene auseinandersetzen. Vor allem werde ich dabei die Entwicklung der letzen ca. 9 Jahre betrachten. In dieser Zeit wurde die Emo-Bewegung zu einem Massenphänomen unter Jugendlichen, dessen Wachstum bis heute ungebrochen anhält. Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für das Herkunftsland USA und alle internationalen Industrieländer. Dies bestätigt die Youtube-Suche nach Videos in den Sprachen arabisch, chinesisch, türkisch und koreanisch, die zahlreiche Videos liefert.
Meine Internet-Community – Recherche beschränkt sich auf deutsch- und englischsprachige Websites, wohingegen die Literatur zur Emoszene hauptsächlich aus dem Amerikanischen stammt. Das Internet bietet sich als Informationsquelle deshalb an, weil die Emoszene dort sehr aktiv ist.
Es geht mir in dieser Arbeit vorwiegend um die, oftmals als „Emo Kids“ betitelte Gruppe von Emos. Die Abgrenzung zwischen „Emo Independents“ und „Emo Kids“ (auch „Emo Mainstreams“) werde ich in Kapitel 3.3 näher erläutern. Ich orientiere mich bei der Analyse dieser Jugendszene hauptsächlich an Theorien der Cultural Studies. Diese werden in Kapitel 2.1 eingeführt. Grundlage sind hierbei Dick Hebdiges Analysen von Subkulturen der 70er Jahre (Kapitel 2.2.).
Ich werde versuchen seinen Ansatz auf die Emo Jugendszene anzuwenden. Dadurch soll zunächst die Popularität der, in der Emo-Jugendszene vorherrschenden Kultur, erklärt werden, aber auch die starke Polarisierung die von der Emoszene ausgeht. Anhand der Semiotik, die vor allem durch Roland Barthes Einzug in die Cultural Studies erhielt, sollen die Bedeutungen, die hinter der Musik und dem Stil der Emoszene stecken analysiert werden. Außerdem werde ich versuchen die Emoszene in einen größeren popkulturellen Zusammenhang zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Cultural Studies
- 2.2 Semiotik - Zeichen und Mythen
- 3 Analyse der Emo-Jugendszene
- 3.1 Auswahl des Untersuchungsobjekts
- 3.2 Populärkulturelle Einordnung
- 3.3 Grundlegendes zur Emo-Jugendszene
- 3.4 Stil und Codes der Emo-Jugendszene
- 3.4.1 Stil und Bricolage
- 3.4.2 Bedeutung des Stils
- 3.5 Subkulturen und herrschende Kultur
- 3.6 Die Emo-Kids und die harte Tür des Pop
- 3.7 Kultur und Massenmedien
- 3.8 Konsum und Internet
- 4 Zusammenfassung und weiterführende Fragestellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Emo-Jugendszene, insbesondere ihre Entwicklung in den vergangenen neun Jahren, in denen sie zu einem Massenphänomen wurde. Die Analyse konzentriert sich auf die oft als „Emo Kids“ bezeichnete Gruppe und nutzt Theorien der Cultural Studies, insbesondere die Ansätze von Dick Hebdige zu Subkulturen der 70er Jahre und die Semiotik von Roland Barthes, um die Popularität, die Polarisierung und die kulturelle Bedeutung der Szene zu erklären. Der Fokus liegt auf der Analyse des Stils, der Musik und des Kontextes innerhalb der Popkultur.
- Entwicklung und Popularität der Emo-Jugendszene
- Analyse des Stils und der Codes der Emo-Szene mittels Semiotik
- Einordnung der Emo-Szene in den Kontext der Popkultur und der Massenmedien
- Die Rolle von Konsum und Internet in der Emo-Szene
- Untersuchung der Beziehung zwischen Emo-Subkultur und der herrschenden Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
1 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit: Die Arbeit untersucht die Emo-Jugendszene und ihre Entwicklung über die letzten neun Jahre, in denen sie sich zu einem globalen Phänomen entwickelt hat. Der Fokus liegt auf der Gruppe der „Emo Kids“ und nutzt Theorien der Cultural Studies, um die Popularität und die Polarisierung der Szene zu erklären. Die Arbeit analysiert den Stil, die Musik und die Einbettung in die Popkultur und beleuchtet die Rolle des Internets. Die Abgrenzung zu „Emo Independents“ wird angekündigt.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es behandelt zentrale Aspekte der Cultural Studies, insbesondere die Bedeutung der Populärkultur und die aktive Rolle des Rezipienten, wie von Stuart Hall beschrieben. Der Einfluss von Dick Hebdige und seinen Analysen von Subkulturen der 70er Jahre wird hervorgehoben, genauso wie die Semiotik von Roland Barthes und deren Bedeutung für die Analyse von Zeichen und Mythen in der Kultur. Das Kapitel dient als Basis für die spätere Analyse der Emo-Szene.
3 Analyse der Emo-Jugendszene: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Analyse der Emo-Jugendszene. Es befasst sich mit der Auswahl des Untersuchungsobjekts, der Einordnung in die Populärkultur, den grundlegenden Merkmalen der Szene sowie einer detaillierten Betrachtung des Stils und seiner Codes. Hier werden „Emo Kids“ und „Emo Independents“ genauer differenziert, und der Einfluss von Subkultur, Massenmedien, Konsum und dem Internet werden untersucht. Die Bedeutung von Stil als Ausdruck von Widersprüchen und Spannungen wird im Kontext der Theorien von Hebdige und Barthes eingeordnet.
Schlüsselwörter
Emo-Jugendszene, Cultural Studies, Semiotik, Subkultur, Populärkultur, Stil, Identität, Massenmedien, Konsum, Internet, Dick Hebdige, Roland Barthes, „Emo Kids“, „Emo Independents“, Bricolage, Mythen, Zeichen.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über die Emo-Jugendszene
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Emo-Jugendszene, insbesondere ihre Entwicklung in den vergangenen neun Jahren, in denen sie zu einem Massenphänomen wurde. Der Fokus liegt auf der Gruppe der „Emo Kids“ und analysiert deren Stil, Musik und Kontext innerhalb der Popkultur.
Welche Theorien werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien der Cultural Studies, insbesondere die Ansätze von Dick Hebdige zu Subkulturen der 70er Jahre und die Semiotik von Roland Barthes. Diese werden verwendet, um die Popularität, Polarisierung und kulturelle Bedeutung der Emo-Szene zu erklären.
Welche Aspekte der Emo-Jugendszene werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Entwicklung und Popularität der Szene, den Stil und die Codes der Emo-Szene (mittels Semiotik), die Einordnung in die Popkultur und Massenmedien, die Rolle von Konsum und Internet, sowie die Beziehung zwischen Emo-Subkultur und herrschender Kultur. Es wird auch zwischen „Emo Kids“ und „Emo Independents“ unterschieden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Aufbau und Zielsetzung, 2. Theoretische Grundlagen (Cultural Studies und Semiotik), 3. Analyse der Emo-Jugendszene (inkl. Stilanalyse, Einordnung in die Popkultur, Rolle von Medien und Konsum) und 4. Zusammenfassung und weiterführende Fragestellungen.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind Emo-Jugendszene, Cultural Studies, Semiotik, Subkultur, Populärkultur, Stil, Identität, Massenmedien, Konsum, Internet, Dick Hebdige, Roland Barthes, „Emo Kids“, „Emo Independents“, Bricolage, Mythen und Zeichen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Emo-Jugendszene zu verstehen und zu erklären, indem sie deren Entwicklung, Stil, kulturelle Einbettung und die Rolle von Medien und Konsum analysiert. Die Anwendung theoretischer Konzepte aus den Cultural Studies soll zu einem umfassenderen Verständnis der Szene beitragen.
Welche Rolle spielen Medien und Konsum in der Emo-Szene?
Die Arbeit untersucht, wie Medien (Massenmedien und Internet) und Konsum die Emo-Szene beeinflussen und prägen. Dies beinhaltet die Analyse des Einflusses des Internets und den Konsum von Musik, Kleidung und anderen Gütern im Kontext der Szene.
Wie wird der Stil der Emo-Szene analysiert?
Die Stilanalyse nutzt semiotische Ansätze, um die Bedeutung der Zeichen und Codes des Emo-Stils zu entschlüsseln und deren Rolle für die Identität und den Ausdruck der Szene zu verstehen. Der Begriff der Bricolage spielt dabei eine wichtige Rolle.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2009, Emo. Stil und Bedeutung einer Jugendszene, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164530