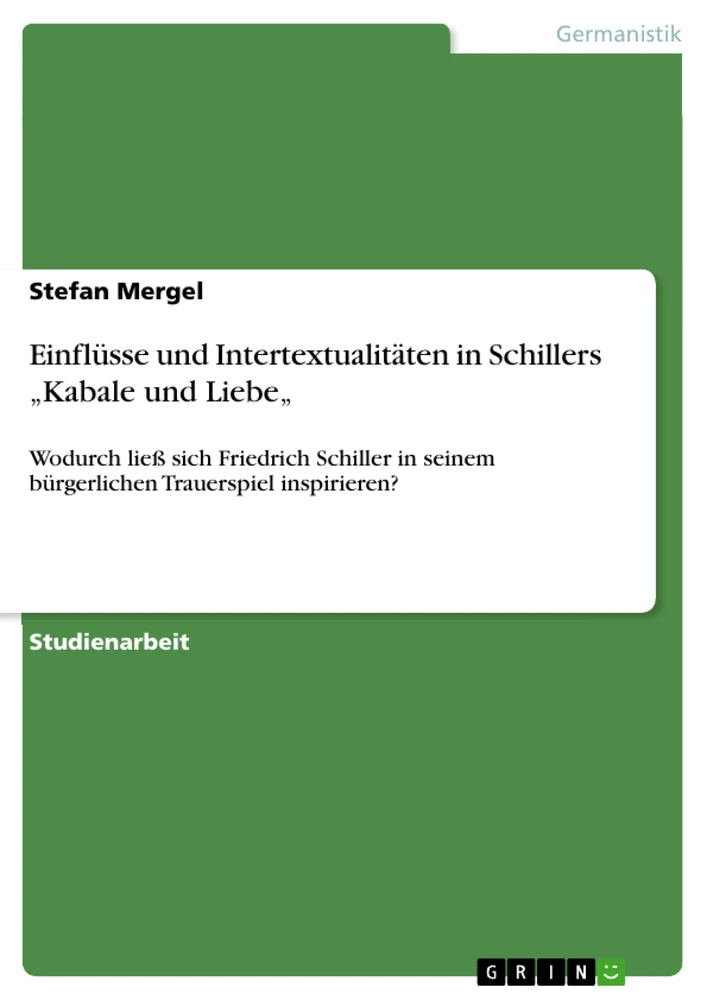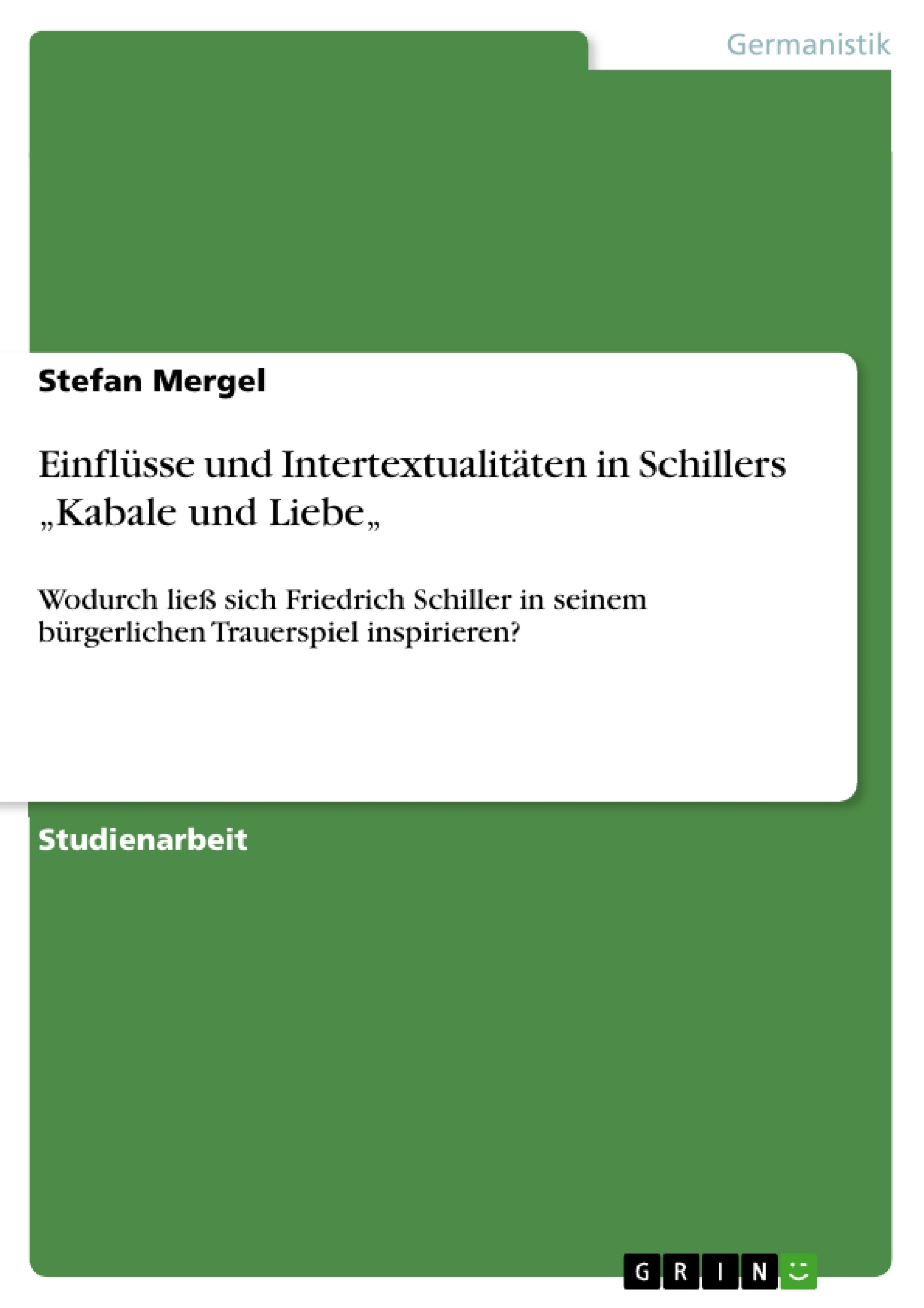Friedrich Schiller war ohne Zweifel ein literarisches Genie, das zahlreiche berühmte Dramen verfasste. Zweihundertfünfzig Jahre nach seiner Geburt werden seine Dramen und Gedichte regelmäßig in Schulen gelesen und in Theatern aufgeführt. Sein Drama „Kabale und Liebe“ zählt dabei zu den bekanntesten Werken Schillers. Ob er aber in der Lage war, sich auf die bürgerlichen Sphären herabzulassen, um dieses bürgerliches Trauerspiel zu schreiben, konnte er selbst nicht mit Sicherheit beantworten. Daher stellt sich die Frage, wie er auf die Idee für sein Werk kam. In der folgenden Arbeit sollen Anhaltspunkte aus der Geschichte, Intertextualitäten aus möglichen Werken anderer Autoren und aus seinem Leben gesucht werden, die Friedrich Schiller in „Kabale und Liebe“ einfließen ließ. Bevor aber nach diesen Punkten gesucht werden kann, soll der Begriff der Intertextualität anhand einer Definition geklärt werden. Nach der Klärung des Begriffs der Intertextualität, werden zuerst historische Geschehnisse mit Schillers bürgerlichem Trauerspiel verglichen. Als Anhänger des „Sturm und Drang“ ist es durchaus möglich, dass der damals dreiundzwanzigjährige Friedrich Schiller sein Missfallen gegenüber der vorherrschenden Realität in seinem Drama verarbeitete. Nach dem geklärt wird, ob historische Einflüsse bestehen, wird untersucht, ob Friedrich Schiller von anderen Autoren beeinflusst wurde. Dabei wird „Kable und Liebe“ zum einen mit Gotthold Ephraim Lessings „Emilia Galotti“ und anschließend mit William Shakespeares „Romeo und Julia“ verglichen. Mögliche Intertextualitäten zwischen den einzelnen Werken sollen untersucht werden. Im letzten Punkt werden direkte, persönliche Erlebnisse Schillers und deren Einfluss auf sein Werk analysiert. Abschließend werden die Ergebnisse in einem Fazit nochmals kurz wiederholt und eine Antwort auf die anfangs gestellte Frage „Wodurch ließ sich Friedrich Schiller in seinem bürgerlichen Trauerspiel inspirieren?“ gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Intertextualität
- 3. Intertextualität
- 3.1 Historische Intertextualität
- 3.1.1 Soldatenhandel
- 3.1.2 Mätressenwesen
- 3.1.3 Zwischenfazit
- 3.2 Literarische Intertextualität
- 3.2.1 Emilia Galotti
- 3.2.2 Romeo und Julia
- 3.3 Persönliche Hintergründe
- 3.3.1 Beziehung zu 16-jährige Charlotte von Wolzogen
- 3.3.2 „Kabale und Liebe“ als Bühnenstück
- 3.1 Historische Intertextualität
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Inspirationsquellen für Friedrich Schillers bürgerliches Trauerspiel „Kabale und Liebe“. Die Zielsetzung besteht darin, historische Ereignisse, literarische Intertextualitäten und persönliche Hintergründe Schillers zu identifizieren und deren Einfluss auf das Drama zu analysieren.
- Der Einfluss historischer Ereignisse (Soldatenhandel, Mätressenwesen) auf die Handlung und Thematik von „Kabale und Liebe“
- Literarische Intertextualität: Vergleich mit Werken wie Lessings „Emilia Galotti“ und Shakespeares „Romeo und Julia“
- Die Rolle persönlicher Erfahrungen Schillers (z.B. seine Beziehung zu Charlotte von Wolzogen) in der Entstehung des Dramas
- Die Auseinandersetzung mit dem Begriff der Intertextualität im Kontext des Dramas
- Die Darstellung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Kritik an der Standesunterschiede
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Inspirationsquellen für Schillers „Kabale und Liebe“. Sie umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit, der die Untersuchung historischer Einflüsse, literarischer Intertextualitäten und persönlicher Hintergründe des Autors umfasst. Die Einleitung begründet die Relevanz der Fragestellung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Definition Intertextualität: Dieses Kapitel klärt den Begriff der Intertextualität anhand der Theorien von Julia Kristeva und Gérard Genette. Es wird erläutert, wie Texte als Netzwerke von Zitaten und Anspielungen verstanden werden können und wie verschiedene Formen intertextueller Beziehungen (z.B. Hypertextualität) die Interpretation literarischer Werke beeinflussen. Die Definition legt die Grundlage für die spätere Analyse der Intertextualität in „Kabale und Liebe“.
3. Intertextualität: Dieses Kapitel untersucht die intertextuellen Beziehungen in „Kabale und Liebe“, indem es historische, literarische und persönliche Einflüsse beleuchtet. Es analysiert, wie historische Ereignisse wie der Soldatenhandel und das Mätressenwesen in das Drama eingeflossen sind und wie Schiller sich dabei möglicherweise an seinem eigenen Herzog, Karl Eugen, orientierte. Der Vergleich mit „Emilia Galotti“ und „Romeo und Julia“ zeigt weitere literarische Parallelen und Einflüsse auf. Schließlich werden persönliche Erfahrungen Schillers, insbesondere seine Beziehung zu Charlotte von Wolzogen, als Inspirationsquelle diskutiert.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, Intertextualität, bürgerliches Trauerspiel, historische Einflüsse, literarische Vorbilder, Emilia Galotti, Romeo und Julia, persönliche Hintergründe, Standesunterschiede, gesellschaftliche Kritik, Sturm und Drang.
Häufig gestellte Fragen zu: Inspirationsquellen für Schillers „Kabale und Liebe“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Inspirationsquellen für Friedrich Schillers Drama „Kabale und Liebe“. Sie untersucht den Einfluss historischer Ereignisse, literarischer Werke und persönlicher Erfahrungen Schillers auf die Entstehung und Thematik des Stücks.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Einfluss des Soldatenhandels und des Mätressenwesens, den Vergleich mit Lessings „Emilia Galotti“ und Shakespeares „Romeo und Julia“, sowie die Bedeutung von Schillers Beziehung zu Charlotte von Wolzogen. Weiterhin wird der Begriff der Intertextualität im Kontext des Dramas definiert und erläutert, und die gesellschaftliche Kritik und die Darstellung der Standesunterschiede werden analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Intertextualität, ein Kapitel zur Analyse der Intertextualität in „Kabale und Liebe“ (unterteilt in historische, literarische und persönliche Einflüsse) und abschließend ein Fazit. Das Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht der Kapitel und Unterkapitel.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit untersucht historische Ereignisse, literarische Intertextualitäten und persönliche Hintergründe Schillers, um deren Einfluss auf das Drama zu analysieren. Der methodische Ansatz umfasst die Interpretation von Texten und die Berücksichtigung von literaturwissenschaftlichen Theorien zur Intertextualität (z.B. von Julia Kristeva und Gérard Genette).
Welche konkreten historischen Ereignisse werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Soldatenhandels und des Mätressenwesens auf die Handlung und die Thematik von „Kabale und Liebe“. Es wird auch der Bezug zu Karl Eugen, dem Herzog von Württemberg, als möglicher Einflussfaktor diskutiert.
Welche literarischen Werke werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht „Kabale und Liebe“ mit Lessings „Emilia Galotti“ und Shakespeares „Romeo und Julia“, um literarische Parallelen und Einflüsse aufzuzeigen.
Welche Rolle spielen Schillers persönliche Erfahrungen?
Schillers Beziehung zu der 16-jährigen Charlotte von Wolzogen wird als mögliche Inspirationsquelle für das Drama analysiert. Die Arbeit beleuchtet, wie persönliche Erlebnisse in die Gestaltung des Stücks eingeflossen sein könnten.
Wie wird der Begriff „Intertextualität“ definiert?
Der Begriff der Intertextualität wird anhand der Theorien von Julia Kristeva und Gérard Genette erläutert. Es wird erklärt, wie Texte als Netzwerke von Zitaten und Anspielungen verstanden werden können und wie verschiedene Formen intertextueller Beziehungen die Interpretation beeinflussen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Kabale und Liebe, Intertextualität, bürgerliches Trauerspiel, historische Einflüsse, literarische Vorbilder, Emilia Galotti, Romeo und Julia, persönliche Hintergründe, Standesunterschiede, gesellschaftliche Kritik, Sturm und Drang.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Kapitels prägnant beschreibt.
- Quote paper
- Stefan Mergel (Author), 2009, Einflüsse und Intertextualitäten in Schillers „Kabale und Liebe„, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164515