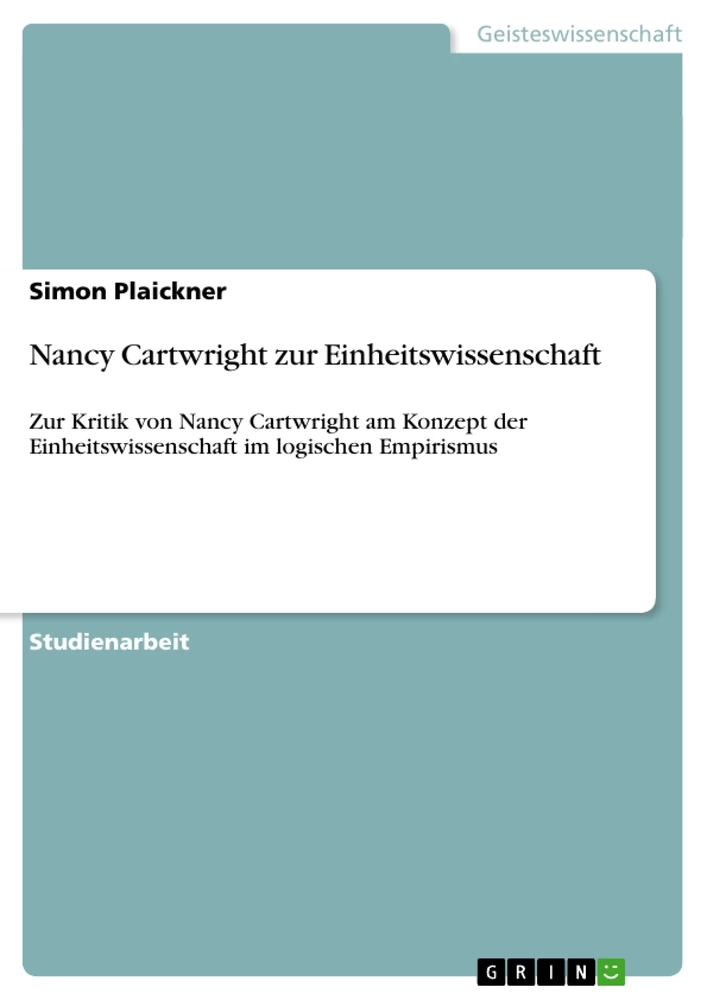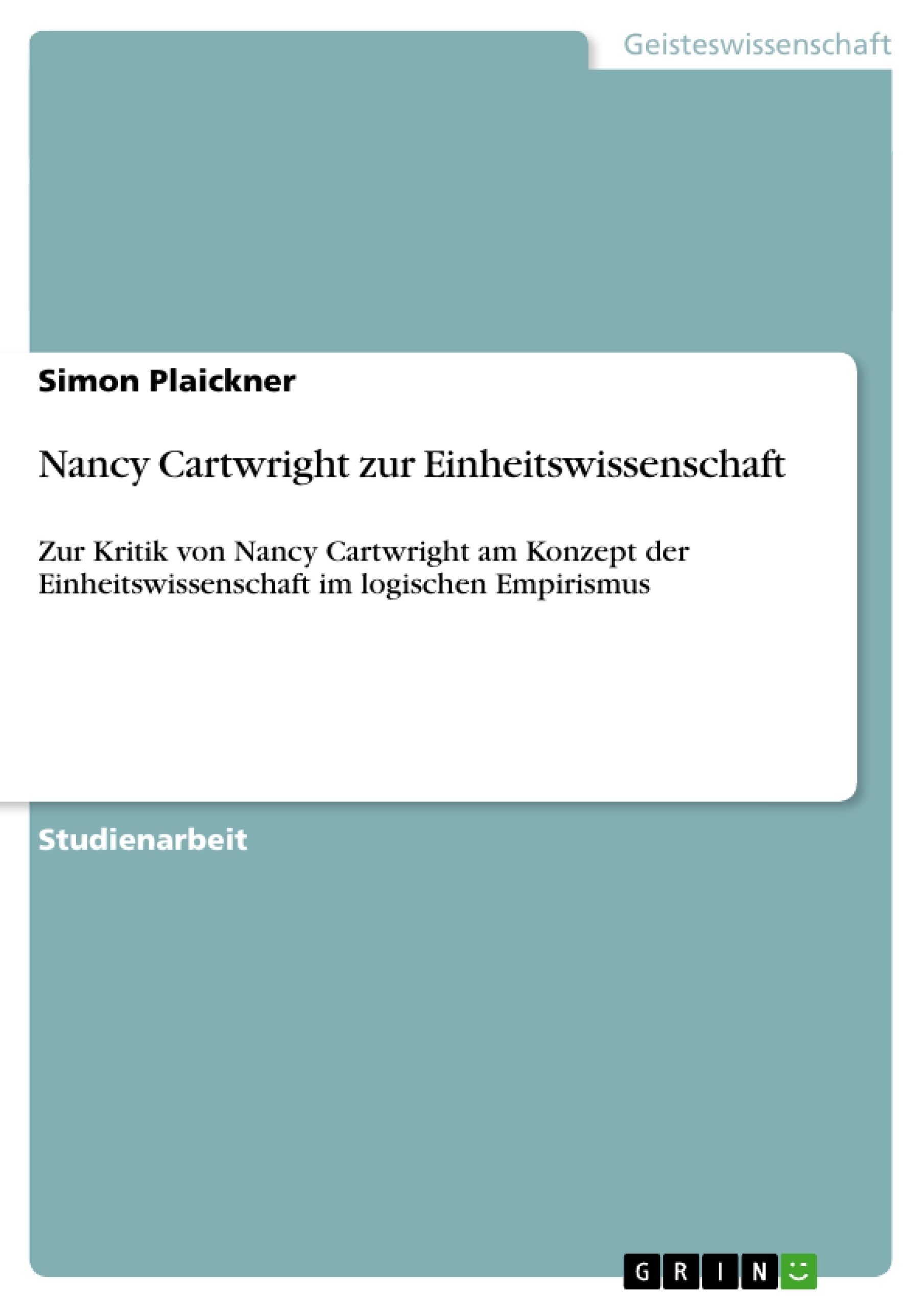Diese Arbeit setzt sich mit dem im Rahmen des Seminars Einheit der Natur und Pluralismus der Disziplinen behandelten Text von Nancy Cartwright und ihrer Kritik an der Konzeption der Wissenschaften bzw. Einheit der Wissenschaften, wie sie der Wissenschaftstheorie des logischen Empirismus entspringt, auseinander. Ziel dabei ist es die Einheitstheorien des logischen Empirismus exemplarisch darzustellen, ihnen im Anschluss die kritische Beleuchtung Cartwrights gegenüberzustellen, und im Weiteren Motive und Argumente von Cartwrights Kritik aufzuschlüsseln und gegebenenfalls auf ihre Stärken und Schwächen zu untersuchen.
Einleitung
Die vorliegenden Ausführungen untersuchen die wissenschaftstheoretische Kritik bzw. die wissenschaftstheoretisch anderweitig orientierte Position und Argumentation von Nancy Cartwright in Bezug auf die Konzeption der Einheit der Wissenschaft, wie sie im logischen Empirismus zu finden ist. Bevor Cartwrights Ausarbeitungen zu diesem Aspekt untersucht und diskutiert werden, ist es notwendig im Vorfeld andere Standpunkte aus wissenschaftstheoretischem Blick zu einer solchen Einheit, nämlich die des logischen Empirismus, einer Betrachtung zu unterziehen und anhand exemplarischer Beispiele aus dem Umfeld des Wiener Kreis oder auch der Berliner Gesellschaft für empirische Philosophie zu verdeutlichen, welche verschiedenen Ansätze und dazugehörenden Implikationen zur Einheit in der Wissenschaft in dieser wissenschaftstheoretischen Position ausgearbeitet bzw. angestrebt wurden. Dabei ist festzuhalten, dass der logische Empirismus kein „fertiges oder ... der Vollendung fähiges systematisches Lehrgebäude“ sondern eine „Abfolge logisch-empiristischer Systementwürfe“ (Tuschling et al. 1983, 5) darstellt, von denen hier die Entwürfe, die in Bezug mit Einheit der Wissenschaft stehen, relevant sind. Im Anschluss darauf soll gezeigt werden warum und in welchem Ausmaß für Cartwright die Ansätze im logischen Empirismus zur Einheitswissenschaft nicht akzeptabel bzw. kritikwürdig oder irrelevant sind.
Dabei soll auch der allgemeine Standpunkt von Nancy Cartwirght in der Wissenschaftsphilosophie, also auch der abseits des Einheitsdiskurses, eine Rolle spielen und in dieser Arbeit berücksichtigt sowie diskutiert werden; in diesem Zusammenhang wird auch die zentrale Relevanz der Physik als Wissenschaft und ihr Platz in der Debatte um (vor allem reduktionistische) wissenschaftliche Einheitskonzeptionen, sowie auch für den wissenschaftsphilosophischen Standpunkt von Nancy Cartwright von Interesse sein. Basierend auf diesen Betrachtungen sollte es möglich sein, resümierend die Position Cartwrights, den wissenschaftstheoretischen Positionen und Einheitskonzeptionen des logischen Empirismus in gewissem Sinne gegenüberstehend, einer Evaluation bzw. Diskussion in Hinblick auf eventuelle Kritikpunkte auf den sich gegenüberstehenden Seiten zu unterziehen.
Zur Einheit der Wissenschaft im logischen Empirismus
Wirft man einen Blick auf die Geschichte, so ist der Gedanke von Einheit des Wissens bzw. das Streben nach einer solchen Einheit bereits weit vor der wissenschaftstheoretischen Position des logischen Empirismus (logischer Positivismus oder Neopositivismus), die wohl zu den einflussreichsten und wichtigsten des zwanzigsten Jahrhunderts gehört und ihre Wurzeln im Wiener Kreis in den frühen Zwanzigerjahren hat, zu finden. Bechtel und Hamilton (2007) geben dazu einen geschichtlichen Überblick, der bereits bei der Einteilung in theoretische, praktische und produktive Wissenschaften von Aristoteles beginnt, über die französischen Enzyklopädisten Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, Lorenz Okens systematische Einheit Anfang des achtzehnten Jahrhunderts (Lehrbuch der Naturphilosophie), bis hin zu den hier besonders relevanten Ansätzen der späteren International Encyclopedia of Unified Science, die dem logischen Empirismus entwachsen ist; bei diesem letzteren Schritt ist vor allem wichtig, dass „Whereas Oken attempted to build unity in terms of conceptual (semantic) ideas, other approaches to systematizing knowledge appealed to logic (syntax) for the bridges between bodies of knowledge“ (Bechtel et al. 2007, 380), was mit dem Wiener Kreis Anfang der 1920er quasi die Geburtsstunde dessen, was heute als logischer Empirismus bezeichnet wird, markiert.
Dabei wurde das geschichtliche Fundament des logischen Empirismus bzw. der Begriff des Positivismus von August Comte und seiner Skepsis gegenüber vor allem der metaphysischen Philosophie und dem Fokus auf positives, also erfahr- und observierbares Wissen, bereits Anfang des neunzehnten Jahrhunderts gelegt. Eine weitere signifikante Einflussgröße ist, so betont Bechtel (et al. 2007, 380), auch der Positivismus bzw. radikale Empirismus von Ernst Mach, der sinnliche Erfahrung zur einzigen Wissensquelle und wissenschaftliche Gesetze in einem instrumentellen Sinn zur Beschreibung des sinnlich Erfahrbaren (und nichts Anderem) erklärt, und der von vielen
Vertretern des logischen Empirismus, wenn auch hauptsächlich in seiner experimentellen Begründung von Wissen und nicht in seiner instrumentellen Radikalität, adaptiert wurde. Zum Terminus logischer Empirismus schreibt Bechtel:
“The adjective logical identifies the chief resource to which the logical positivists appealed in advancing beyond individual observations to generalized scientific claims. The logic to which they appealed was not traditional Aristotelian logic, but rather the modern mathematical logic developed in the late 19th and early 20th centuries by Frege, Peano, Russell, Whitehead, and others.” (Bechtel et al. 2007, 380)
Dass der Gedanke der Einheitswissenschaft bzw. die einheitswissenschaftliche Idee keine beliebige am Rande liegende Konsequenz, sondern eine fundamental zentrale Bedeutung im logischen Empirismus hat, zeigt Rainer Hegselmann (1992) in seiner Untersuchung der theoretischen Identität dieser Wissenschaftsposition. Sein Blick auf die Entstehung des logischen Empirismus gibt Aufschluss über diese zentrale Bedeutung. So fällt der Ursprung nicht ohne Grund in einen Abschnitt der Geschichte, in dem vor allem auf den naturwissenschaftlichen Gebieten wie der Physik oder der Mathematik enorme Fortschritte verzeichnet werden konnten und so sollte sich auch die Philosophie, nachdem die synthetischen Urteile Apriori der Kantischen Transzendentalphilosophie als gescheitert erklärt waren, nach den „in den Einzelwissenschaften wirkenden Rationalitätsprinzipien richten“. Daraus ergeben sich, wie Hegselmann (1992, 8-9) ausführt zwei wichtige Theoreme des logischen Empirismus: Das Basistheorem (Erkenntnis nur durch Erfahrung) sowie das Sinntheorem (Unterscheidung zwischen sinnvollen und Scheinsätzen; wahr oder falsch können nur analytische empirische Sätze sein).
Als Konsequenz richtet man sich also gezielt kritisch gegen die traditionelle Metaphysik, deren Überwindung zum einen, zum anderen aber auch das Anstreben einer Einheitswissenschaft zu den Folgen gehören. Zu dieser Wende der Philosophie, in der vor allem der Wiener Kreis um Vertreter wie Carnap, Neurath oder Hahn eine zentrale Position einnimmt, schreibt Oliver Feldmann (1983, 13) etwa, dass „Die bisherige Philosophie, zu deren Revolution der Wiener Kreis angetreten ist, ... sich diesem als ein ,Chaos der Systeme““ darstellt. „Eine Philosophie, die aus diesem unfruchtbaren Streit der Systeme‘ herauskommen und zu aufweisbaren Resultaten gelangen will, muss sich in den Dienst der Wissenschaft stellen und von dem ,ewigen Kampf ... gegen den Fortschritt der Wissenschaft ablassen“. Dieses Chaos und eine deshalb wünschenswerte Einheit bezieht sich vor allem auf Geisteswissenschaften auf der einen und Naturwissenschaften auf der anderen Seite; so betrifft der Begriff Einheitswissenschaft im Wiener Kreis vor allem die Legitimität der Gesamtheit der Sätze unter dem Gesichtspunkt des Basis- und Sinntheorems. Vertreter wie Carnap und Neurath favorisierten dabei zur Lösung dieses Problems die physikalistische Sprache, deren Vokabular in den Wissenschaften einheitlich zur Anwendung kommen sollte. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass diese Form von Einheit sich hauptsächlich auf die Sprache bezieht, aber noch kein direkt reduktionistischer Ansatz im nomologischen Sinne an sich ist.
„Das Programm der physikalistischen Einheitswissenschaft besagt also nicht, daß die Gesetze aller Wissenschaften auf die Gesetze der Physik zurückgeführt werden könnten, sondern leidiglich, dass die Sätze aller Wissenschaften in einer bestimmten Sprache ausgedrückt werden sollten.“ (Hegselmann 1992, 12)
Die Physik spielt allerdings, und das wird bei der späteren Betrachtung von Cartwrights Ausführungen wichtig sein, eine ganz zentrale Rolle in der Einheitskonzeption des Wiener Kreises. Diesen speziellen Status der physikalischen Sprache legte man dem Aufbau der Einheitswissenschaft zugrunde und so wurde versucht in ersten Anwendungen eine „Physikalisierung“ der Soziologie und Psychologie vorzunehmen. Zur Stützung dieser angenommenen Sonderstellung gibt es, laut Tuschling (1983, 82), zwei Formulierungen: Zum Ersten in „inhaltlicher Redeweise“ ausgedrückt, die besagt „es gebe nur eine Art von Objekten, nur eine Art von Sachverhalten, nämlich die physikalischen“, zum Zweiten die korrekte „formale Redeweise“, nach der die physikalische die einzigen Universalsprache sei, in die jeder Satz übersetzbar ist, oder, um es mit den Worten von Carnap (1934, 93) selbst auszudrücken: „All statements whether of the protocol, or of the scientific system . can be translated into the phyisical language. The physical language is therefore a universal language and, since no other is known, the language of all science“. Wissenschaftshistorisch sei der Physik, so wurde in diesem Zusammenhang angenommen, dank ihrer exakten Resultate und Methoden eine unumstrittene Vorrangstellung einzuräumen und so wurde mit dieser universellen Auffassung der physikalischen Sprache etwa versucht die Biologie auf Physik zurückzuführen oder etwa auch die Psychologie in die physikalische Sprache zu übersetzen, was auf eine behavioristische Auffassung hinläuft (Tuschling et al. 1983, 83-84). Rötzer (2003, 91-92) fasst das Postulat des Wiener Kreises in knapper Form wie folgt zusammen:
„Begriffe jeder beliebigen Einzelwissenschaft - unter Ausschluss der Metaphysik - [seien] von der Mathematik bis zur Sozialwissenschaft ohne Verlust ihrer Aussagekraft und Eigenständigkeit in das Begriffssystem einer Basiswissenschaft zu übersetzen ... Als Basiswissenschaft sollte die Physik dienen. Mit Hilfe ihres Begriffssystems, das die Reduktionsebene darstellte, ließ sich die Einheitswissenschaft bzw. Gesamtwissenschaft erstellen. Ausgangspunkt war die Annahme, dass sämtliche materielle Gegebenheiten sich nur in quantitativer und nicht in qualitativer Hinsicht unterscheiden. Als Gegenstand der Wissenschaft wurden nur materielle Gegenstände anerkannt.“
Im Weiteren soll an dieser Stelle, nachdem das wissenschaftstheoretische Einheitskonzept im Wiener Kreis grob umrissen wurde, eine Konzeption von Einheit gezeigt werden, wie sie bei Paul Oppenheim und Hillary Putnam in ihrer Arbeit Einheit der Wissenschaft als Arbeitshypothese von 1958 gezeichnet wird, und die einen noch direkteren und reduktionistischeren Bezug zur Physik im nomologischen Sinn herstellt. Oppenheim war deutscher Chemiker und Philosoph und stand vor allem mit der Berliner Gesellschaft für empirische Philosophie (oder Berlin Circle) in Verbindung, die wie der Wiener Kreis im Zeichen des logischen Empirismus und dessen Ausbreitung in den Zwanzigerjahren steht. Sein wohl prominentestes Werk ist das zusammen mit Carl Gustav Hempel vorgeschlagene deduktiv-nomologische (kurz D-N Modell) Erklärungsmodell, welches besagt dass, um es möglichst knapp auszudrücken, jedem observierten Phänomen ein experimentelles (observiertes) oder theoretisches (mit abstrakten Entitäten wie Kraft oder Masse wie beispielsweise in der klassischen Mechanik) Gesetz zugrunde liegen müsse, dessen Erklärungskraft zu neuen
Aussagen und Vorhersagen dient. So formulieren Oppenheim und Hempel (1984, 136) selbst etwa, dass „the question ,Why does the phenomenon happen? ‘ is construed as meaning ‘according to what general laws, and by virtue of what antecedent conditions does the phenomenon occur?’”. Bechtel (2007, 384) formuliert die Konsequenz dieses Models für den Logischen Empirismus etwa so:
“To account for the relations between the laws or theories of different sciences, the logical empiricists proposed simply generalizing this account, and argued that it should be possible to derive the laws or theories of one discipline or science from those of another.”
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text?
Der Text untersucht die wissenschaftstheoretische Kritik von Nancy Cartwright an der Konzeption der Einheit der Wissenschaft, wie sie im logischen Empirismus vertreten wird. Zunächst werden die Standpunkte des logischen Empirismus zur Einheit der Wissenschaft erläutert, bevor Cartwrights Kritik und Alternativen diskutiert werden.
Was ist der logische Empirismus?
Der logische Empirismus (auch logischer Positivismus oder Neopositivismus genannt) ist eine einflussreiche wissenschaftstheoretische Position des 20. Jahrhunderts, die im Wiener Kreis ihren Ursprung hat. Er basiert auf der Idee, dass Erkenntnis nur durch Erfahrung möglich ist und dass nur analytische und empirische Sätze sinnvoll sind. Ziel war die Überwindung der Metaphysik und das Anstreben einer Einheitswissenschaft.
Welche Rolle spielt die Einheit der Wissenschaft im logischen Empirismus?
Die Idee der Einheitswissenschaft ist von zentraler Bedeutung für den logischen Empirismus. Sie zielt darauf ab, die verschiedenen Wissenschaften unter einem einheitlichen wissenschaftstheoretischen Rahmen zu vereinen und die Legitimität der Sätze unter dem Gesichtspunkt des Basis- und Sinntheorems zu gewährleisten.
Was ist die physikalistische Sprache im Kontext des logischen Empirismus?
Vertreter des logischen Empirismus wie Carnap und Neurath favorisierten die physikalistische Sprache, um die Einheit der Wissenschaft zu erreichen. Sie argumentierten, dass das Vokabular der Physik einheitlich in allen Wissenschaften verwendet werden sollte, was aber noch kein reduktionistischer Ansatz war.
Welche Rolle spielt die Physik in der Einheitskonzeption des Wiener Kreises?
Die Physik spielt eine zentrale Rolle in der Einheitskonzeption des Wiener Kreises. Ihre exakten Resultate und Methoden wurden als Vorbild für andere Wissenschaften angesehen, und es wurde versucht, andere Disziplinen, wie z.B. die Biologie oder Psychologie, auf die Physik zurückzuführen oder in die physikalische Sprache zu übersetzen.
Wer sind Paul Oppenheim und Hillary Putnam und was ist ihr Beitrag zur Diskussion um die Einheit der Wissenschaft?
Paul Oppenheim und Hillary Putnam haben in ihrer Arbeit "Einheit der Wissenschaft als Arbeitshypothese" (1958) ein reduktionistischeres Konzept der Einheit vorgestellt. Sie unterschieden drei Arten von Einheit, wobei die stärkste Form die Reduktion aller Gesetze auf jene einer einzigen Disziplin (Physik) beinhaltet.
Was ist das deduktiv-nomologische (D-N) Modell von Hempel und Oppenheim?
Das deduktiv-nomologische (D-N) Modell besagt, dass jedem beobachteten Phänomen ein experimentelles oder theoretisches Gesetz zugrunde liegen muss, dessen Erklärungskraft zu neuen Aussagen und Vorhersagen dient.
Was ist Nancy Cartwrights Position zur Einheit der Wissenschaft?
Der Text kündigt an, dass Nancy Cartwrights Kritik an den Ansätzen des logischen Empirismus zur Einheitswissenschaft untersucht wird. Ihre allgemeine wissenschaftsphilosophische Position, insbesondere die Relevanz der Physik, soll dabei ebenfalls berücksichtigt werden.
Welche Kritikpunkte könnten an den Positionen des logischen Empirismus und Cartwrights geäußert werden?
Der Text deutet an, dass nach der Darstellung der verschiedenen Positionen eine Evaluation und Diskussion in Hinblick auf eventuelle Kritikpunkte auf den sich gegenüberstehenden Seiten erfolgen soll.
- Quote paper
- Simon Plaickner (Author), 2010, Nancy Cartwright zur Einheitswissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164504