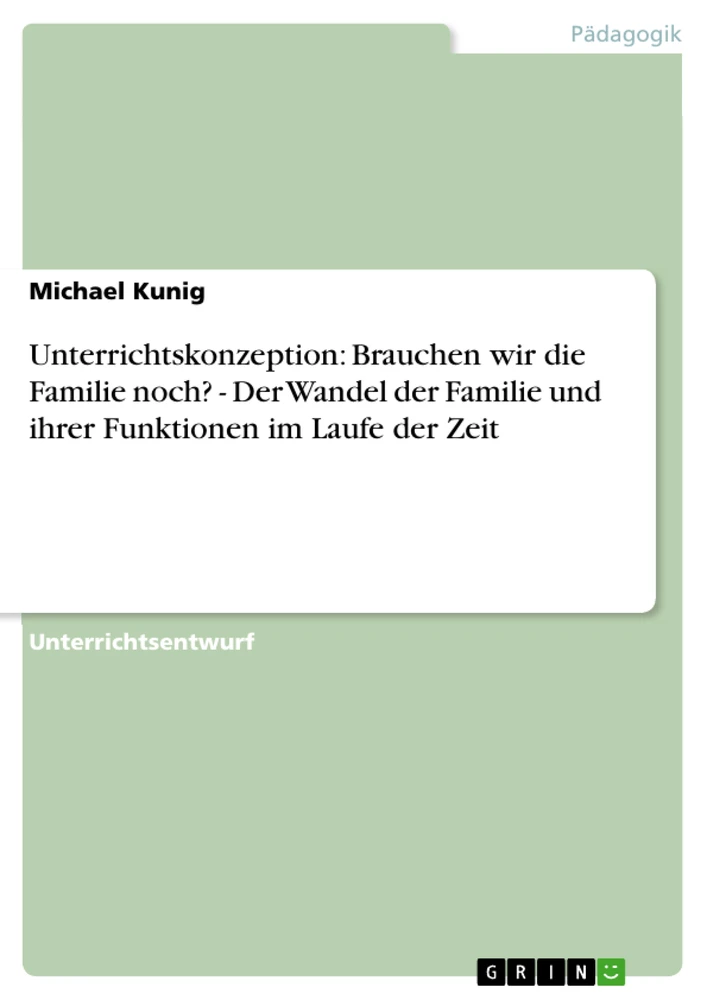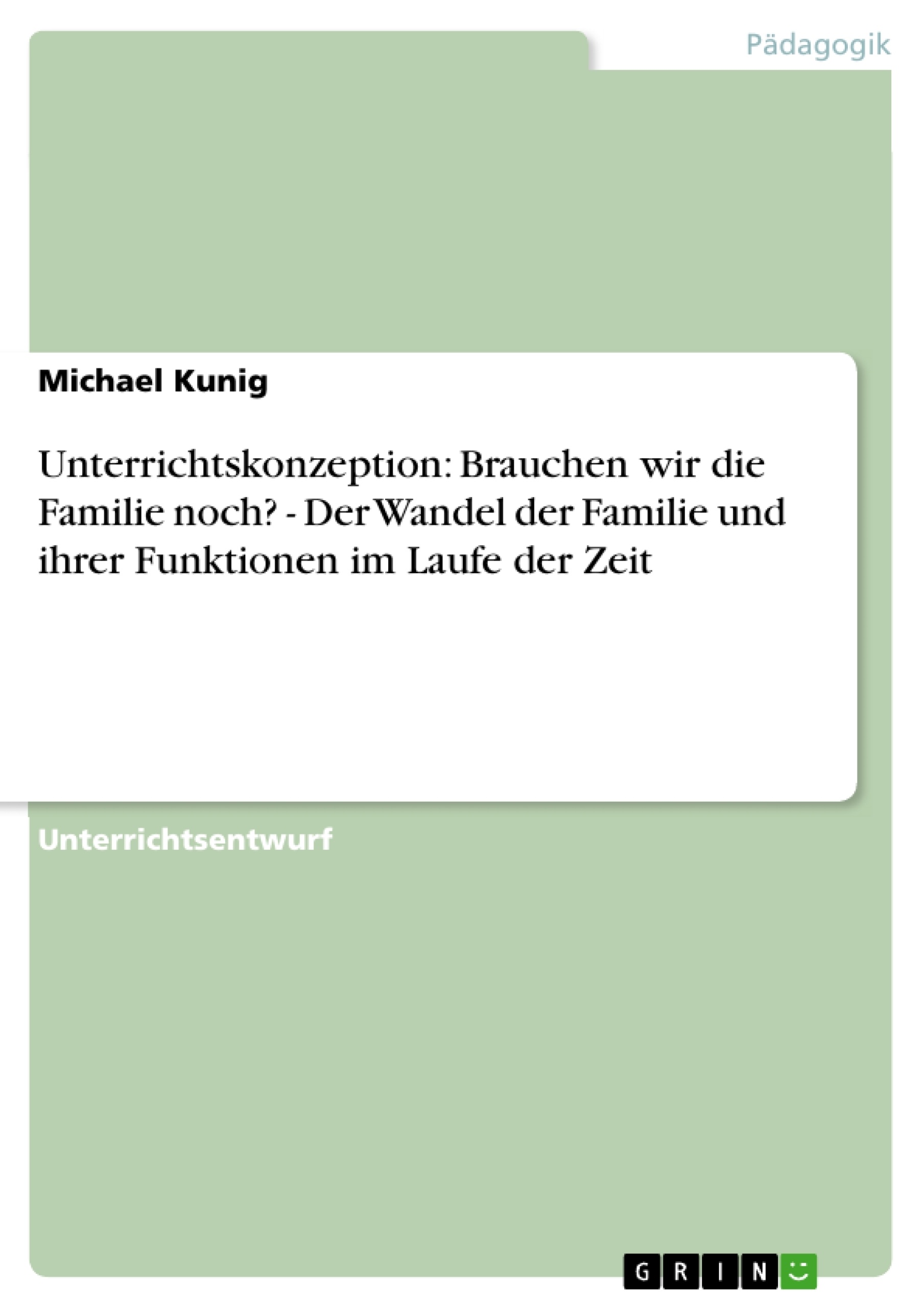Seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ist die Familie in den Industriegesellschaften stetigen Wandlungsprozessen unterworfen. Die Lebensläufe der einzelnen Individuen sind nicht mehr standardisiert wie noch vor fünfzig Jahren. Damals folgte auf den Schulabschluss eine relativ schnelle, feste Bindung an einen Partner, die Ablösung vom Elternhaus, die Heirat und schließlich die Geburt des ersten Kindes. Männer waren für die Existenzsicherung zuständig und Frauen beschränkten sich auf ihr Dasein als Hausfrau und Mutter. Seit dem haben sich nicht nur die Familienformen ge-wandelt, sondern auch die Lebensentwürfe der Menschen. Es gibt mehr Wahlmög-lichkeiten in beruflichen und privaten Lebensabschnitten. Nach Ulrich Beck ist nicht mehr sicher, „ob man heiratet, wann man heiratet, ob man zusammenlebt, ob man das Kind innerhalb oder außerhalb der Familie empfängt oder aufzieht, mit dem den man liebt, der aber mit einer anderen zusammenlebt, vor oder nach der Karriere oder mittendrin.“
Trotz des enormen Wandels hat sich die Bedeutung der Familie kaum verändert. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung finden, dass die Familie zum Glücklichsein dazu gehört.
Vor diesem Hintergrund ist es für Schüler wichtig den Wandlungsprozess der Familie zu verstehen und ihre Funktionen in den Sozialisationsprozess einordnen zu können. Die folgende Sachanalyse bietet einen Hintergrund zur dargestellten Unterrichtseinheit und stellt die Ursachen des Wandels, sowie dessen Folgen dar. Dabei stützt sich der Autor vornehmlich auf Rüdiger Peuckert: „Familienformen im sozialen Wandel“.
Inhaltsverzeichnis
- SACHANALYSE
- EINLEITUNG
- EHE UND FAMILIE IM UMBRUCH
- DER DEMOGRAPHISCHE WANDEL
- STRUKTURWANDEL DER FAMILIE
- THEORETISCHE ERKLÄRUNGSANSÄTZE
- SCHLUSSBEMERKUNG
- LERNZIELE
- BEDINGUNGSANALYSE
- STUNDENVERLAUFSPLAN
- DIDAKTISCHE ANALYSE
- DIE DIDAKTISCHE REDUKTION
- EINORDNUNG IN DEN LEHRPLAN
- DIDAKTISCHE PRINZIPIEN
- DIE BEDEUTUNG DES THEMAS FÜR DIE SCHÜLER
- BEGRÜNDUNG FÜR METHODEN UND MEDIEN
- LITERATUR
- ANHANG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtskonzeption "Brauchen wir die Familie noch?" analysiert die Veränderungen der Familie im Laufe der Zeit und zeigt die unterschiedlichen Funktionen der Familie im Sozialisationsprozess auf. Ziel ist es, den Schülern ein tieferes Verständnis für den Wandel der Familienformen und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben, zu vermitteln.
- Wandel der Familienformen und deren Ursachen
- Der Einfluss des demografischen Wandels auf die Familie
- Die Funktionen der Familie im Sozialisationsprozess
- Theoretische Ansätze zur Erklärung des Familienwandels
- Die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Familienwandels seit den 1960er Jahren dar und verdeutlicht die Bedeutung des Themas für die Schüler.
- Ehe und Familie im Umbruch: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Familie von der Produktionsstätte zur emotionalen Einheit und zeigt die Auswirkungen der Industrialisierung und des Wirtschaftswunders auf die Familienstrukturen.
- Der demographische Wandel: In diesem Kapitel werden die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Familie, wie zum Beispiel sinkende Geburtenzahlen und steigende Scheidungsraten, analysiert.
- Strukturwandel der Familie: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Ursachen des Familienwandels und geht auf die unterschiedlichen Familienformen ein, die heute existieren.
- Theoretische Erklärungsansätze: Dieses Kapitel stellt verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung des Familienwandels vor, beispielsweise die Deinstitutionalisierungstheorie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Familienwandel, Familienformen, Sozialisation, Industrialisierung, demografischer Wandel, Deinstitutionalisierung, theoretische Erklärungsansätze, und die Bedeutung der Familie für die Gesellschaft.
- Quote paper
- Michael Kunig (Author), 2009, Unterrichtskonzeption: Brauchen wir die Familie noch? - Der Wandel der Familie und ihrer Funktionen im Laufe der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164451