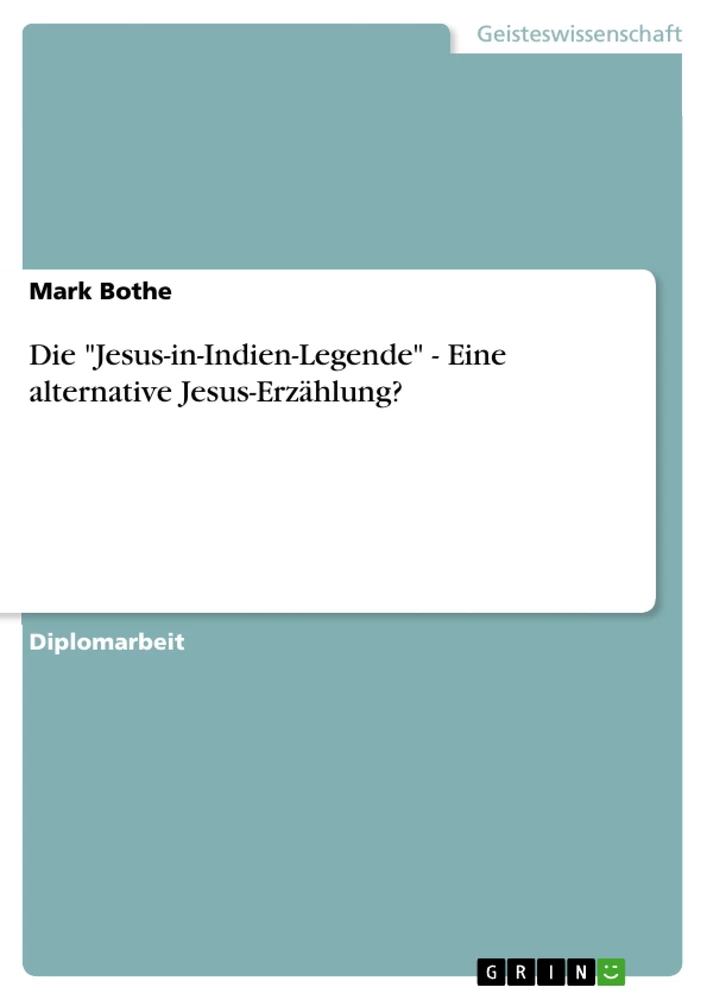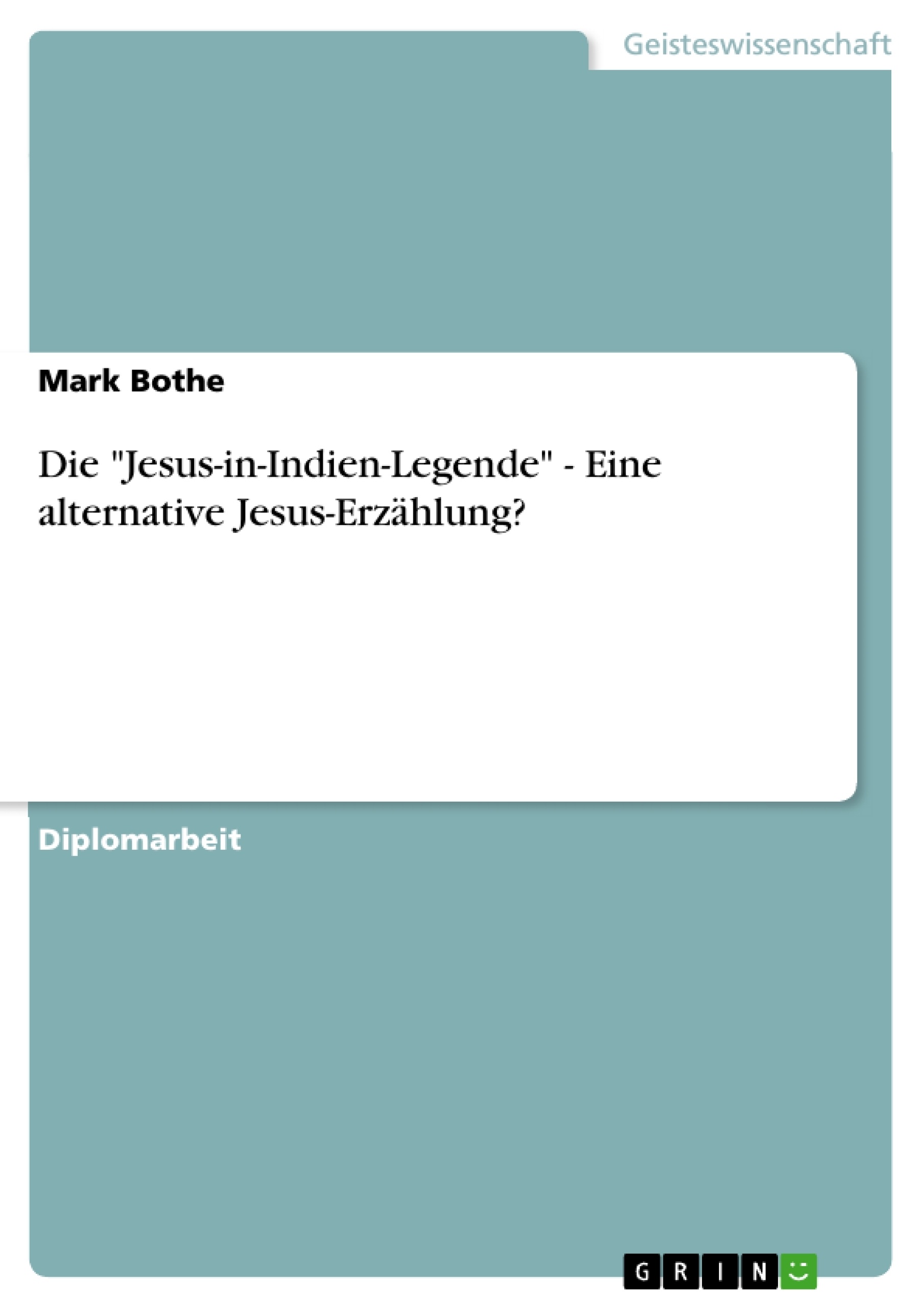„Wie Jesus wirklich starb“ – so titelte der FOCUS im April 2010 kurz vor Ostern. Und die P.M.-History behandelte in einem Sonderteil „Das Geheimnis des Jesus von Nazareth“. Tatsächlich wird kaum eine Person so intensiv be- und durchleuchtet wie die des Jesus von Nazareth. Bemerkenswert ist dabei jedoch, dass sich das Interesse nur selten auf die für die Theologie relevanten Fragestellungen nach etwa dem christologischen Selbstverständnis oder dem messianischen Anspruch Jesu richtet. Es geht vielmehr immer um die Person, um den Mann aus Nazareth und die Frage, wie er wirklich war. Hier wird „ […] von vornherein eine Differenz statuiert zwischen dem Jesus, von dem die neutestamentlichen Schriften, besonders die Evangelien erzählen – darauf basiert die kirchliche Verkündigung – und Jesus als einer historischen Gestalt.“ Dabei distanzieren sich solche Betrachtungen dezidiert von kirchlichen und theologischen Jesusbildern. Der Fragehorizont ist ein gänzlich anderer geworden, wie auch der Untertitel zur FOCUS-Ausgabe zeigt: „… und das Geheimnis um das Turiner Grabtuch“. Das Leben des Jesus von Nazareth wird als Kriminalgeschichte präsentiert, der es Geheimnisse zu entlocken gilt. Waren es lange Zeit allein Geisteswissenschaftler die sich mit der Leben-Jesu-Forschung beschäftigten, so ist der gesamte Komplex teilweise in ein neureligiös-esoterisches Feld abgewandert. In genau diesem neureligiös-esoterischen Feld ist die Jesus-in-Indien-Legende (im Folgenden kurz: JiIL) anzusiedeln. Ihre Ursprünge liegen in den Offenbarungen des Gründers der indisch-islamischen Ahmadiyya-Bewegung, die als erste die Auffassung vertrat, Jesus habe seine Kreuzigung überlebt, mit dem Ziel, seinen Anspruch als Mahdî und Messias zu festigen. Ungeachtet dieses Zusammenhangs wanderte die Idee von der überlebten Kreuzigung und mit ihr die Überzeugung, Jesus habe Indien besucht, nach Europa ein, wo sie auf ein geistiges Milieu stieß, das es ihr erlaubte, zu einer Form der Neuinterpretation des Lebens Jesu und schließlich der gesamten jüdisch-christlichen Geschichte zu werden. Erstaunlich dabei ist, dass es gerade trotz dieser Ursprünge zur Ausformung der modernen JiIL kommen konnte. Denn die heutige Form ignoriert, dass eine solche Geschichte und Quellenlage keine neutral-wissenschaftlichen Beweise ermöglichen, die jedoch von den Vertretern immer wieder behauptet werden. Auf diese Weise lässt sich bei der JiIL durchaus von einer Form post-moderner Wissenschafts-Religiosität sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Jesus in Indien - die Anfänge
- 1.1 Jesus in Indien - Legende oder Theorie? Das Problem der Bezeichnung
- 1.2 Die erste Phase: Ursprung und erste Autoren
- 1.2.1 Ghulam Ahmad - Jesus starb in Indien
- 1.2.2 Levi Dowling - Das Wassermann-Evangelium
- 1.2.3 Nicolas Notovitch
- 1.2.4 The Crucifixion by an Eye-Witness
- 1.2.5 Fazit: Jesus in Indien - ein Gedanke aus vielen Anfängen
- 1.3 Die zweite Phase: Al-Haj Khwaja Nazir Ahmad – Jesus in Heaven on Earth
- 1.4 Die dritte Phase: Jesus-in-Indien heute – Wandlung zur Kaschmir-Theorie
- 1.4.1 Andreas Faber-Kaiser
- 1.4.2 Fida Hassnain
- 1.4.3 Holger Kersten
- 1.4.4 Obermeier, Choudhury, Goeckel
- a) Helmut Goeckel
- b) Siegfried Obermeier
- c) Paramesh Choudhury
- 1.4.5 Fazit: Jesus als der neue Buddha - die Jill als Kaschmir-Theorie
- 2 Literaturkritik: Die Erzählstruktur der Jill
- 2.1 Die Wahrheit der frühen Zeugnisse
- Exkurs: Antijüdische Tendenzen in der Jill
- 2.2 Aura der Plausibilität
- a) Glaubwürdigkeitsverstärkung
- b) Anspruch der Wissenschaftlichkeit
- 2.3 Ähnlichkeitsbeweise
- 2.4 Die Jill als Kriminalgeschichte und die Kirche als Gegner
- 2.5 Sprachvergleiche
- 2.6 Quellen
- 2.6.1 Biblische Schriften
- a) Das Alte Testament
- Das Neue Testament
- 2.6.2 Apokryphe Schriften
- a) Die Thomasakten und das Thomasevangelium
- b) Die Schriftrollen von Qumran
- 2.6.3 Orientalische Quellen
- a) Das,,Rauzat-us-Safa”
- b) Das,,Bhaviṣyapurāṇa”
- c) „Rājatarangiṇī”
- d) Der Koran
- 2.6.4. Weitere Quellen
- 2.7 Fazit - Die Methodik der Jill
- 3 Die Jill
- 3.1 Kritik an der Jill
- 3.1.1 Art und Herkunft der Quellen
- a) "The Crucifixion by an Eye-Witness"
- b) Das,,Leben des St. Issa”
- c) Der,,Pilatusbrief”
- 3.1.2 Die Verwendung der Quellen
- a) Das,,Bhaviṣyapurāṇa”
- b) Die Wortvergleiche
- c) Yuz Asaf und das Grab in Srinagar
- 3.2 Die JilL und ihre Motivation
- 3.2.1 Die Selbst-Einordnung der JilL-Autoren
- a) Kersten
- b) Goeckel
- c) Hassnain
- d) Faber-Kaiser
- 3.2.2 Die Fremd-Einordnung der Kritiker
- a) Günter Grönbold, Roman Heiligenthal - Die Jill als Ergebnis der Indienschwärmerei des 19. Jahrhunderts und der Theosophie
- b) Norbert Klatt - Die Jill als Produkt einer neuen Religiosität Indiens
- c) Per Beskow - Die Jill als eine Idee des Unterbewussten
- 3.2.3 Versuch einer weiteren Perspektive: Die JilL - ein Zeichen für eine sich verändernde Religiosität
- a) Religion in der Post-Moderne
- b) Die Jill vor dem Hintergrund einer pluralen und individuellen Religiosität
- Die historische Entwicklung der Jill
- Die verschiedenen Autoren und ihre Motivationen, die Jill zu verbreiten
- Die Kritik an der Jill aus theologischer, historischer und wissenschaftlicher Sicht
- Die Bedeutung der Jill im Kontext einer sich wandelnden Religiosität
- Die Rolle der Jill im Spannungsfeld zwischen Religion und Kultur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der „Jesus-in-Indien-Legende“ (Jill), einer alternative Jesus-Erzählung, die behauptet, Jesus sei nach seiner Kreuzigung nicht gestorben, sondern nach Indien gereist und dort gelebt. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Verbreitung dieser Legende sowie ihre Rezeption in verschiedenen Kontexten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung, die die Relevanz der Thematik und die Fragestellung der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Anfänge der Jill im Kapitel 1 vorgestellt. Dieses Kapitel beleuchtet die ersten Autoren und ihre Thesen sowie die Entwicklung der Jill von einer Theorie zu einer Kaschmir-Theorie. Kapitel 2 analysiert die Erzählstruktur der Jill und stellt die Methodik der Jill-Autoren in Frage. In Kapitel 3 wird die Jill aus religionssoziologischer und -historischer Perspektive betrachtet. Hier werden die Kritik an der Jill und ihre Motivationen analysiert. Die Arbeit wird durch eine Schlussbetrachtung abgerundet.
Schlüsselwörter
Jesus-in-Indien-Legende, alternative Jesus-Erzählung, Kaschmir-Theorie, historische Jesusforschung, religionssoziologie, Religionsgeschichte, Quellenkritik, Literaturkritik, postmoderne Religiosität.
- Quote paper
- Mark Bothe (Author), 2010, Die "Jesus-in-Indien-Legende" - Eine alternative Jesus-Erzählung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164413