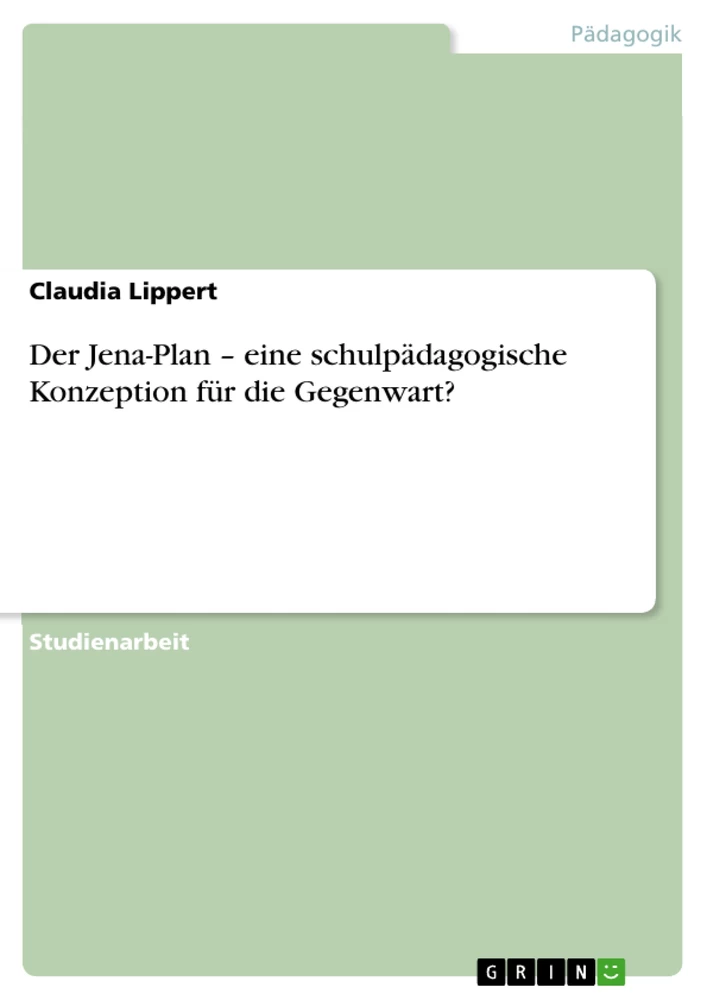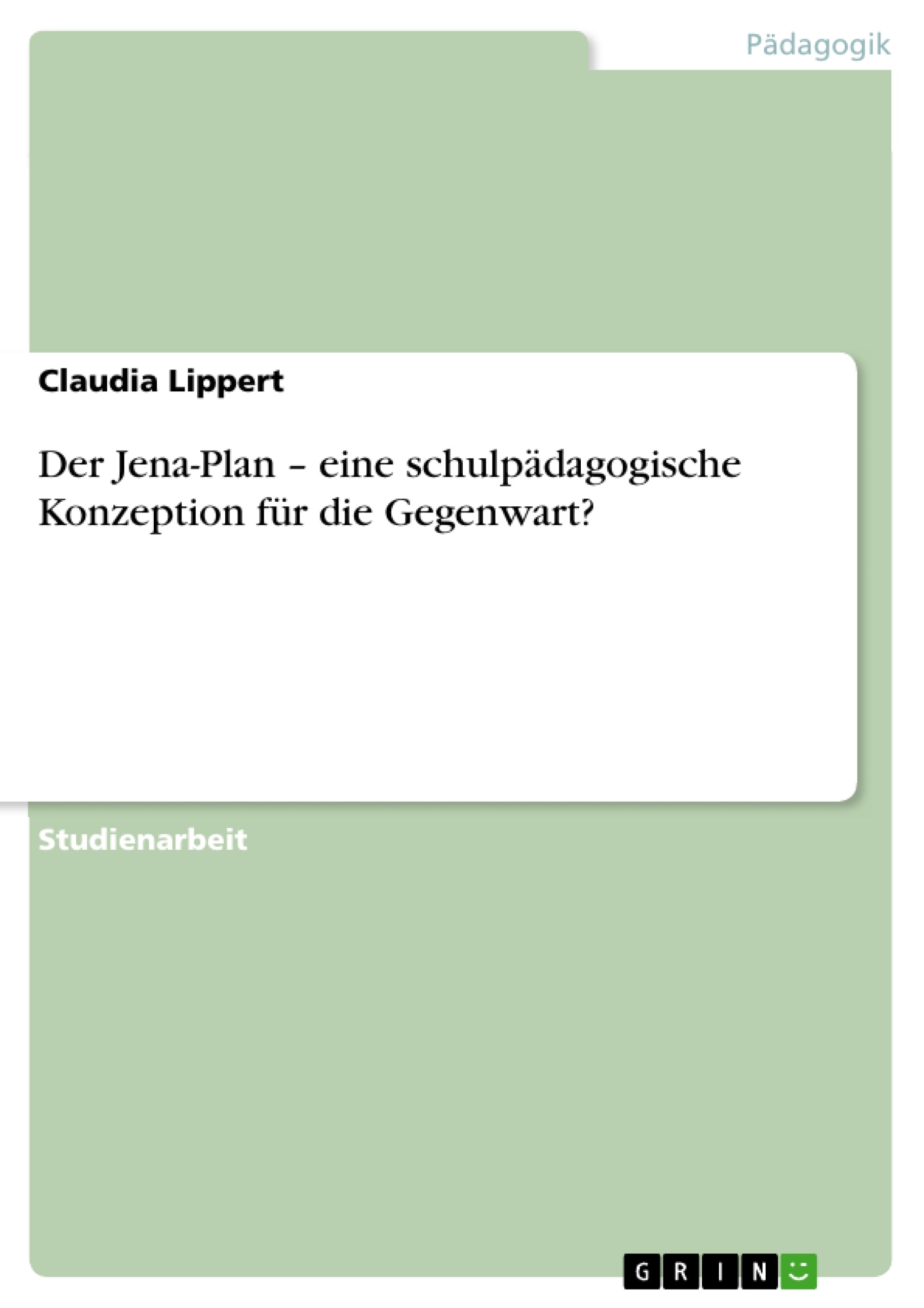In Europa und auch in Deutschland steigt in den letzten Jahren immer mehr das Interesse von Eltern und Lehrern an reformpädagogischen Schulmodellen.
Im Mittelpunkt dieser reformpädagogischen Konzepte steht eine „Pädagogik vom Kinde aus“. Pädagogische Prinzipien dieser Bildungskonzepte sind u.a. Selbstständigkeit, Mitbestimmung, Eigenverantwortung und selbst bestimmtes Lernen. Ziel ist es, das Kind bei der Entwicklung und Entfaltung seiner Individualität und Persönlichkeit zu unterstützen.
Eines der bedeutsamsten reformpädagogischen Modelle des 20. Jahrhunderts ist der Jena-Plan von Peter Petersen. Es bietet eine mögliche Ausgangsform für die Gestaltung der Schule von heute. In diesem Ansatz geht es um die Gestaltung eines anregungsreichen und nach vielen Seiten hin offenen Schullebens. In Deutschland arbeiten bereits ca. 30 Schulen auf Basis des Jena-Plans (Jenaplan-Initiative Bayern e.V., 2003).
Im Rahmen meiner Hausarbeit möchte ich die schulpädagogische Konzeption „Jena-Plan“ von Peter Petersen vorstellen.
Ausgehend von einem Abriss der Entstehungsgeschichte des Jena-Plans werde ich auf theoretische Begründungen eingehen und schulpraktische Inhalte sowie konstituierende Merkmale des Konzepts beschreiben. Zum Abschluss der Arbeit möchte ich der Frage nachgehen, ob Jena-Plan-Pädagogik den Anforderungen der Schule von heute gerecht werden kann.
Die Arbeit soll einen Kurzüberblick über das reformpädagogische Modell des Jena-Plans von Peter Petersen geben und nach der Aktualität für die Schule von heute fragen.
Aufgrund des begrenzten Umfangs der Hausarbeit werde ich mich auf Ausführungen zu Petersens schulpädagogischen Konzepts beschränken und die kontroverse Diskussion über seine Rolle im Nationalsozialismus außer Acht lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte des Jena-Plans
- Der Jena-Plan von Peter Petersen
- Theoretische Grundlagen
- Grundgedanken der Erziehungslehre Peter Petersens
- Die Pädagogische Situation
- Die vier Bildungsgrundformen: Gespräch, Spiel, Arbeit und Feier
- Schulpraktische Inhalte
- Stammgruppen statt Jahrgangsklassen
- Wochenarbeitsplan statt Fetzenstundenplan
- Berichte und Erfolgserfahrungen statt Zensuren
- Gestaltung der Lernumwelt
- Theoretische Grundlagen
- Jena-Plan-Pädagogik heute
- Kritik am theoretischen Begründungskonzept
- Jena-Plan-Pädagogik als Balance zwischen Lern- und Lebenswelt in der Schule
- Der Jena-Plan als Basis für Schulentwicklung
- Jena-Plan-Pädagogik - ein schulpädagogischer Ansatz für die Gegenwart?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die schulpädagogische Konzeption des Jena-Plans von Peter Petersen. Ziel ist es, den Jena-Plan vorzustellen, seine Entstehungsgeschichte nachzuzeichnen, die theoretischen Grundlagen und schulpraktischen Inhalte zu beschreiben und schließlich seine Aktualität für die heutige Schule zu bewerten. Die kontroverse Diskussion um Petersens Rolle im Nationalsozialismus wird aus Gründen des Umfangs ausgeklammert.
- Entstehung und Entwicklung des Jena-Plans
- Theoretische Grundlagen des Jena-Plans (z.B. Pädagogische Situation, Bildungsgrundformen)
- Schulpraktische Umsetzung des Jena-Plans (z.B. Stammgruppen, Wochenarbeitsplan)
- Kritik und Weiterentwicklung des Jena-Plans
- Relevanz des Jena-Plans für die heutige Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, erläutert das steigende Interesse an reformpädagogischen Modellen und stellt den Jena-Plan als ein bedeutendes Beispiel vor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die Vorstellung des Konzepts und die Bewertung seiner Aktualität, wobei die kontroversen Aspekte um Petersens Rolle im Nationalsozialismus ausgeblendet werden. Die Arbeit beabsichtigt einen Kurzüberblick und die Beantwortung der Frage nach der Relevanz für die heutige Schule.
Entstehungsgeschichte des Jena-Plans: Dieses Kapitel beschreibt den Werdegang von Peter Petersen, seine Beteiligung an der Schulreformbewegung und die Entwicklung seiner pädagogischen Ideen an der Hamburger Lichtwark-Schule und später an der Jenaer Universitätsschule. Es wird detailliert auf die Entstehung des „Kleinen“ und „Großen“ Jena-Plans eingegangen, mit Verweis auf die internationale Konferenz in Locarno und den Einfluss anderer Reformpädagogen. Das Kapitel verdeutlicht, wie sich der Jena-Plan aus der schulpraktischen Arbeit und theoretischen Auseinandersetzung mit der Pädagogik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Es betont die Verschiebung des Fokus vom Unterrichtsstoff hin zum Kind als Ausgangspunkt aller Erziehungs- und Unterrichtsmaßnahmen.
Der Jena-Plan von Peter Petersen: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen und schulpraktischen Inhalte des Jena-Plans. Die theoretischen Grundlagen umfassen Petersens Erziehungslehre, den Begriff der Pädagogischen Situation und die vier Bildungsgrundformen (Gespräch, Spiel, Arbeit, Feier). Die schulpraktischen Inhalte werden anhand von Stammgruppen anstelle von Jahrgangsklassen, dem Wochenarbeitsplan, der Verwendung von Berichten statt Zensuren und der Gestaltung der Lernumwelt erläutert. Es wird die ganzheitliche Ausrichtung des Konzepts hervorgehoben, das das gesamte Leben in die Schule integrieren möchte.
Jena-Plan-Pädagogik heute: Dieses Kapitel befasst sich mit der Kritik am theoretischen Begründungskonzept des Jena-Plans, betrachtet den Jena-Plan als Balance zwischen Lern- und Lebenswelt und diskutiert dessen Rolle als Basis für Schulentwicklung. Es analysiert die Herausforderungen und die Anpassungsfähigkeit des Konzepts an die Anforderungen der modernen Schule. Es werden mögliche Stärken und Schwächen der Pädagogik im Kontext der heutigen Bildung diskutiert.
Schlüsselwörter
Jena-Plan, Peter Petersen, Reformpädagogik, Pädagogische Situation, Bildungsgrundformen, Ganzheitliches Lernen, Selbsttätigkeit, Schulentwicklung, Stammgruppen, Wochenarbeitsplan, Autonomie, Mitbestimmung.
Häufig gestellte Fragen zum Jena-Plan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die schulpädagogische Konzeption des Jena-Plans von Peter Petersen. Sie beschreibt dessen Entstehungsgeschichte, die theoretischen Grundlagen und schulpraktischen Inhalte und bewertet schließlich seine Aktualität für die heutige Schule. Die kontroverse Diskussion um Petersens Rolle im Nationalsozialismus wird aus Gründen des Umfangs ausgeklammert.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Entwicklung des Jena-Plans, seine theoretischen Grundlagen (Pädagogische Situation, Bildungsgrundformen), die schulpraktische Umsetzung (Stammgruppen, Wochenarbeitsplan), Kritik und Weiterentwicklung sowie die Relevanz des Jena-Plans für die heutige Schule.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung: Einführung in das Thema und Fokus der Arbeit. Entstehungsgeschichte des Jena-Plans: Werdegang von Peter Petersen, Entwicklung seiner pädagogischen Ideen und Entstehung des Jena-Plans. Der Jena-Plan von Peter Petersen: Theoretische Grundlagen (Erziehungslehre, Pädagogische Situation, Bildungsgrundformen) und schulpraktische Inhalte (Stammgruppen, Wochenarbeitsplan etc.). Jena-Plan-Pädagogik heute: Kritik, Balance zwischen Lern- und Lebenswelt, Rolle als Basis für Schulentwicklung und Anpassungsfähigkeit an die moderne Schule. Jena-Plan-Pädagogik - ein schulpädagogischer Ansatz für die Gegenwart?: Bewertung der Relevanz für die heutige Schule. Resümee: Zusammenfassung der Ergebnisse.
Was sind die zentralen theoretischen Grundlagen des Jena-Plans?
Die zentralen theoretischen Grundlagen des Jena-Plans sind Petersens Erziehungslehre, der Begriff der Pädagogischen Situation und die vier Bildungsgrundformen: Gespräch, Spiel, Arbeit und Feier. Der Jena-Plan betont ein ganzheitliches Lernen und die Integration des gesamten Lebens in die Schule.
Welche schulpraktischen Inhalte kennzeichnen den Jena-Plan?
Schulpraktische Inhalte des Jena-Plans sind unter anderem Stammgruppen statt Jahrgangsklassen, ein Wochenarbeitsplan statt eines Fetzenstundenplans, Berichte und Erfolgserfahrungen statt Zensuren und eine besonders gestaltete Lernumwelt.
Wie wird der Jena-Plan heute bewertet?
Die Arbeit analysiert die Kritik am theoretischen Begründungskonzept, betrachtet den Jena-Plan als Balance zwischen Lern- und Lebenswelt und diskutiert seine Rolle als Basis für Schulentwicklung. Es werden mögliche Stärken und Schwächen der Pädagogik im Kontext der heutigen Bildung diskutiert und die Frage nach seiner Relevanz für die Gegenwart gestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Jena-Plan?
Schlüsselwörter sind: Jena-Plan, Peter Petersen, Reformpädagogik, Pädagogische Situation, Bildungsgrundformen, Ganzheitliches Lernen, Selbsttätigkeit, Schulentwicklung, Stammgruppen, Wochenarbeitsplan, Autonomie, Mitbestimmung.
Wo finde ich weitere Informationen zum Jena-Plan?
Diese FAQ bietet eine Zusammenfassung der im Dokument präsentierten Informationen. Umfassendere Informationen können in weiterführender Literatur zum Jena-Plan und zu Peter Petersen gefunden werden.
- Quote paper
- M.A. Claudia Lippert (Author), 2005, Der Jena-Plan – eine schulpädagogische Konzeption für die Gegenwart?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164178