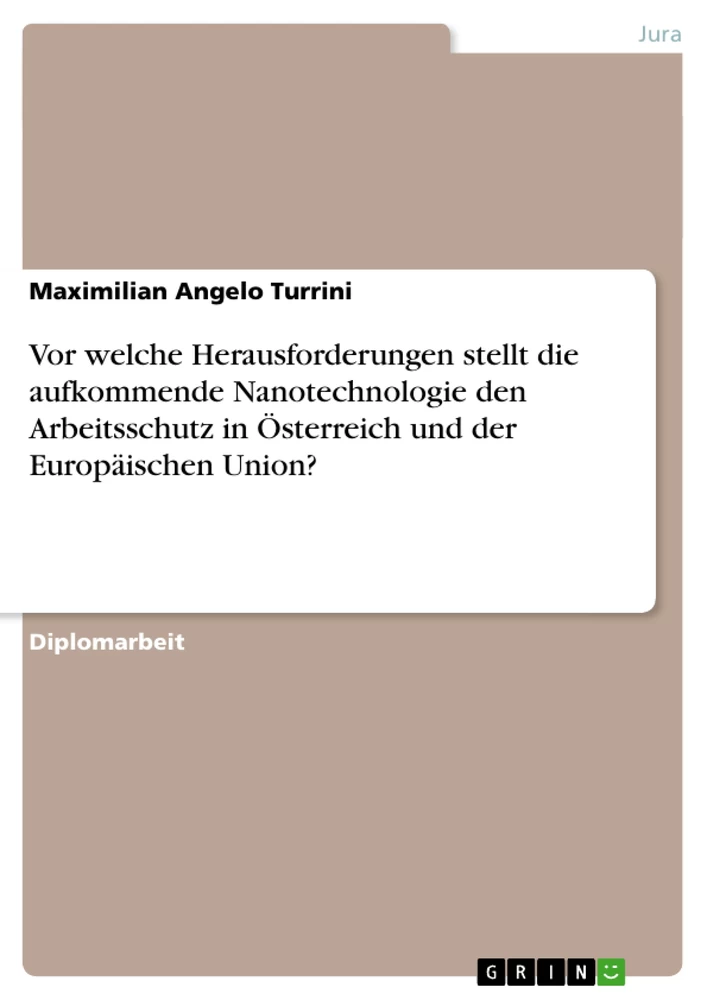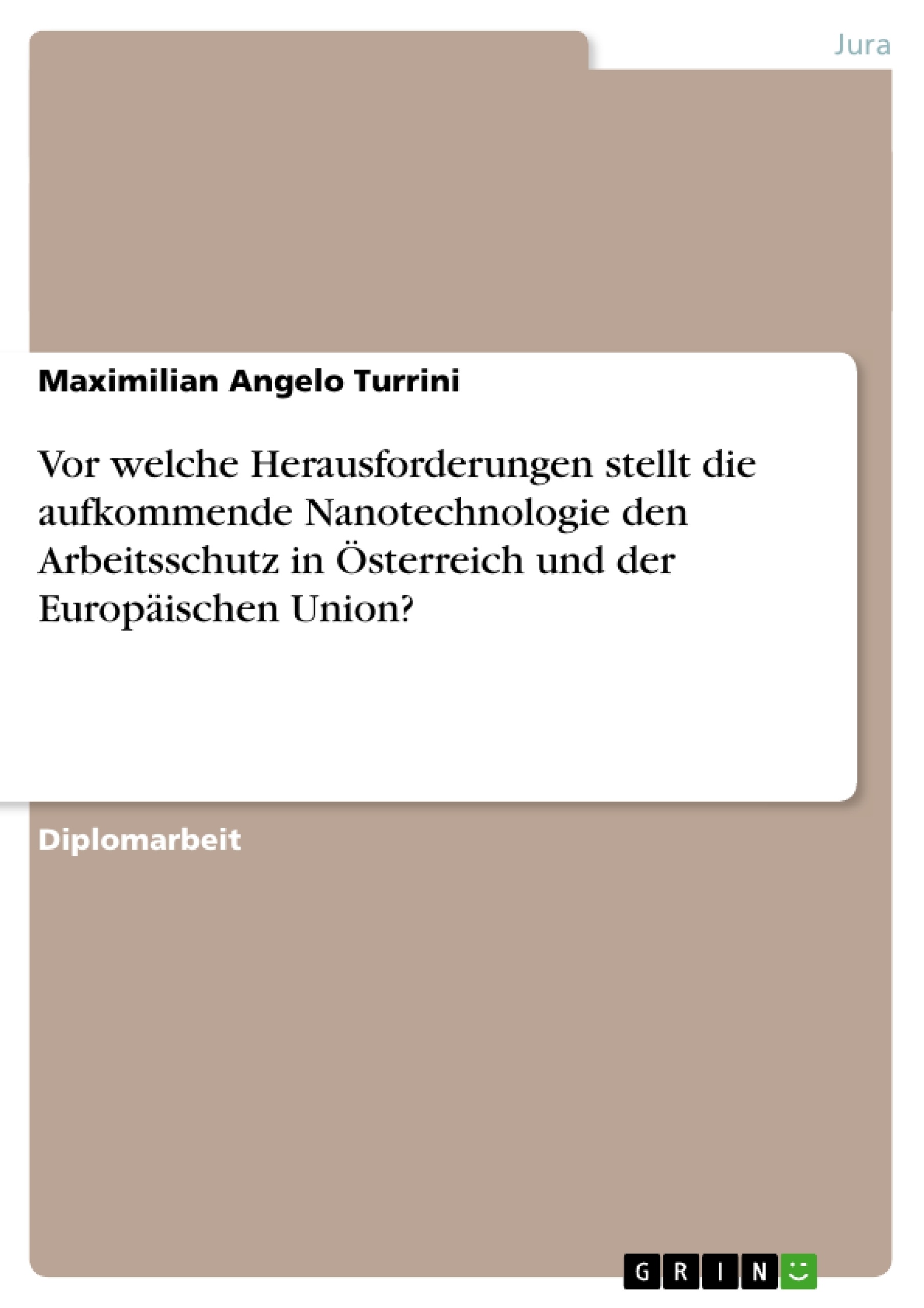Es ist der Wunsch eines jeden Menschen, nach Größerem zu streben. Die Wissenschaft jedoch löste sich bereits zu einer Zeit von dieser Vorstellung.
Mehr als 2000 Jahre nach Demokrit, dem Erfinder des Wortes Atomos fand man heraus, dass auch der Mikrokosmos riesig ist im Vergleich zu jenen Teilchen, welche den Mikrokosmos formen.
Im Rahmen der Nanowissenschaften versucht man, jene winzigen Teilchen im Nanometerbereich industriell zu verwerten. Spätestens mit dem Zeitpunkt, in dem erkannt wurde, dass Nanoteilchen ein anderes physikalisches und chemisches Verhalten darbieten als in „großer“ Form (auch hier sprechen wir von Mikrometern), wurde jene zunächst noch mystisch anmutende Wissenschaft schlagartig interessant, obgleich sie in ihrer öffentlichen Rezeption den Status des Rätselhaften noch nicht ablegen konnte.
Jede neue Technologie braucht Kontrolle, die Nanotechnologie begegnet uns sowohl in der industriellen Produktion, als auch im Haushalt oder im Krankenhaus. Im Zuge von Risikobewertungen und Technikfolgenabschätzungen werden in dieser Arbeit gesetzliche Regelungen vorgeschlagen, welche die Handhabung von Nanomaterialien in einen rechtlichen Rahmen bringen.
Gerade im Rahmen des ArbeitnehmerInnenschutzes ist es in höchstem Maße von Relevanz, die gesundheitlichen Risiken von Nanomaterialien genau zu analysieren und auf dieser Basis arbeitsrechtliche Bestimmungen zu konstruieren.
Derartige Forschungen laufen sowohl auf innerstaatlicher, als auch auf europäischer Ebene sowohl im Bereich des Chemikalienrechts, als auch im Medizinrecht, Konsumentenschutz und Arbeitsrecht.
In dieser Arbeit wird zunächst ein Einblick in die naturwissenschaftliche Dimension der Nanowissenschaften gegeben, um in einem weiteren Schritt auf die bereits bestehende österreichische und europäische Rechtslage einzugehen, wobei auch Rechtsvergleiche zu Deutschland und der Schweiz angestellt werden. Zudem werden unter Zuhilfenahme neuerer Risikoeinschätzungen eventuelle Schwachpunkte im Arbeitsschutz aufgezeigt und insgesamt der Regelungsbedarf analysiert.
Mit dieser Arbeit möchte ich den bisherigen Forschungs- und Regelungsstand sammeln und auf eventuelle Lücken und deren Schließung eingehen. Es soll eine Sensibilisierung für die Mechanismen des Arbeitsschutzes und dessen Begleitforschung geschaffen werden und gleichsam in eine Welt vorgedrungen werden, die mit menschlichen Dimensionen nicht mehr begreifbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition und Charakterisierung
- 2.1. Die Problematik der Definition
- 2.2. Forschungsfelder
- 3. Die Geschichte der Nanoforschung
- 3.1 Die griechische Antike und der Nanokosmos
- 3.2 Von Isaac Newton zu Richard Feynman
- 3.2.1. „Gott schuf harte Materie“
- 3.2.2. Magische Mikroskope
- 3.2.3. Der 29. Dezember 1959 – Ein naturwissenschaftlicher Feiertag
- 3.3. Der Beginn des Kohlenstoffzeitalters
- 3.3.1. Nanotechnologie am „Fußballfeld“
- 3.3.2. Das Fortschreiten der Nanoarchitektur
- 4. Anwendungsbereiche der Nano-Technologie
- 4.1. Nanokristalle und Designer-Moleküle
- 4.2. Beschichtungen und Inhaltsstoffe aus Nanomaterialien
- 4.2.1. Oberflächenbeschichtungen
- 4.2.2. Titandioxid – Schreckgespenst und Hoffnungsträger
- 4.3. Weitere Anwendungsgebiete der Nanotechnologie - Eine exemplarische Aufzählung mit Hinweisen auf die Relevanz im ArbeitnehmerInnenschutz
- 5. Ein Blick in die Zukunft
- 6. Nanotechnologie am Arbeitsplatz
- 6.1. Tätigkeitsbereiche
- 6.2. Derzeitiger Stand der Evaluierung
- 7. Die herrschende Rechtslage in Österreich
- 7.1. Ein Überblick über das österreichische Chemikalienrecht
- 7.2. Überblick über den ArbeitnehmerInnenschutz
- 7.3. Nanotechnologie und gefährliche Materialien am Arbeitsplatz
- 7.3.1. Definition „gefährliche Materialien“
- 7.3.2 Kontrollmechanismen
- 7.3.3. Schutzbestimmungen für ArbeitnehmerInnen
- 7.3.3.1. Kennzeichnung
- 7.3.3.2. Sublimierung
- 7.3.3.3. Maßnahmen zur Gefahrenverhütung
- 7.3.3.4. Messungen
- 7.3.3.5. Persönliche Schutzausrüstung
- 7.3.3.6. Untersuchungen
- 7.3.4. Pflichten der ArbeitnehmerInnen
- 7.3.5. Das Leistungsverweigerungsrecht des § 8 AVRAG
- 8. Die Rechtslage in der Europäischen Union
- 8.1. Die REACH Verordnung - Das Kernstück des Chemikalienrechts der EU
- 8.1.1. Allgemeines Registrierungsverfahren
- 8.1.2. Besonderes Registrierungsverfahren - Stoffsicherheitsbericht
- 8.1.3. Nach der Registrierung
- 8.1.4. Informationen in der Lieferkette - Sicherheitsdatenblatt
- 8.1.5. Zulassungsverfahren
- 8.2. ArbeitnehmerInnenschutz im europäischen Recht
- 8.3. Die Rechtslage in Nicht-EU-Ländern am Beispiel der Schweiz
- 9. Risikobewertung als Instrument zur Rechtsanpassung
- 9.1. Aufgaben der Risikobewertung
- 9.2. Prozesse und Methoden der Risikobewertung
- 9.2.1. Institutioneller Rahmen
- 9.2.3. Methoden der Risikobewertung
- 9.2.3.1. Die FMEA-Methode
- 9.2.4. Messmethoden für Nanopartikel
- 9.2.4.2. Kondensationskeimzähler (CPC)
- 9.2.4.3. Nano-Differenzieller Mobilitätsanalysator (Nano-DMA)
- 9.2.4.4. Nano-Aerosol-Sampler (NAS)
- 9.2.4.5. Fazit
- 9.3. Derzeitiger Forschungsstand hinsichtlich gesundheitlicher Folgen
- 9.3.1. Toxikologische Untersuchungen von Kohlenstoffnanoröhrchen
- 9.3.2. Amorphe Kieselsäure
- 9.3.3. Titandioxid
- 9.3.4. Fazit
- 9.4. Nanotechnologie als internationale Herausforderung
- 10. Adaptions- und Veränderungsbedarf des nationalen und europäischen Rechtsrahmens
- 10.1. Adaptions- und Veränderungsbedarf im Stoffrecht
- 10.1.1. Allgemein verbindliche Definition
- 10.1.2. Anmeldung von Neustoffen
- 10.1.3. Nanomaterialien als Altstoff
- 10.1.3.1. Ablehnung des Altstoff-Begriffs für Nanomaterialien
- 10.1.3.2. Überarbeitung der Aktualisierungspflicht
- 10.1.3.3. Kennzeichnung und Nomenklatur
- 10.1.4. Fazit
- 10.2. Adaptions- und Veränderungsbedarf im ArbeitnehmerInnenschutzrecht
- 10.2.1. Festlegung von Grenzwerten
- 10.2.2. Kontroll- und Messverfahren
- 10.2.3. Schutzmaßnahmen im Einzelnen
- 10.2.3.1. § 41 ASchG
- 10.2.3.2. § 42 ASchG
- 10.2.3.3. § 43 ASchG
- 10.2.3.5. Informationen
- 10.2.4. Arbeitsmedizinische Aspekte
- 11. Resümee und Prognose
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, welche Herausforderungen die aufkommende Nanotechnologie für den Arbeitsschutz in Österreich und der Europäischen Union stellt. Die Arbeit analysiert den aktuellen Stand der Nanotechnologie, ihre Anwendungsbereiche und die damit verbundenen Risiken für ArbeitnehmerInnen. Ziel ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen im nationalen und europäischen Recht im Hinblick auf den Arbeitsschutz in der Nanotechnologie zu untersuchen und Handlungsbedarf aufzuzeigen.
- Definition und Charakterisierung der Nanotechnologie
- Anwendungsbereiche der Nanotechnologie und ihre Relevanz für den Arbeitsschutz
- Rechtslage in Österreich und der Europäischen Union hinsichtlich des Arbeitsschutzes in der Nanotechnologie
- Risikobewertung und derzeitige Forschungsstände zu gesundheitlichen Folgen der Nanotechnologie
- Adaptions- und Veränderungsbedarf des nationalen und europäischen Rechtsrahmens
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung – Die Einleitung führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und erläutert die Relevanz der Nanotechnologie für den Arbeitsschutz.
- Kapitel 2: Definition und Charakterisierung – Dieses Kapitel definiert und charakterisiert die Nanotechnologie und beschreibt die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen.
- Kapitel 3: Die Geschichte der Nanoforschung – Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Nanoforschung und die wichtigsten Meilensteine.
- Kapitel 4: Anwendungsbereiche der Nano-Technologie – Dieses Kapitel zeigt verschiedene Anwendungsbereiche der Nanotechnologie auf und beschreibt ihre Relevanz für den Arbeitsschutz.
- Kapitel 5: Ein Blick in die Zukunft – Dieses Kapitel gibt einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Nanotechnologie und ihre potenziellen Auswirkungen auf den Arbeitsschutz.
- Kapitel 6: Nanotechnologie am Arbeitsplatz – Dieses Kapitel untersucht die Tätigkeitsbereiche, in denen ArbeitnehmerInnen mit Nanomaterialien in Berührung kommen können, und den derzeitigen Stand der Evaluierung von Nanotechnologie am Arbeitsplatz.
- Kapitel 7: Die herrschende Rechtslage in Österreich – Dieses Kapitel analysiert die österreichische Rechtslage im Hinblick auf den Arbeitsschutz in der Nanotechnologie. Es werden die einschlägigen Bestimmungen des Chemikalienrechts und des ArbeitnehmerInnenschutzrechts beleuchtet.
- Kapitel 8: Die Rechtslage in der Europäischen Union – Dieses Kapitel analysiert die europäische Rechtslage im Hinblick auf den Arbeitsschutz in der Nanotechnologie. Es wird die REACH-Verordnung als Kernstück des europäischen Chemikalienrechts behandelt.
- Kapitel 9: Risikobewertung als Instrument zur Rechtsanpassung – Dieses Kapitel untersucht die Rolle der Risikobewertung als Instrument zur Anpassung des Rechtsrahmens an die Herausforderungen der Nanotechnologie. Es werden verschiedene Methoden der Risikobewertung vorgestellt.
- Kapitel 10: Adaptions- und Veränderungsbedarf des nationalen und europäischen Rechtsrahmens – Dieses Kapitel analysiert den Adaptions- und Veränderungsbedarf des nationalen und europäischen Rechtsrahmens im Hinblick auf den Arbeitsschutz in der Nanotechnologie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Nanotechnologie, Arbeitsschutz, ArbeitnehmerInnenschutz, Chemikalienrecht, REACH-Verordnung, Risikobewertung, Nanomaterialien, Gesundheitsrisiken, Adaptionsbedarf, Rechtsrahmen, Österreich, Europäische Union.
- Quote paper
- Maximilian Angelo Turrini (Author), 2010, Vor welche Herausforderungen stellt die aufkommende Nanotechnologie den Arbeitsschutz in Österreich und der Europäischen Union?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164143