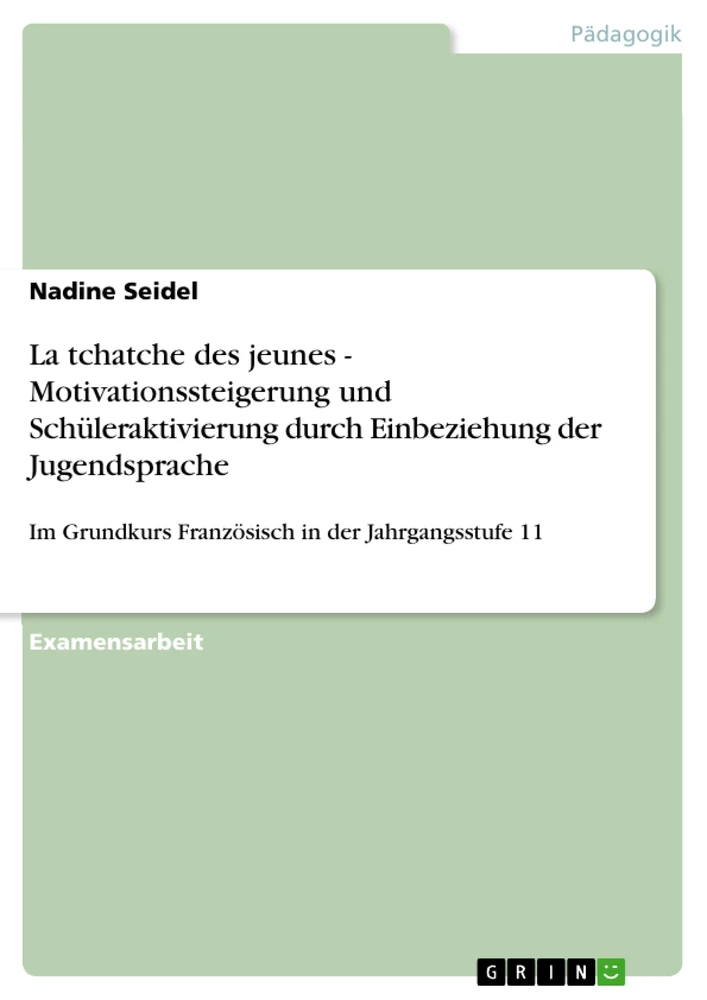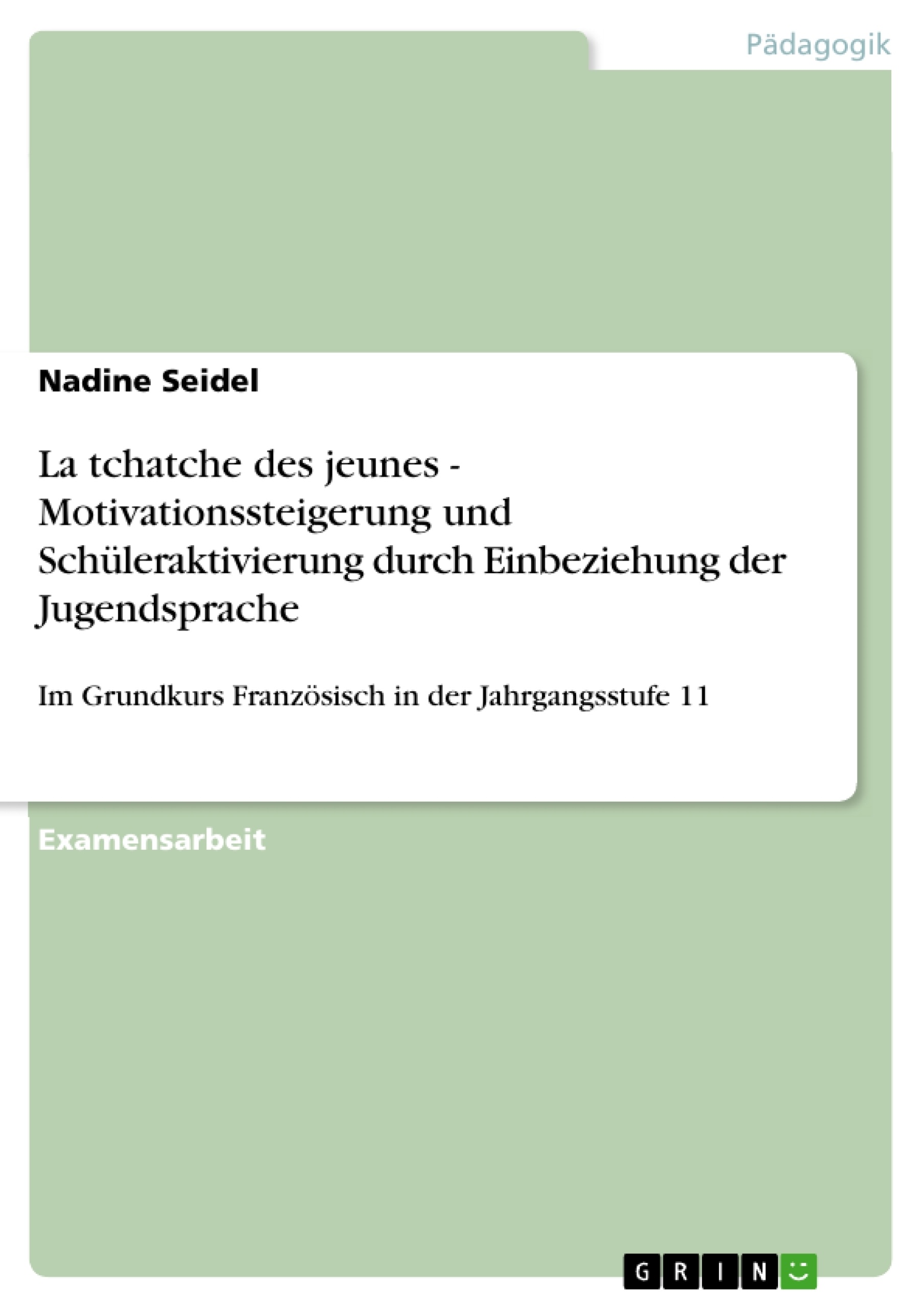Jugendliche egal welcher Herkunft sprechen ihre eigene Sprache, eine Sprache mit deren Hilfe sie sich von anderen abgrenzen und ihre eigene, gerade im Entstehen begriffene Identität unterstreichen. Sie wirken dabei kreativ und spielen mit Worten und Silben, kombinieren wie im Bereich der Mode oder Musik bereits vorhandene Elemente neu oder schaffen gänzlich Neues. In Frankreich ist dieses Phänomen besonders ausgeprägt, was neben populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen wie Comment tu tchatches von Goudaillier oder Le vrai langage des jeunes expliqué aux parents von Girard und Kernel sowie Internetseiten für Lernwillige auch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema belegen.
Eine unterrichtliche Behandlung der tchatche des jeunes bietet sich demnach sowohl aus linguistischer als auch aus interkulturell-soziologischer Perspektive an.
Französische Jugendsprache begegnet uns nicht nur in den Pariser banlieues, wo sie vorrangig entstand, sondern auch auf den Straßen der Provence oder Bretagne sowie flächendeckend in Film, Fernsehen, Musik, Zeitschriften oder Internet. Hinzu kommt, dass mit den Sprechern der Jugendsprache nicht etwa nur Jugendliche bis 18 Jahre gemeint sind, sondern sich durchaus auch Erwachsene jugendsprachlicher Elemente bedienen, wenn es die Gegebenheiten erlauben, sodass die tchatche des jeunes als diastratische und diaphasische Varietät des Französischen beschrieben werden kann. Viele ihrer Elemente sind zudem längst Teil des français familier oder français courant geworden . Eine klare Grenze zwischen verschiedenen Sprachregistern kann ohnehin nicht gezogen werden. Fest steht, dass Kenntnisse der französischen Jugendsprache für eine umfassende Kommunikationsfähigkeit in authentischen Situationen, zu der eben auch die Rezeption nicht-standardsprachlicher Texte gehört, unabdingbar sind. Umso mehr verwundert es, dass ihr nicht mehr Raum in Lehrplänen oder Bildungsempfehlungen zuteil wird.
Um Französischlernern also für den Fall einer Begegnung mit französischen Jugendlichen die Enttäuschung zu ersparen, von einer scheinbar unbekannten Sprache kaum etwas zu verstehen, aber auch um ihnen zu zeigen, wie viel Spaß das Spiel mit dieser Sprache machen kann, bietet sich eine systematische Behandlung im Unterricht an.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Begründender Teil
- 1.1 Vorüberlegungen zur Themenauswahl und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Einordnung des Themas in den Lehrplan und Lernziele
- 1.3 Theoretische Erkenntnisse zur französischen Jugendsprache
- 1.4 Herleitung der empirischen Gesamtplanung und experimentelle Fragestellungen
- 1.4.1 Vorüberlegungen zu den situativen Voraussetzungen
- 1.4.2 Vorüberlegungen zum inhaltlichen Vorgehen
- 1.4.3 Vorüberlegungen zum methodisch-didaktischen Vorgehen
- 1.4.4 Vorüberlegungen zu Medien und Lehrmitteln
- 1.4.5 Vorüberlegungen zu Ergebnissicherung und Lernerfolgskontrollen
- 1.4.6 Experimentelle Fragestellungen
- 2 Darstellung der empirischen Untersuchung
- 2.1 Beschreibung des Verlaufs der Unterrichtsreihe und genaue Darstellung zweier Unterrichtseinheiten
- 2.2 Gesamtüberblick über den Unterrichtsversuch in tabellarischer Form
- 3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung
- 3.1 Erreichen der Lernziele
- 3.2 Auswertung der experimentellen Fragestellungen
- 3.2.1 Zum inhaltlichen Vorgehen
- 3.2.2 Zum methodisch-didaktischen Vorgehen
- 3.2.3 Zu angewandten Medien und Lehrmitteln
- 3.2.4 Zu gewählten Formen der Ergebnissicherung und Lernerfolgskontrollen
- 3.3 Schlussfolgerung für die Arbeit des Lehrers und Ausblick über mögliche Alternativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Motivationssteigerung und Schüleraktivierung im Französischunterricht der Jahrgangsstufe 11 durch die Einbeziehung französischer Jugendsprache ("tchatche des jeunes"). Ziel ist es, die Wirksamkeit dieses Ansatzes in einer leistungsschwachen Lerngruppe zu evaluieren und dessen Eignung für den Lehrplan zu überprüfen. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Analyse der Ergebnisse.
- Integration französischer Jugendsprache in den Französischunterricht
- Steigerung der Schülermotivation und -aktivierung
- Analyse der Wirksamkeit des Ansatzes in einer leistungsschwachen Lerngruppe
- Überprüfung der Eignung des Ansatzes im Hinblick auf den Lehrplan
- Entwicklung und Anwendung geeigneter methodisch-didaktischer Vorgehensweisen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Begründender Teil: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden die Gründe für die Themenwahl erläutert, der Bezug zum Lehrplan hergestellt und die Lernziele definiert. Die theoretischen Erkenntnisse zur französischen Jugendsprache werden vorgestellt, gefolgt von einer detaillierten Beschreibung der empirischen Planung, inklusive der methodisch-didaktischen Vorgehensweise, der Medienauswahl und der geplanten Ergebnissicherung. Der Schwerpunkt liegt auf der Begründung der Notwendigkeit, Jugendsprache im Unterricht zu behandeln, um die Motivation und das Verständnis der Schüler zu verbessern, und auf der Darstellung der methodischen Herangehensweise an das Forschungsvorhaben. Die Herausforderungen einer leistungsschwachen Lerngruppe werden explizit angesprochen. Die Einordnung der "tchatche des jeunes" als diastratische und diaphasische Varietät des Französischen wird ausführlich diskutiert.
2 Darstellung der empirischen Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der Unterrichtsreihe detailliert, mit einer genauen Darstellung von zwei exemplarischen Unterrichtseinheiten. Es werden die konkreten Methoden und Materialien beschrieben, die im Unterricht eingesetzt wurden, um die Jugendsprache zu vermitteln und die Schüler zu motivieren. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung der im ersten Teil entwickelten Konzepte. Ein tabellarischer Gesamtüberblick fasst den Unterrichtsversuch zusammen.
Schlüsselwörter
Französischunterricht, Jugendsprache, tchatche des jeunes, Motivationssteigerung, Schüleraktivierung, Leistungsschwache Lerngruppe, Lehrplan Sachsen, empirische Untersuchung, methodisch-didaktisches Vorgehen, Kommunikationsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Motivationssteigerung und Schüleraktivierung im Französischunterricht durch die Einbeziehung französischer Jugendsprache
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit der Integration französischer Jugendsprache ("tchatche des jeunes") im Französischunterricht der Jahrgangsstufe 11 zur Steigerung der Motivation und Aktivierung von Schülern, insbesondere in einer leistungsschwachen Lerngruppe. Es wird geprüft, ob dieser Ansatz die Lernziele des Lehrplans erfüllt.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Effektivität der Einbeziehung von Jugendsprache im Französischunterricht zu evaluieren. Konkret soll untersucht werden, ob die Motivation und Aktivierung der Schüler gesteigert werden kann und ob der Ansatz mit dem Lehrplan vereinbar ist. Die praktische Umsetzung und die Analyse der Ergebnisse stehen im Mittelpunkt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus drei Hauptteilen: Einem begründenden Teil, der die theoretischen Grundlagen, die Zielsetzung und die methodische Planung darlegt; einem Teil, der die empirische Untersuchung (den Unterrichtsversuch) detailliert beschreibt; und einem Teil, der die Ergebnisse der Untersuchung auswertet und Schlussfolgerungen zieht. Der begründende Teil beinhaltet auch die Einordnung des Themas in den Lehrplan und die Herleitung der experimentellen Fragestellungen. Der zweite Teil beinhaltet die Beschreibung des Unterrichtsverlaufs inklusive zweier detaillierter Unterrichtseinheiten und einer tabellarischen Zusammenfassung. Der dritte Teil analysiert das Erreichen der Lernziele und beantwortet die experimentellen Fragestellungen, bevor er Schlussfolgerungen für die Lehrerarbeit und Ausblicke auf mögliche Alternativen bietet.
Welche Methoden wurden eingesetzt?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethode. Der konkrete methodisch-didaktische Ansatz zur Vermittlung der Jugendsprache im Unterricht wird im begründenden Teil detailliert beschrieben. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden ausgewertet und analysiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden im dritten Teil der Arbeit präsentiert. Sie umfassen die Auswertung des Erreichens der Lernziele und der Beantwortung der experimentellen Fragestellungen, bezogen auf das inhaltliche und methodisch-didaktische Vorgehen, die verwendeten Medien und Lehrmittel sowie die gewählten Formen der Ergebnissicherung und Lernerfolgskontrollen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Wirksamkeit des Ansatzes und seine Eignung für den Lehrplan interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit beziehen sich auf die Wirksamkeit der Integration französischer Jugendsprache im Französischunterricht zur Steigerung der Schülermotivation und -aktivierung, insbesondere in leistungsschwachen Lerngruppen. Es werden Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit von Lehrkräften gezogen und mögliche Alternativen und weiterführende Forschungsansätze aufgezeigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Französischunterricht, Jugendsprache, tchatche des jeunes, Motivationssteigerung, Schüleraktivierung, Leistungsschwache Lerngruppe, Lehrplan Sachsen, empirische Untersuchung, methodisch-didaktisches Vorgehen, Kommunikationsfähigkeit.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Französischlehrer, Lehramtsstudenten, Didaktiker und alle, die sich für die Verbesserung des Französischunterrichts und die Motivationssteigerung von Schülern interessieren. Sie bietet praktische Hinweise und Erkenntnisse für den Einsatz von Jugendsprache im Unterricht.
- Citar trabajo
- Nadine Seidel (Autor), 2010, La tchatche des jeunes - Motivationssteigerung und Schüleraktivierung durch Einbeziehung der Jugendsprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163921