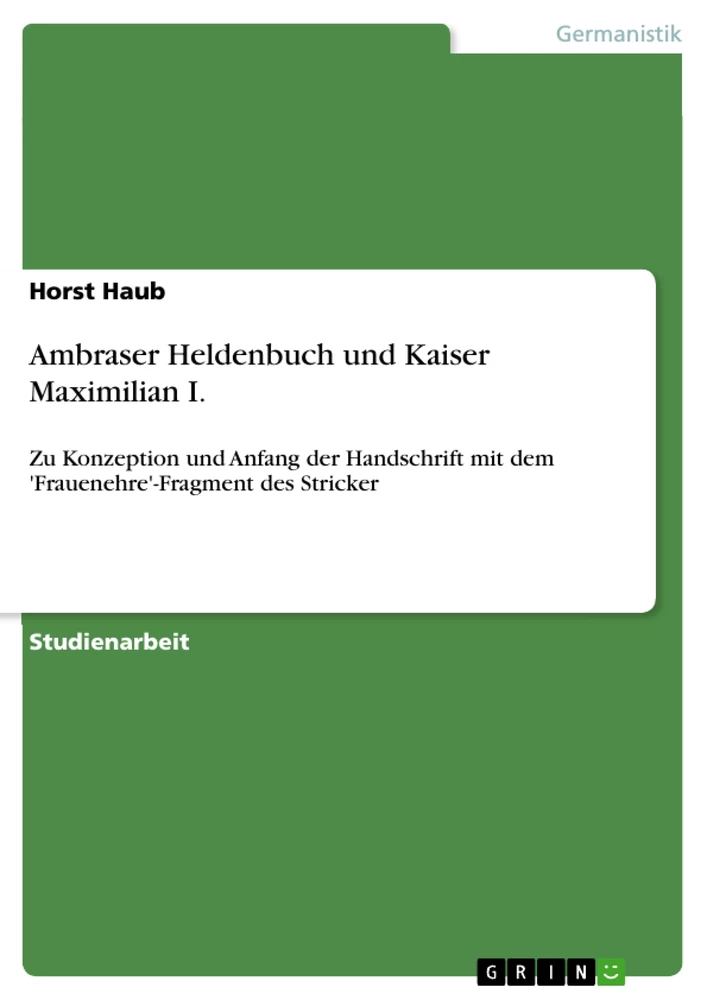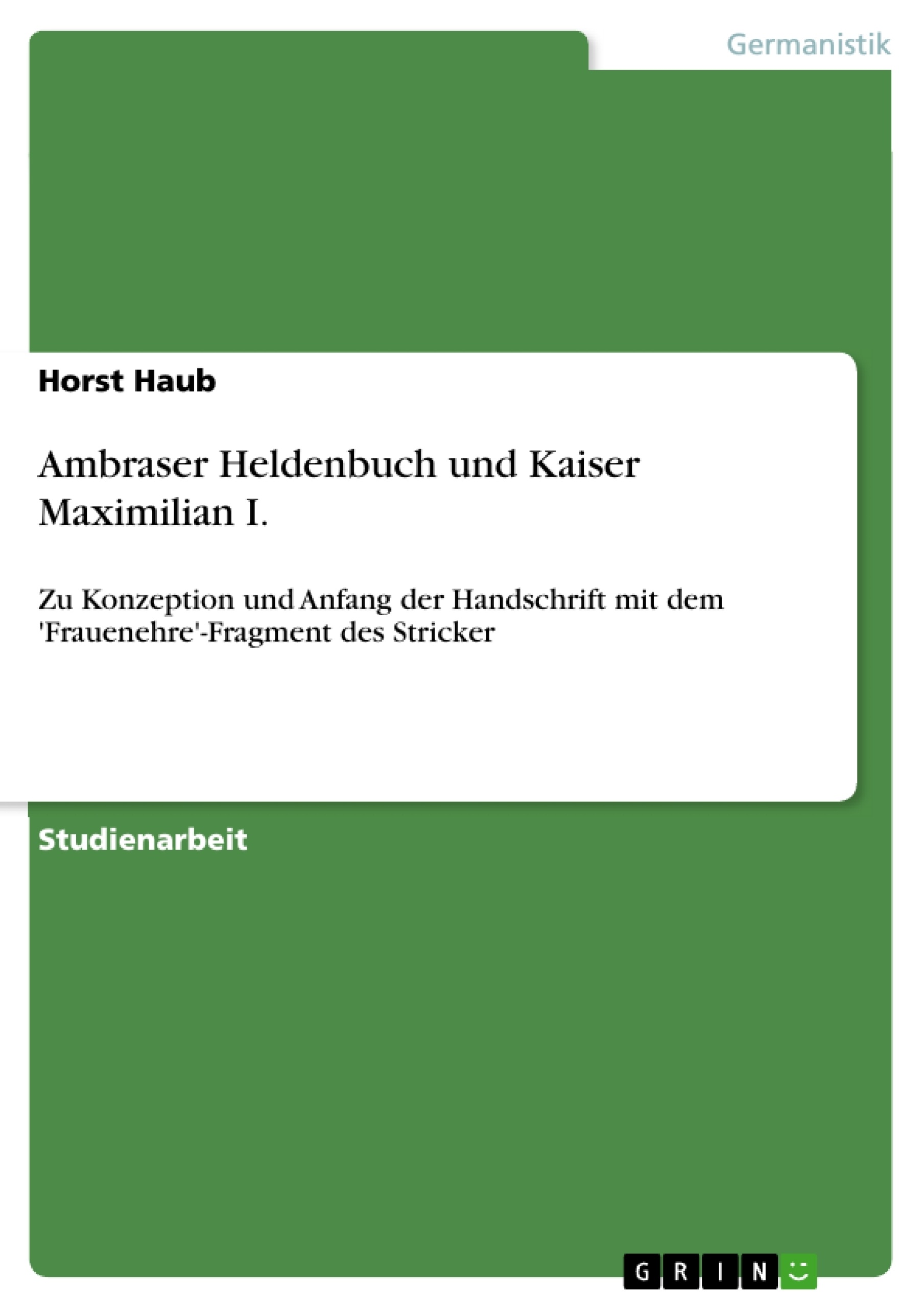Ausgehend von der spezifischen Gestalt, in der die 'Frauenehre' des Stricker Aufnahme in die Sammelhandschrift Kaiser Maximilian I. findet, versucht die vorliegende Arbeit die Frage zu beantworten, auf welchen Adressatenkreis der Beginn des 'Ambraser Heldenbuchs', und somit (vermutlich) das gesamte Projekt, zielt.
Die 'Frauenehre' wird als Dichtung interpretiert, die Maximilian auch zu Beginn des 16. Jahrhunderts noch hochaktuell erscheint. Das Fragment eignet sich, so die These, in einer spezifischen historischen Lage dazu, sowohl Maximilians persönliche Überzeugungen als auch familiäre Sorgen und machtpolitische Befürchtungen zum Ausdruck zu bringen.
Die 'Frauenehre', an prominenter 1. Stelle im 'Ambraser Heldenbuch', wird auch als programmatische Aussage begriffen. So wie es dem Stricker in seiner Zeit notwendig erschien, irrigen Auffassungen im Bereich Minne und Ehe entschieden entgegen zu treten, ebenso scheinen Maximilian und seine 'literarischen Beiräte' die Dringlichkeit einer Stellungnahme zu den weiterhin verbindlichen adligen Standards in Bezug auf Minne und Ehe empfunden zu haben.
In Analogie zu den machtpolitischen Unternehmungen des Hauses Habsburg muss man auch bei dem literarischen Projekt 'Ambraser Heldenbuch' mit einem gesamteuropäischen Rahmen rechnen. Durch seine primäre Ausrichtung auf die burgundischen Niederlande wird man jedoch vor allem von einer Auseinandersetzung mit der Literatur des französichen Kulturraumes ausgehen müssen. Die gesteigerte Produktion von Handschriften im 15. Jahrhundert wird als wichtige Dimension adliger Kommunikation und adliger Öffentlichkeit vermutet. Die Ausrichtung des 'Ambraser Heldenbuchs' mittels seiner zahlreichen Dichtungen zur 'Beziehungsfrage' wird angesprochen und in Übereinstimmung mit seiner programmatischen Dichtung am Anfang, als Verteidigungsschrift angesichts einer anschwellenden Produktion misogyner Texte gewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I Die Forschung
- I.1 Das Ambraser Heldenbuch als Programm und Absicht
- II Eine Handschrift im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit
- II.1 Eine Prachthandschrift als Hochzeitsgeschenk?
- III Adlige Öffentlichkeit und Heldenbuch
- IV Die Mehrverse des 'Frauenehre'-Fragments
- IV.1 Mahnrede Maximilians an seinen Sohn mit literarischen Mitteln
- IV.2 Machtpolitik und Beziehungsprobleme
- V Das 'Frauenehre'-Fragment weiterhin auf Platz 1 im Heldenbuch
- V.1 Zur Aussage des 'Frauenehre'-Fragments
- V.2 Gebrochene Heiratsversprechen und 'Brautraub'
- V.2.1 Historischer Kontext
- V.2.2 Das 'Frauenehre'-Fragment als Kommentar zu Frankreichs Königen
- VI Die Minderverse (Schlussverse)
- VI.1 Armut
- VI.2 der ander got der werlde
- VII Verteidigung der Ehre der Frauen als Aufgabe des Heldenbuchs
- VIII Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entstehung und den Inhalt des 'Ambraser Heldenbuchs', einer Handschrift aus der Zeit Kaiser Maximilians I. Ziel ist es, die konzeptionelle Arbeit hinter dem Werk zu beleuchten und die Botschaft zu entschlüsseln, die der Autor den imaginierten Rezipienten vermitteln möchte. Die Arbeit analysiert den Text und berücksichtigt neueste Forschungsergebnisse.
- Die Entstehungsgeschichte des 'Ambraser Heldenbuchs' und die Rolle Maximilians I.
- Die Rezeption des 'Frauenehre'-Fragments und seine Bedeutung für die Gesamthandschrift.
- Die Verwendung literarischer Mittel im 'Heldenbuch' und die Bedeutung der Minne.
- Die Frage der intendierten Rezeption und die Botschaft des Werks.
- Die Frage nach dem Verhältnis von Historie und Literatur im 'Ambraser Heldenbuch'.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Die Forschung: Dieses Kapitel stellt den aktuellen Forschungsstand zum 'Ambraser Heldenbuch' vor und erläutert die besonderen Herausforderungen für die Interpretation des Werks. Es beleuchtet die Diskussion um die konzeptionelle Planung des Buches und die Frage, wer die Auswahl der Texte und die Gestaltung des Codex bestimmte.
- Kapitel II: Eine Handschrift im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung der Handschrift und ihrem Status als Prachthandschrift. Es diskutiert die Möglichkeit, dass das 'Ambraser Heldenbuch' als Hochzeitsgeschenk gedacht war.
- Kapitel III: Adlige Öffentlichkeit und Heldenbuch: Dieses Kapitel untersucht die Rezeption des 'Ambraser Heldenbuchs' in der adligen Öffentlichkeit und die Rollen von Autor und Rezipienten.
- Kapitel IV: Die Mehrverse des 'Frauenehre'-Fragments: Dieses Kapitel analysiert die Mehrverse des 'Frauenehre'-Fragments und ihre Bedeutung für die Gesamtinterpretation des 'Ambraser Heldenbuchs'. Es untersucht die Mahnrede Maximilians an seinen Sohn und die Zusammenhänge mit Machtpolitik und Beziehungsproblemen.
- Kapitel V: Das 'Frauenehre'-Fragment weiterhin auf Platz 1 im Heldenbuch: Dieses Kapitel analysiert die Aussage des 'Frauenehre'-Fragments und den historischen Kontext der dargestellten Thematik. Es untersucht das Fragment im Zusammenhang mit der Frage nach gebrochenen Heiratsversprechen und 'Brautraub'.
- Kapitel VI: Die Minderverse (Schlussverse): Dieses Kapitel widmet sich den Schlussversen des 'Frauenehre'-Fragments und untersucht die Themen Armut und 'der ander got der werlde'.
- Kapitel VII: Verteidigung der Ehre der Frauen als Aufgabe des Heldenbuchs: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des 'Frauenehre'-Fragments für das Gesamtkonzept des 'Ambraser Heldenbuchs' und die Rolle der Frauen in der höfischen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Ambraser Heldenbuch, Kaiser Maximilian I., 'Frauenehre'-Fragment, Minnereden, höfische Kultur, Handschrift, Literaturgeschichte, Textanalyse, Rezeption, Machtpolitik, Beziehungsprobleme.
- Quote paper
- Horst Haub (Author), 2010, Ambraser Heldenbuch und Kaiser Maximilian I., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163787