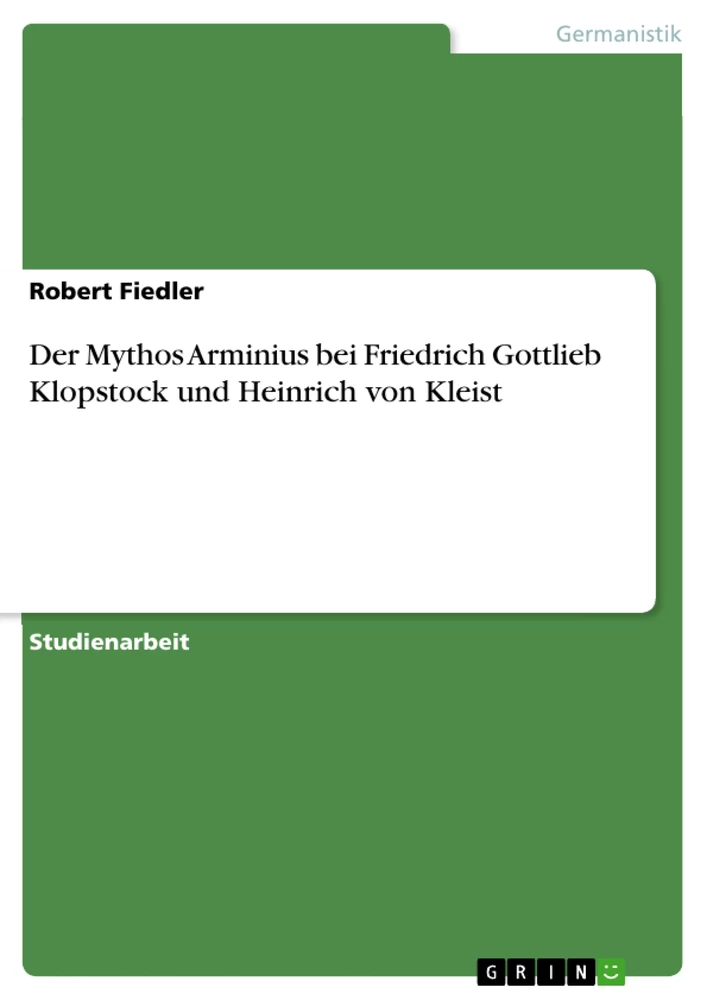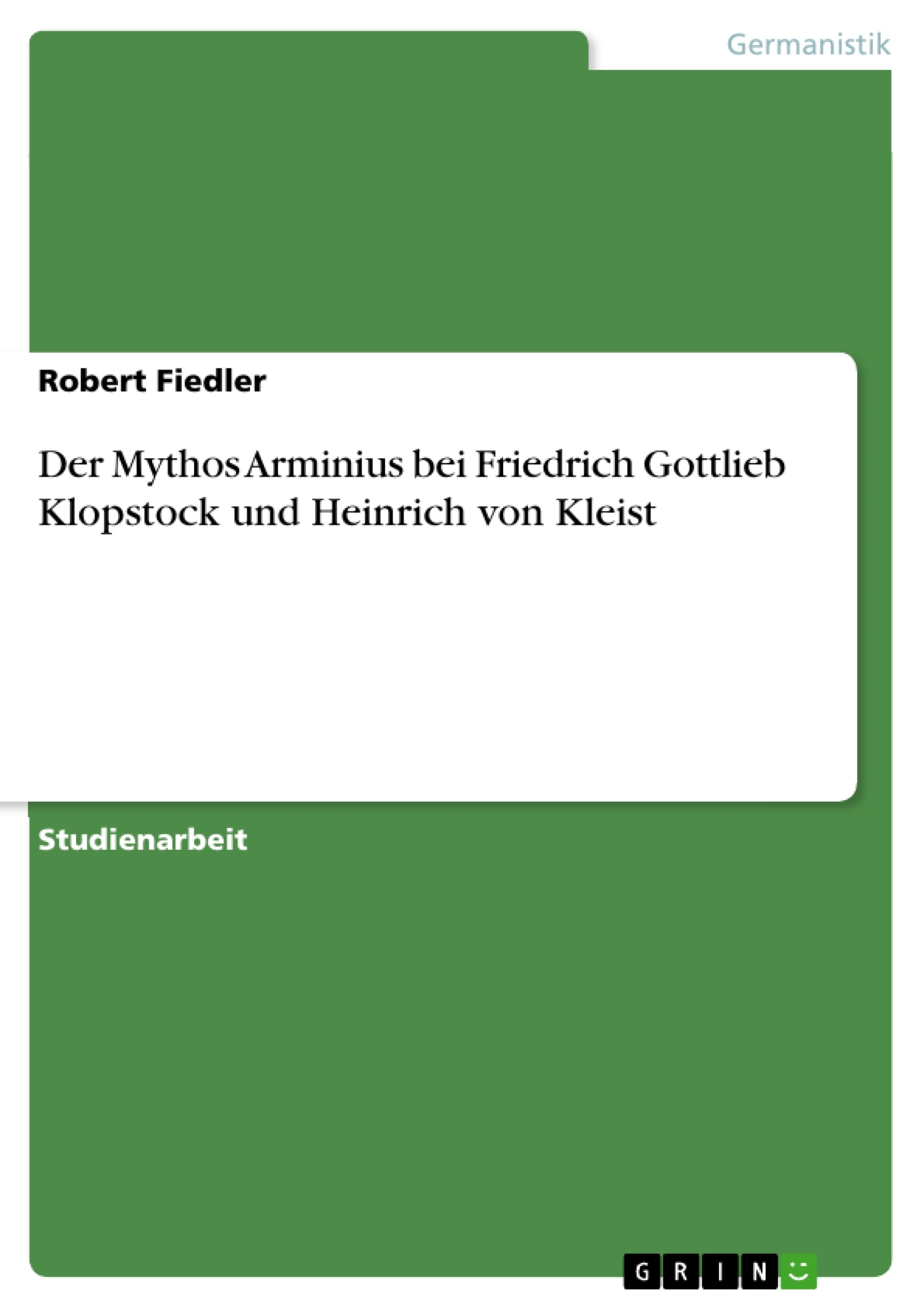Der militärische Sieg des Arminius und dessen herausragenden strategischen Fähigkeiten veranlassten nicht nur den römischen Kaiser Tiberius die germanischen Feldzüge zu beenden und die Grenze des römischen Reichens entlang der Donau und des Rheins zu fixieren. Die historische Tatsache dass durch den Sieg des Arminius auch die Freiheit der germanischen Stämme gesichert wurde war auch Grundlage für einen deutschen Mythos der bis in die heutige Zeit Literatur und das Denken in Deutschland inspiriert. In der Tat wird in besondere während des 18. und 19. Jahrhunderts der Cheruskerfürst Arminius an den Anbeginn der deutschen Nation gesetzt und in ihm der „erste historisch fassbare Deutsche“ (Münkler 2009, S. 165) gefunden. Viel tiefer noch geht die Identifikation der Deutschen mit dem Arminius:
„Er war noch mehr: Wenn man an das Schicksal Galliens und Spaniens, und die durchgängige Widerstandsunfähigkeit junger Völker gegen höhere Kulturstufen denkt, so ist kein Zweifel: In dem Arminius das römische Heer vernichtete, hat er unsere Nationalität gerettet, dass wir noch Deutsche sind verdanken wir ihm“ (Egelhaaf 1909, S. 423)
Der Mythos Arminius schaffte es über einen langen Zeitraum hinweg in unterschiedlichsten politischen Konstellationen seine Anwendungen und Nischen zu finden, ein Umstand den er vor allem seiner Flexibilität zu verdanken hat. Laut Münkler verbindet er drei Elemente die je nach Notwendigkeit oder zeitgenössischer Betrachtung eine unterschiedliche Inanspruchnahme zulassen. Zum einen kann durch die Vernichtung der Legionen ein immenses nationales Selbstvertrauen formuliert werden, waren es doch die Germanen die dem römischen Reich auf dem Höhepunkt seiner Macht Einhalt gebieten konnten. Zum anderen kann der Arminiusstoff zur Schaffung eines neuen nationalen Einheitsgefühls dienen, nimmt man die Einigung der germanischen Stämme unter Arminius im Vorfeld der Schlacht als Beispiel. Schließlich entfaltet der Arminiusmythos eine besonders starke Anziehungskraft im Kampf gegen fremde Aggressoren, ein Bild dass ins besondere im 19. - 2 -
Jahrhundert und im Lichte des deutschen – französischen Konflikts angewendet wurde. (vgl. (Münkler 2009, S. 166–167). Im folgenden sollen nun zwei literarische Werke aus dem 18. Jahrhundert hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Mythos Arminius untersucht werden. Zum einen wird auf Friedrich Gottlieb Klopstocks epochale Trilogie zur Hermannschlacht eingegangen. Zum anderen auf „Die Hermannsschlacht“ von Heinrich von Kleist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Friedrich Gottlieb Klopstocks Hermannstriologie
- Die Bardietenform
- Der gerechte Krieg
- Göttlicher Wille und Vaterland
- Mythos Hermann
- Heinrich von Kleists Drama „Die Hermannsschlacht“
- Das germanische Bild
- Das Hermannsbild
- Der Mythos Hermann
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die literarische Auseinandersetzung mit dem Mythos Arminius in den Werken von Friedrich Gottlieb Klopstock und Heinrich von Kleist. Die Arbeit untersucht die Rolle des Mythos in der Entwicklung des deutschen Nationalbewusstseins und die Art und Weise, wie die beiden Autoren die Geschichte des Arminius interpretierten und nutzten, um eigene nationale und politische Botschaften zu vermitteln.
- Die Bedeutung des Arminiusmythos für die deutsche Identität
- Die Rolle des Mythos als Instrument der politischen Propaganda
- Die literarische Gestaltung des Arminiusmythos bei Klopstock und Kleist
- Die Verbindung von Geschichte und Mythos in den Werken der beiden Autoren
- Die literarische Verarbeitung des antiken römischen Einflusses auf die deutsche Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die historische Bedeutung des Arminius und seiner Rolle in der deutschen Mythologie ein. Sie skizziert den Kontext der römischen Expansion und des Sieges des Arminius über die römischen Legionen im Jahre 9 n. Chr. und erläutert, wie dieser Sieg zur Grundlage für die Entwicklung eines deutschen Nationalmythos wurde.
Das Kapitel über Friedrich Gottlieb Klopstocks Hermannstriologie befasst sich mit den drei Stücken „Hermanns Schlacht“, „Hermann und die Fürsten“ und „Hermanns Tod“. Die Analyse beleuchtet die Bardietenform, die Klopstock in seinen Werken verwendete, und die zentralen Themen des gerechten Krieges, des göttlichen Willens und des Vaterlands, die in den Stücken behandelt werden.
Das Kapitel über Heinrich von Kleists Drama „Die Hermannsschlacht“ behandelt die Darstellung des germanischen Bildes, des Hermannsbildes und die Interpretation des Mythos Hermann in Kleists Werk. Die Analyse untersucht die politische Dimension des Dramas und die Rolle des Arminius als Symbol für die deutsche Freiheit und Unabhängigkeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Arminius, Mythos, deutsche Identität, Nationalbewusstsein, politische Propaganda, literarische Gestaltung, Geschichte, Klopstock, Kleist, Bardietenform, Vaterland, gerechter Krieg, göttlicher Wille, germanisches Bild, Freiheit, Unabhängigkeit.
- Quote paper
- MSc. M.A. Robert Fiedler (Author), 2009, Der Mythos Arminius bei Friedrich Gottlieb Klopstock und Heinrich von Kleist, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163700