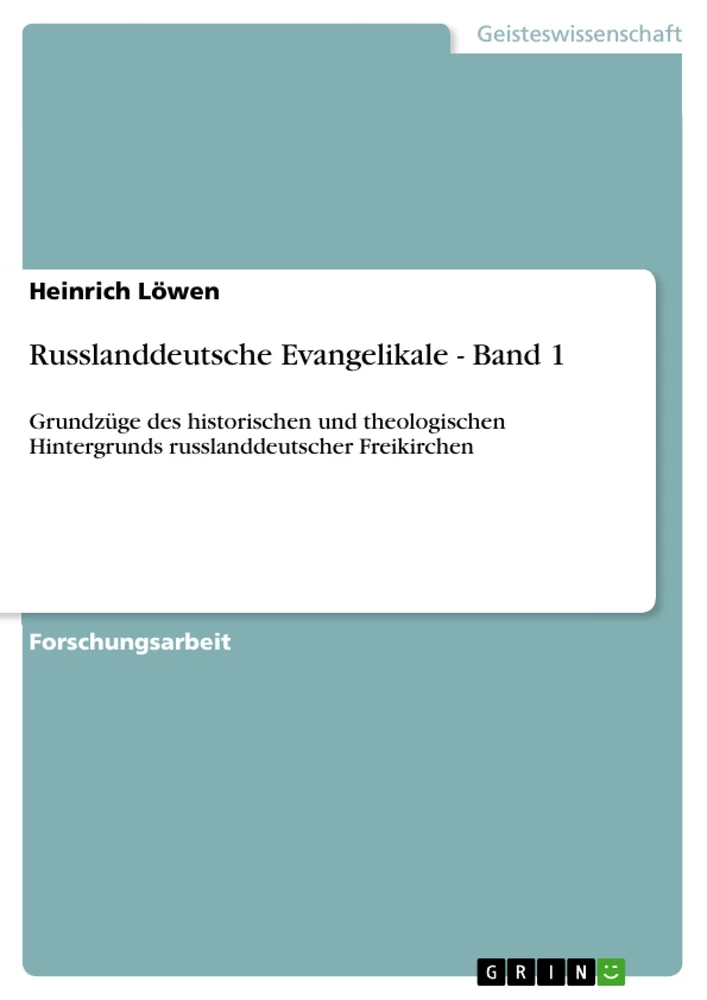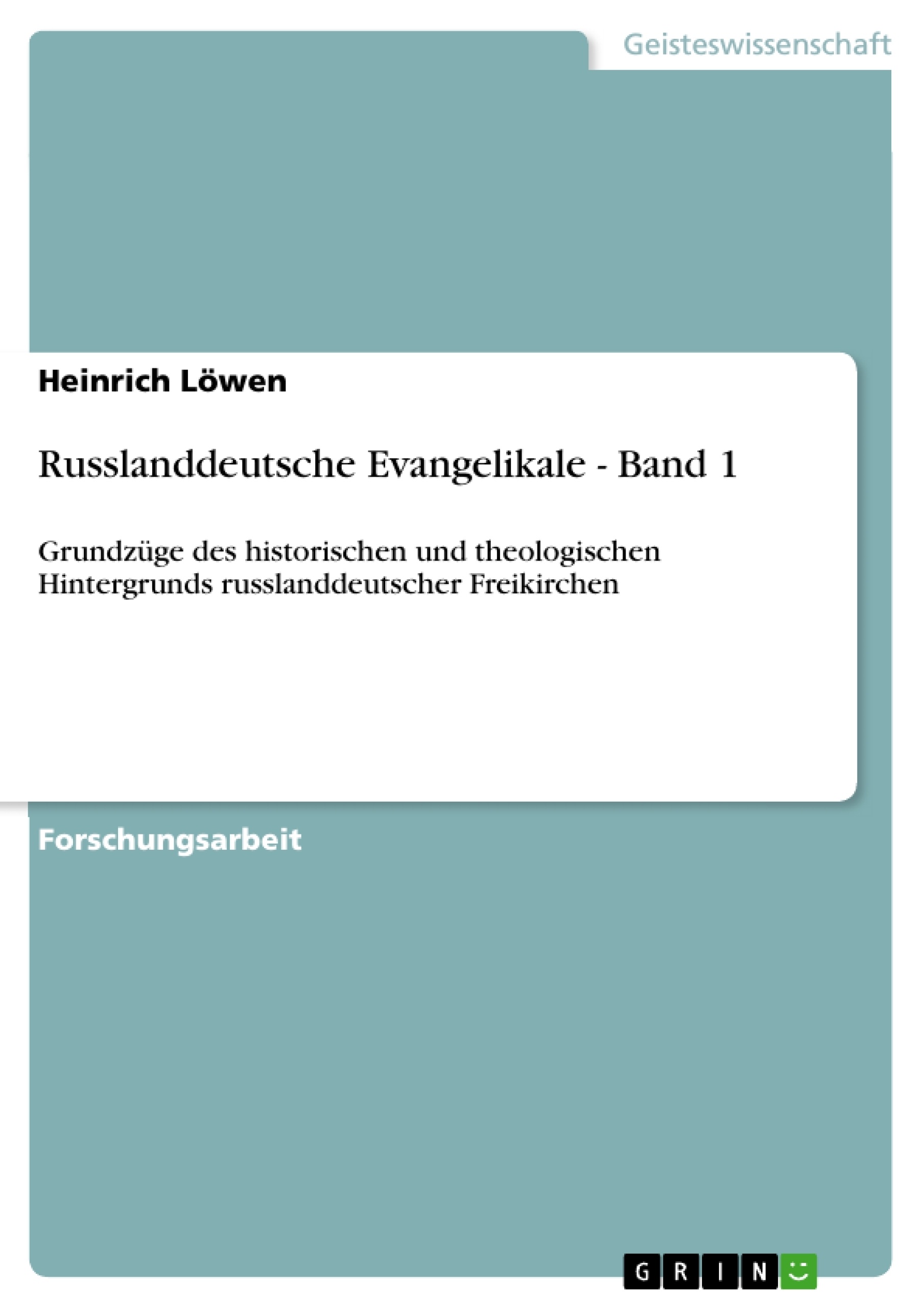In der Zeit von 1950 bis Ende 2010 sind mehr als 4,5 Millionen Aussiedler nach Deutschland eingewandert, von denen etwa 2,3 Millionen aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Etwa 500.000 Russlanddeutsche, die in den letzten dreißig Jahren nach Deutschland umgesiedelt sind, zählen sich zu den Baptisten, Mennoniten oder anderen freikirchlichen Gruppen. Auch wenn nur etwa ein Fünftel dieser Personengruppe getaufte Gemeindemitglieder sind, so stellen die russlanddeutschen Gemeinden mit ca. 100.000 Mitgliedern die größte freikirchliche Gruppierung des Landes dar.
Wenn man das Wachstum der Zahlen der Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher in den russlanddeutschen Gemeinden untersucht, so stellt man fest, dass sie zu den am schnellsten wachsenden und größten Gemeinden des Landes gerechnet werden können. Sie tragen dadurch zur Veränderung der freikirchlichen Landschaft in Deutschland bei.
Wesentliche Ursachen für die Überlebensfähigkeit dieser Gemeinden trotz der starken Verfolgungen in Russland und in der ehemaligen Sowjetunion, aber auch für das schnelle Wachstum in Deutschland können auf ihren historisch-kulturellen und theologischen Hintergrund zurückgeführt werden. Das Ziel dieser Veröffentlichung ist daher, die Kraftquellen dieser Gemeinden anhand des historisch-kulturellen und theologischen Hintergrunds aufzuspüren.
Diese Aufgabe wird bewältigt, indem zuerst der historische und konfessionelle Rahmen skizziert und das pädagogische Kultursystem in den deutschen Siedlungsgebieten und Kolonien dargestellt wird. Es folgen die theologischen Prinzipien und das Gemeindeverständnis russlanddeutscher Freikirchen, die das Gemeindeleben geformt und bestimmt haben. Im letzten Teil werden die missionarischen Bemühungen und kirchlichen Aktivitäten präsentiert. Der Rückblick in die Vergangenheit ist notwendig, weil das kulturell-religiöse Leben, das von den russlanddeutschen Freikirchen noch in Deutschland durch ihre Frömmigkeit und ihr Gemeinde- und Missionsverständnis zum Ausdruck gebracht wird, nur von ihrer Vergangenheit zu erklären und zu verstehen ist.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1 Allgemeiner Überblick: Russlanddeutsche in Deutsch land
1.1 Statistische Angaben zu den Aussiedlerzahlen
1.2 Konfessionszugehörigkeit der Russlanddeutschen
1.3 Überregionale Strukturen russlanddeutscher Freikir chen
2 Die Geschichtsperioden
2.1 Periode des Aufbaus
2.2 Periode des Höchststandes
2.3 Periode der Auslösung
2.4 Periode der Neuorientierung
2.5 Periode der Auswanderung
3 Die konfessionellen Gruppierungen
3.1 Römisch-katholische Kirche
3.2 Evangelische Gemeinden
3.3 Die Mennoniten
3.4 Der deutsche Baptismus
3.5 Die Evangeliumschristen
3.6 Der russische Baptismus
4 Das pädagogische Kultursystem
4.1 Die Familie
4.2 Das Schulwesen
5 Das Gemeindeleben nach dem zweiten Weltkrieg
5.1 Die Frauen als Trägerinnen des Gemeindelebens
5.2 Die Eingliederung in die neue Kirchenlandschaft
5.3 Die Entstehung der Untergrundkirche
6 Die theologischen Prinzipien
6.1 Die Heilige Schrift als Autorität und Maßstab für Lehre und Leben
6.2 Selbständigkeit der Ortsgemeinden
6.3 Das allgemeine Priestertum aller Gläubigen
6.4 Gewissensfreiheit
6.5 Trennung von Kirche und Staat
7 Das Gemeindeverständnis
7.1 Das Wesen der Gemeinde
7.2 Die Praxis des Gemeindelebens
7.3 Heiligung und die Erhaltung der „reinen“ Gemeinde
7.4 Konsequenzen für die Gemeindepädagogik
7.5 Sozialpsychologische Funktion der Gemeinde
8 Missionarische Bemühungen und kirchliche Aktivitäten in Russland und in der ehemaligen Sowjetunion
8.1 Evangelistisch-missionarische Engagement
8.2 Weiterführung im Glauben von Neubekehrten
8.3 Zurüstung von Gemeindemitgliedern
8.4 Ausbildung von Mitarbeitern und Weiterbildung von Leitern
8.5 Publikationstätigkeit
Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Zum Autor
Vorwort
Die im Jahre 2010 heißdiskutierte Veröffentlichung von Thilo Sarrazin „Deutschland schafft sich ab“ hat das Thema der Integration von Einwan- derern in Deutschland neu entfacht. Die Diskussion hat gezeigt, dass so- wohl die einheimische Bevölkerung als auch die Immigranten vor großen Herausforderungen bezüglich der Integration stehen. Aufgrund meiner Er- fahrungen in sechs Ländern und auf drei Kontinenten, in denen ich eine Zeitlang als Ausländer lebte, und intensiver Beschäftigung mit der Integra- tion von Ausländern und Aussiedlern in Deutschland, USA und Kanada habe ich festgestellt, dass sowohl die einheimische Bevölkerung als auch die Einwanderer unter Integration etwas anderes verstehen. Während sich die einheimische Bevölkerung eher eine totale Anpassung der Fremden wünscht, fühlen sich die Immigranten von dieser Erwartung überfordert und tendieren dazu, in eine kulturell-gesellschaftliche Isolation zu fliehen.
Noch schwieriger haben es deutsche Einwanderer aus den ehemaligen Ostblockstaaten, weil sie durch die Rückkehr in die Heimat ihrer Vorfahren zusätzlich in eine große Identitätskrise hineingeraten. Wurden sie in ihren Herkunftsländern als deutsche Faschisten und Nazis verschrien, so müssen sie hier in Deutschland überraschend feststellen, dass sie auf einmal als Russen, Polen oder Rumänen abgestempelt werden.
Eine effektive und gesellschaftsrelevante Integration kann weder durch bedingungslose Assimilierung noch aufgrund von kulturell-gesellschaftli- cher Isolation gelingen. Sie kann nur dann stattfinden, wenn Immigranten zuerst ihre Identitätsfrage geklärt haben. Das trifft vor allem für deutsch- stämmige Einwanderer zu. Bevor sie ein Teil der deutschen Gesellschaft werden können, müssen sie zuerst wissen, wer sie sind und dazu stehen.
Dieser sozialpsychologischer Prozess ist ein sehr wichtiger Schritt der In- tegration. Erst wenn man weiß, wer man ist und die eigene Identität ak- zeptiert, kann man sich effektiv in eine neue Umgebung einleben. Man macht es auch seinen Mitmenschen einfacher, von ihnen richtig einge- schätzt und akzeptiert zu werden, wenn man sich so gibt, wie man wirklich ist. Die Aufgabe oder Ignoranz der eigenen Identität führt zwangsläufig zu kommunikativen Missverständnissen und schließlich zur kulturellen Isola- tion.
Mit der Klärung und Bejahung der eigenen Identität sind die Hausaufgaben der Integration noch lange nicht erledigt. Denn in eine Gesellschaft kann man sich nur dann erfolgreich integrieren, wenn man auch weiß, wie diese Gesellschaft funktioniert und wie ihre Bürger ticken. Das setzt auf Seiten der Einwanderer große Bereitschaft und viel Fleiß voraus, sich mit der Sprache, der Geschichte, den Werten, Traditionen sowie Gebräuchen der neuen Gesellschaft zu beschäftigen. Damit dieser Lernprozess auch tat- sächlich stattfinden kann, müssen seitens des deutschen Staates und seiner Bürger passende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Zusätzlich setzt es aber auch voraus, dass die Bürger des Gastgeberlandes Interesse und Respekt für die kulturelle Andersartigkeit der Einwanderer zeigen.
Der etwas komplizierte Sachverhalt lässt sich mit Hilfe eines Puzzlebildes leicht verdeutlichen. Jeder Bürger und Einwanderer stellt im Bilde gesprochen ein einzelnes Teilchen des Puzzlebildes dar. Die Gesellschaft ist das gesamte Bild, in dem jedes einzelne Teilchen an der richtigen Stelle eingefügt werden muss, um ein harmonisches Gesamtbild zu ergeben. Um das jeweilige Puzzleteilchen an der korrekten Stelle einfügen zu können, muss den Machern des Bildes sowohl das Gesamtbild als auch die Beschaffenheit eines einzelnen Puzzleteilchens bekannt sein.
Wenn wir diesen Vergleich auf den Integrationsprozess anwenden, so be- deutet es für die Einwanderer, dass sie sich mit der eigenen Identität und der deutschen Gesellschaft intensiv beschäftigen müssen. Für die deutsche Gesellschaft heißt es anderseits, dass sie ihre eigenen Werte kennen und, soweit es geht, die Identität der Einwanderer verstehen und respektieren muss. Fehlen diese Voraussetzungen, kann eine erfolgversprechende Integ- ration kaum gelingen.
Die vorliegende Publikation, die einer umfangreicheren Studie zum Thema „Gemeindepädagogik in russlanddeutschen Freikirchen in der Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart“ entnommen wurde, beschäftigt sich ausschließlich mit dem historischen, kulturellen, pädagogischen und theologischen Hintergrund russlanddeutscher Freikirchen. Mitglieder die- ser Glaubensgemeinschaft bestimmten seit mehr als 30 Jahren die deutsche Kirchenlandschaft. Die Integration dieser christlichen Gruppierung in die Gesellschaft und kirchliche Langschaft kann nur dann aussichtsreich statt- finden, wenn die russlanddeutschen Christen ihre historisch-theologische Identität kennen, verstehen, akzeptieren und bereit sind, sie mit anderen Christen in Deutschland zu teilen.
Es setzt aber auch auf Seiten der einheimischen Christen die Bereitschaft voraus, sich mit den eingewanderten Glaubensgemeinschaft zu beschäfti- gen, ihre andersartige Identität zu akzeptieren und soweit es geht, von ihr zu lernen, den christlichen Glauben in einer christenfeindlichen Gesell- schaft zu leben. Denn darin haben russlanddeutsche Christen umfangreiche Erfahrungen, wie die vorliegende Studie zeigt. Sie selbst müssen aber auch bereit sein, von einheimischen Christen zu lernen, wie man den Glauben in einer freien Gesellschaft authentisch lebt und praktiziert. Integration in der Gesellschaft und auch in der kirchlichen Landschaft findet nur dann statt, wenn beide Seiten bereit sind voneinander zu lernen.
Es ist meine Hoffnung, dass diese Arbeit einen kleinen Beitrag für das fruchtbare Miteinander von einheimischen und russlanddeutschen Christen beitragen wird.
Einleitung
In der Zeit von 1950 bis Ende 2010 sind mehr als 4,5 Millionen Aussiedler nach Deutschland eingewandert, von denen etwa 2,3 Millionen aus der ehemaligen Sowjetunion stammen.1 Ca. 500.000 Russlanddeutsche,2 die in den letzten dreißig Jahren nach Deutschland umgesiedelt sind, zählen sich zu den Baptisten, Mennoniten oder anderen freikirchlichen Gruppen. Auch wenn nur etwa ein Fünftel dieser Personengruppe getaufte Gemeinde- mitglieder3 sind, so stellen die russlanddeutschen Gemeinden mit ca. 100.000 Mitgliedern die größte freikirchliche Gruppierung des Landes dar.4 Wenn man das Wachstum der Zahlen der Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher in den russlanddeutschen Gemeinden untersucht, so stellt man fest, dass sie zu den am schnellsten wachsenden und größten Gemeinden des Landes gerechnet werden können. Sie tragen dadurch zur Veränderung der freikirchlichen Landschaft in Deutschland bei.
Wesentliche Ursachen für die Überlebensfähigkeit dieser Gemeinden trotz der starken Verfolgungen in Russland und in der ehemaligen Sowjetunion, aber auch für das schnelle Wachstum in Deutschland können auf ihren historisch-kulturellen und theologischen Hintergrund zurückgeführt werden. Das Ziel dieser Veröffentlichung ist daher, die Kraftquellen dieser Gemeinden anhand des historisch-kulturellen und theologischen Hintergrunds aufzuspüren.
Diese Aufgabe wird bewältigt, indem zuerst der historische und konfessio- nelle Rahmen skizziert und das pädagogische Kultursystem in den deut- schen Siedlungsgebieten und Kolonien dargestellt wird. Es folgen die theologischen Prinzipien und das Gemeindeverständnis russlanddeutscher Freikirchen, die das Gemeindeleben geformt und bestimmt haben. Im letz- ten Teil werden die missionarischen Bemühungen und kirchlichen Aktivi- täten präsentiert.
Der Rückblick in die Vergangenheit ist notwendig, weil das kulturellreligiöse Leben, das von den russlanddeutschen Freikirchen noch in Deutschland durch ihre Frömmigkeit und ihr Gemeinde- und Missionsverständnis zum Ausdruck gebracht wird, nur von ihrer Vergangenheit zu erklären und zu verstehen ist.
Beim Rückblick auf die Vergangenheit wird bei Bedarf an einigen Stellen auch Bezug auf das gegenwärtige Erscheinungsbild russlanddeutscher Freikirchen in Deutschland genommen. Ausführlich wird dieses Thema jedoch im Folgeband „Russlanddeutsche Evangelikale - Band 2“ behan- delt.5 Die Ergebnisse dieser Veröffentlichung basieren auf einer ausführli- chen Umfrage, die vom Autor im Rahmen seiner Dissertation im Jahre 1996 durchgeführt wurde und deren Schlussfolgerungen immer noch aktu- ell sind.
Bevor ausführlich auf den Hintergrund russlanddeutscher Freikirchen ein- gegangen wird, sollen hier kurz statistische Angaben zu den Aussied lerzahlen und deren Konfessionszugehörigkeit in Deutschland gemacht werden.
1 Allgemeiner Überblick: Russlanddeutsche in Deutschland
1.1 Statistische Angaben zu den Aussiedlerzahlen
In der Zeit von 1950 bis 2005 sind 4.481.882 Aussiedler nach Deutschland eingewandert: 2.334.334 aus der ehemaligen Sowjetunion, 1.444.847 aus Polen, 430.101 aus Rumänien, 105.095 aus der ehemaligen CSFR, 90.378 aus dem ehemaligen Jugoslawien, 21.411 aus Ungarn und 55.716 aus sons- tigen Gebieten.6 7
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Aussiedlerzahlen 2005
Die Statistik und die politisch-wirtschaftliche Situation in den Herkunfts- ländern der Aussiedler sprechen dafür, dass das zahlenmäßige Verhältnis sich auch in Zukunft kaum ändern wird. Auch wenn die allgemeine Zahl der Aussiedler in Deutschland zurückgeht, muss davon ausgegangen wer- den, dass in den nächsten Jahren immer noch viele Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland einwandern werden.8 Dieser Trend hat Auswirkungen auf die christlichen Gemeinden der russlanddeut- schen Freikirchen.
1.2 Konfessionszugehörigkeit der Russlanddeutschen
Als Ergänzung zu den Zahlen der Aussiedler soll hier die Konfessionszugehörigkeit der Russlanddeutschen präsentiert werden. Da es bei dieser Veröffentlichung um russlanddeutsche Freikirchen geht, sollen diese etwas detaillierter vorgestellt werden.
Allgemeine Informationen
1976, als die Zahl der Einwanderer aus der Sowjetunion noch nicht so hoch war, sah die Konfessionszugehörigkeit der Russlanddeutschen fol- gendermaßen aus: 41,3% Evangelische Christen, 30,8 % Katholiken, 16,4% Baptisten, 8,5% Mennoniten, 3% andere konfessionelle Gruppen.9
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Konfessionszugehörigkeit 1976
30 Jahre später, im Jahre 2005 sehen die Zahlenverhältnisse wie folgt aus: 42,2% der Einwanderer waren evangelisch, 12,4 % katholisch, 20,6 % Orthodox und 6,5 % gehörten anderen Konfessionen an.10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Konfessionszugehörigkeit 2005
Die hohe Zahl der orthodoxen Einwanderer aus der Ehemaligen Sowjet- union ist dadurch zu erklären, dass in den letzten Jahren vermehrt russisch- stämmige Immigranten nach Deutschland gekommen sind. In den Reihen der Aussiedler sind es auch oft Familien, wo ein Elternteil deutschstämmig und der andere russischstämmig ist. Wir sprechen hier kulturell von Mischehen.
Russlanddeutsche Christen mit freikirchlichem Hintergrund
Aufgrund des ununterbrochenen Zuzugs von Aussiedlern und weil die meisten russlanddeutschen Gemeinden weder eine Statistik führen noch bereit sind, Zahlen herauszugeben, ist es schwierig, genaue Angaben zu den russlanddeutschen Freikirchen zu machen. Laut den Untersuchungen von John N. Klassen kann von etwa 420.000 russlanddeutschen Personen ausgegangen werden, die sich im Jahre 2006 entweder zu den Baptisten oder Mennoniten zählten.11 Etwa 94.000 davon zählen zu getauften Mit- gliedern einer örtlichen Gemeinde.12 „Die übrigen sind [laut Klassen] eth- nische Mennoniten oder ethnische Baptisten (einschließlich Kinder und Erwachsene, die an den Versammlungen teilnehmen, aber nicht selbst Mitglieder sind)“.13 Im Jahr 2010 können wir bei vorsichtiger Schätzung von ungefähr 500.000 Baptisten/Mennoniten und ihren Angehörigen ausgehen. Davon zählen etwa 100.000 zu getauften Mitgliedern.
Wenn man diese Zahl mit den Mitgliedskirchen der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) vergleicht, so ergibt sich ein folgendes Bild:14
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Aussiedler im Vergleich zu anderen Freikirchen 1997/2010
1.3 Überregionale Strukturen der russlanddeutschen Freikirchen
Da es in dieser Arbeit um die Freikirchen täuferischer Prägung geht, be- schränke ich mich auf die baptistisch-mennonitischen Gruppierungen. Die Glaubenstaufe wird außerdem bei den Pfingstlern, den Adventisten und der Gemeinde Gottes praktiziert, die jedoch nicht Gegenstand der Untersu- chung sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Klassifizierung der russlanddeutschen Freikirchen. Man kann sie nach ihren Verbänden oder nach ihrer Zugehörigkeit zur mennonitischen oder baptistischen Richtung einteilen.
1.3.1 Der mennonitische Flügel
Arbeitsgemeinschaft zur geistlichen Unterstützung in Mennonitengemeinden (AGUM)15
Diese Arbeitsgemeinschaft stellt einen Dachverband der sogenannten kirchlichen Mennonitengemeinden dar.16 Zusammen mit einigen einheimi schen Gemeinden zählte diese Arbeitsgemeinschaft im Jahre 2004 5.335 Mitglieder in 27 Gemeinden.17 Die Zielsetzung dieser Gruppe war anfänglich die Betreuung neu angekommener Aussiedler. Nach und nach hat sich diese Arbeitsgemeinschaft mehr zu einem festen Dachverband entwickelt, der einen Verlag, ein Missionswerk, eine Zeitschrift und eine Gemeindebibelschule unterhält.18 Weder zu den Baptisten noch zu den Mennonitenbrüdern bestehen seitens dieser Gruppe enge Kontakte.19
Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden in Deutschland (AMBD) und Verband der Evangelischen Freikirchen Mennonitischer Brüdergemeinden in Bayern (VMBB)
Die AMBD entstand im Jahre 1960, als sich Vertreter der Mennonitenbrü- der in Nordamerika um mennonitische Flüchtlinge nach dem zweiten Weltkrieg kümmerten.20 Im Jahre 2008 betrug die Zahl der Mitglieder ca.
1.623 in 15 Gemeinden.21 Die Gemeinden der AMBD setzen sich aus ein- heimischen, süd- und nordamerikanischen und russlanddeutschen Christen zusammen. Der Verband arbeitet eng mit einigen russlanddeutschen Ge Ausrichtung als auch im religiösen Erscheinungsbild kann man heute in Deutsch- land keine wesentlichen Unterschiede zwischen diesen zwei Gruppen feststellen. Im Jahre 2010 verfassten die Vertreter der Mennonitenbrüder (Bund Taufgesinnter Gemeinden und Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Brüdergemeinden in Deutsch- land) ein „Statement der Aussöhnung - Pfingsten 2010“, in dem sie sich bei den Vertretern der kirchlichen Mennoniten für das falsche Verhalten ihren Glaubensge- schwistern gegenüber entschuldigen. Dort heißt es: „Wir wollen unser Fehlverhal- ten der geistlichen Überheblichkeit, wann immer sie auch im Verlauf des Bestehens der Mennoniten-Brüdergemeinde zum Ausdruck kam, als sündhaft bekennen und um Vergebung bitten.“ Klassen, Jesus Christus leben 227. Das war ein sehr wichti- ger und notwendiger Schritt, der erst nach 150 Jahren des Bestehens der Mennoni- tenbrüder erfolgte. meinden und Verbänden zusammen,22 sieht sich aber nicht als ein Teil der russlanddeutschen Freikirchen. Die Theologie und das Glaubensbekenntnis der AMBD sind in beidem den nordamerikanischen Mennonitenbrüdern ähnlich.23
Der VMBB steht in der AMBD Tradition und zählte im Jahre 2008 306 Mitglieder in 5 Gemeinden, die auf Gemeindegründungsaktivitäten der AMBD in Bayern zurückzuführen sind.24
Arbeitsgemeinschaft der WEBB-Gemeinden
Die lose Arbeitsgemeinschaft der vier WEBB-Gemeinden (Wolfsburg, Es- pelkamp, Bechterdissen und Bielefeld) zählte im Jahre 2004 1.617 Mit- glieder.25 Die Mehrheit der Mitglieder hat einen russlanddeutschen oder russlanddeutsch-südamerikanischen kulturellen Hintergrund. Theologisch sind diese Gemeinden der täuferisch-mennonitischen Tradition zuzuord- nen.
Unabhängige Gemeinden mennonitischer Prägung (UGM)
Diese Gemeinden sind statistisch schwer zu erfassen, weil immer wieder neue Gemeinden ins Leben gerufen werden. Nach den Recherchen von John N. Klassen umfasste diese Gruppe 2008 etwa 4.757 Mitglieder in 32 Gemeinden. Trotz ihrer Unabhängigkeit haben diese Gemeinden einen en- gen Kontakt zur Bruderschaft der Christengemeinden in Deutschland, zum Bund Taufgesinnter Gemeinden oder zu anderen russlanddeutschen Ge- meindeverbänden.
1.3.2 Der baptistische Flügel
Vereinigung der EvangeliumsChristen-Baptisten (VEChB)
Dieser Verband wurde im Jahre 1976 ins Leben gerufen, nachdem mehrere Christen aus den Reihen der Evangeliumschristen-Baptisten nach Deutsch- land gekommen waren.26 Von Anbeginn sah sich diese Gruppe sehr eng mit der Untergrundkirche in der ehemaligen Sowjetunion verbunden.27 Diese Verbindung, die bis heute noch besteht, wurde insbesondere durch das Missionswerk „Friedensstimme“ repräsentiert. Dieses Werk sah sich als Vertreter der leidenden Evangeliumschristen-Baptisten in der Zeit der Verfolgung.28 Die VEChB-Gemeinden sind in der Regel sehr konservativ und pflegen nur wenige Kontakte zu anderen Gemeindeverbänden und einheimischen Christen.29 In den letzten Jahren hat die VEChB mehrere Teilungen erlebt, die sie 1995 auf etwa 38 Gemeinden und 5.000 Gemein- demitglieder schrumpfen ließ.30 Bis 2004 ist diese Gruppe auf 9.071 Mit- glieder in 72 Gemeinden und Gemeindefilialen angewachsen.31 Zu den kirchlichen Mennoniten und teilweise auch Mennonitenbrüdern hat man allgemein wenig Kontakt.
Bruderschaft der EvangeliumsChristen-Baptisten (BEChB)
Diese Gruppe formierte sich im Januar 1993. Der Kern dieser Gruppe kommt ursprünglich aus der VEChB. Die Bruderschaft trennte sich von der Vereinigung, weil diese für die Bruderschaft zu offen wurde und in ihren Augen nicht konservativ genug war. Zusätzlich hatte man Mühe mit der straffen Leitungsform der VEChB. Von ihrer Theologie und ihrem Gemeindeverständnis her gesehen kann die BEChB zum baptistischen Flügel der russlanddeutschen Freikirchen gerechnet werden. Die Bruderschaft möchte jedoch noch konservativer als die VEChB sein und legt großen Wert auf die Selbständigkeit der Gemeinden.32 Im Jahre 2004 zählte die BEChB 6.801 Mitglieder in 62 Gemeinden.33
Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Gemeinden (AeG) und Arbeitsgemeinschaft freier Gemeinden (DeG)
Die AeG entstand im September 1993 unter dem Namen „Arbeitsgemein- schaft unabhängiger und bibeltreuer Gemeinden“ und zählte 2004 2.342 Gemeindemitglieder in 13 Gemeinden.34 Die Vertreter der AeG stellten ursprünglich den progressiven Flügel der VEChB dar.35 Nachdem sie es nicht geschafft hatten, das Ruder der Vereinigung in eine offenere Rich- tung umzuschlagen, haben sie sich von ihr getrennt. Genauer gesagt, sie wurden aus der Vereinigung ausgeschlossen, weil sie für die konservativen Christen zu unbequem wurden. Bezüglich ihrer Theologie und ihrem Ge meindeverständnis können sie als progressive Baptisten gesehen werden. Im November 1996 wurde der Name „Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Gemeinden“ angenommen.
Die Arbeitsgemeinschaft freier Gemeinden ist eine jüngere Gruppe, die sich auch von der VEChB getrennt hat. Sie ist in ihrer Ausrichtung der AeG sehr ähnlich und zählte 2004 2.105 Gemeindemitglieder in 10 Ge- meinden.36
Unabhängige Gemeinden baptistischer Prägung (UGB)
Die unabhängigen Gemeinden in diesem Flügel bildeten im Jahre 2004 eine Gruppe von 13.070 Gemeindemitgliedern in ca. 114 Gemeinden.37 Sie pflegen in der Regel einen guten Kontakt zur Bruderschaft der Chris- tengemeinden in Deutschland oder zum Bund Taufgesinnter Gemeinden.38
Russlanddeutsche Baptisten im Bund Evagenlisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG)
Ein Teil der eingewanderten Baptisten aus der Sowjetunion und den Nach- folgestaaten schloss sich dem Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein- den in Deutschland (Baptisten- und Brüdergemeinden) an. Zuerst wurde diese Gruppe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der Evangeliumschris- ten-Baptisten unter dem Dach des BEFG aktiv betreut.39 Die Anfänge die- ser Arbeitsgemeinschaft, die sich im Jahre 1990 formierte, sind in den siebziger Jahren zu suchen.40 Der Initiator seitens der Baptisten war Günter Wieske, der wie kein anderer Christ im Westen sich unermüdlich um die Integration von Aussiedlern bemühte. Die Arbeitsgemeinschaft zählte im Juni 1997 etwa 6.200 Mitglieder in 40 Gemeinden und kleineren Grup- pen.41
Außerdem haben seit Beginn der Rückwanderung viele russlanddeutsche Christen direkt in den bestehenden Gemeinden des Bundes Evangelisch- Freikirchlicher Gemeinden eine geistliche Heimat gefunden.42 Inzwischen wurde die Arbeitsgemeinschaft aufgelöst und die russlanddeutschen Ge- meinden in den BEFG integriert. Die genaue Zahl russlanddeutscher Chris- ten im BEFG lässt sich schwer ermitteln, weil diese Christen und Gemein- den nicht extra geführt werden. Laut dem Aussiedlerbeauftragten im BEFG Pastor Rudolf Janzen kann Zahl zwischen 6.000 bis 10.000 liegen.43
1.3.3 Der gemischte Flügel
Ein Teil der russlanddeutschen Freikirchen kann sowohl dem baptistischen als auch dem mennonitischen Flügel zugeordnet werden. Diese Gemeinden werden in dieser Arbeit als „gemischter“ Flügel bezeichnet.
Bruderschaft der Christengemeinden in Deutschland (BCD)
Diese Gemeinden haben sich im Sommer/Herbst 1989 zum Dachverband vieler Aussiedlergemeinden formiert, die in Russland zu den registrierten Gemeinden gehörten.44 Sowohl in ihrer Theologie als auch in der Zusam- mensetzung der Leitung und ihrer Gemeindemitglieder können sie als bap tistische Mennonitenbrüder gesehen werden. Etwa die Hälfte der Mitglie- der der Gemeinden sieht sich als Vertreter der Mennonitenbrüder. Die an- dere Hälfte der Mitglieder fühlt sich zum baptistischen Flügel hingezo- gen.45 Im Jahre 2004 zählte dieser Verband 19.693 Mitglieder in 86 Ge- meinden.46 Auch dieser Verband unterhält kaum Kontakte zu anderen Ver- bänden und einheimischen Christen. Theologisch vertreten sie die Linie des Allunionsrates der Evangeliumschristen-Baptisten in Russland. Die ersten Vertreter dieser Gruppe hatten sich im Jahre 1976 von der Vereini- gung der Evangeliumschristen-Baptisten getrennt, weil diese von den ehemals in der Sowjetunion registrierten Christen Reue und Buße für ihre loyale Haltung zur Regierung forderten. Dies trennt diese Verbände immer noch, obwohl sie sich in vielen ethischen und theologischen Fragen einig sind. Beide legen großen Wert auf Gemeindezucht und eine straffe Bun- des- und Gemeindeleitung.
Bund Taufgesinnter Gemeinden (BTG)
Der BTG bildet eine Arbeitsgemeinschaft von Gemeinden, die entweder einen baptistischen oder mennonitischen Hintergrund haben. Dieser Ver- band mit 26 Gemeinden, der 2008 6.359 Gemeindemitglieder zählte,47 kann auch zum progressiven Flügel der russlanddeutschen Freikirchen ge- rechnet werden. Der Schwerpunkt dieser Gemeinden liegt primär nicht in der Einhaltung festgeschriebener Gemeinderegeln, sondern in der Mission und in der theologischen und praktischen Zurüstung von Gemeindemit- arbeitern. Die Zurüstung geschieht wesentlich durch das Bibelseminar Bonn.48
2 Die Geschichtsperioden
Die Geschichte der Russlanddeutschen und ihrer Kirchen lässt sich am besten anhand von Perioden darstellen.49 Sie werden hier knapp zusammengefasst, weil zur Geschichte der Russlanddeutschen bereits ausführliche Publikationen existieren.50
2.1 Periode des Aufbaus (1763-1860/70)
Im Jahre 950 bat die Fürstin Olga von Kiew König Otto I., deutsche Chris- ten als Missionare ins Russische Reich zu schicken. Von der Zeit an sollen immer wieder Deutsche ins Russische Reich gezogen sein.51 Später waren es Kaufleute, Handwerker, Künstler, Wissenschaftler und andere Fachleu- te, die von russischen Behörden ermutigt wurden, am Aufbau des Russi- schen Reiches teilzunehmen. Viele folgten diesem Ruf und ließen sich in den Städten nieder. Die Akademie der Wissenschaften, die von Peter dem Großen im Jahre 1725 gegründet wurde, führt in ihrem Verzeichnis in den Jahren 1725-1799 68 Personen, deren Muttersprache Deutsch war.52 Pe- tersburg zählte im Jahre 1869 46.500 Deutsche; sie stellten die größte aus- ländische Volksgruppe der Hauptstadt dar.53 Diese Zahl wuchs im Jahre 1897 auf 50.780. Insgesamt wurden im Jahre 1897 129.000 Deutsche ge- zählt, die im Russischen Reich mit deutscher Staatsangehörigkeit lebten.
Zusätzlich nahmen 325.000 Deutsche die russische Staatsangehörigkeit an und assimilierten sich in der russischen Gesellschaft.54
Neben den Immigranten aus Deutschland, die in die Städte zogen und da- her auch als Stadtbewohner bezeichnet wurden, kam eine zweite Gruppe von Deutschen nach Russland. Sie wurden von der Zarin Katharina II., ge- borene Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, nach Russland geru- fen. Diese Einwanderungswelle aus dem Jahre 1763 bestand fast aus- schließlich aus Landwirten, die aus Hessen, Baden, Württemberg, der Pfalz und anderen Gebieten nach Russland kamen, um die weiten Steppen des großen Reiches zu besiedeln.55 Am 20. Juli 1789 ließen sich auch die ers- ten Mennoniten aus Westpreußen in der Ukraine nieder.56
Den deutschen Stadtbewohnern und Bauern wurden viele Vorrechte einge- räumt, die sie in ihrem Herkunftsland nicht besaßen: 1. Religionsfreiheit;
2. Freiheit von Steuern auf dem Lande (10-30 Jahre) und in der Stadt (10 Jahre); 3. Freiheit vom Militärdienst; 4. Selbstverwaltung der Gemeinden und Schulen; 5. Land für Siedler; 6. Privilegien für Kinder, die in Russland geboren wurden; 7. Freiheit, das Land wieder zu verlassen.57
2.2 Periode des Höchststandes (1860/70-1914/1928)
Trotz mancher Beschränkungen seitens der Regierung, verursacht durch das Aufkommen des Panslawismus bzw. des russischen Nationalismus, haben sich die Deutschen in der Zeit ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg mit großem Abstand von der russischen Bevölkerung zu der - wirtschaftlich gesehen - erfolgreichsten Volksgruppe des Russischen Reiches entwickelt. Mit dem Beginn des ersten Weltkrieges sollte alles anders werden.58
2.3 Periode der Auflösung (1914/1928-1941/45)
In Verbindung mit dem Beginn des ersten Weltkrieges wurde der öffentli- che Gebrauch der deutschen Sprache unter Strafe gestellt. Ein Jahr später mussten 150.000 Wolhyniendeutsche im Rahmen einer Deportation ihre Heimat verlassen. Die russische Regierung befürchtete nämlich, dass sie sich den herannahenden deutschen Truppen anschließen würden. Ein gro- ßer Teil der Deutschen überlebte diese Deportation nicht.59 Die Revolution im Jahre 1917 verhinderte die Deportation weiterer Deutscher aus dem Wolga- und Schwarzmeergebiet.
Der nach der Revolution tobende Bürgerkrieg in den Jahren 1918-1921 ging an den Russlanddeutschen nicht spurlos vorbei. Durch die Hände von Anarchisten wie Machno wurden ganze Familien grausam hingerichtet. In den Listen der ermordeten Personen wird die Todesursache mit Ausdrücken wie „erschossen“, „zerhackt“, „verbrannt“, „erwürgt“ und „erschlagen“ bezeichnet.60 Diesen Verbrechen fielen nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Säuglinge zum Opfer, die in der Wiege verbrannt oder an der Mutterbrust getötet wurden.61
Der erste Weltkrieg und die Wirren des Bürgerkrieges trugen dazu bei, dass die Zahl der Russlanddeutschen von 2,4 Millionen Menschen im Jahre 1914 auf 1,2 Millionen im Jahre 1926 schrumpfte.62
Nach der Machtübernahme Stalins im Jahre 1928 kam es zu erneuten Verfolgungen. Die rigorose Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft trug zur Enteignung des Besitzes der Deutschen bei. Ländereien, bäuerliche Betriebe, Fabriken und alles Eigentum der Deutschen wurden konfisziert und ein Teil der Besitzer, die als Kulaken bezeichnet wurden, zwangsweise nach Sibirien oder Kasachstan umgesiedelt. „Rund 50 000 deutsche Kulaken wurden deportiert, sie verschwanden - wie Kulaken anderer Nationalitäten - in Lagern, sofern sie nicht verhungerten“.63
Die wirtschaftlichen und politischen Missstände des Landes führten in den Jahren 1932-1933 in den deutschen Kolonien zur großen Hungersnot, der etwa 350.000 Deutsche zum Opfer fielen. Spätere Nachforschungen haben bewiesen, dass diese Hungersnot von Stalin gewollt war, um den Willen der Bevölkerung zu brechen.64
zerhacken. Wütend schlug er auf sie ein, als ob er Kohlköpfe zu zerstückeln habe. Schwitzend und erschöpft hielt er inne. Eilig sprang Ljutschtschenko hinzu. Andere folgten. Das Ergebnis: an Stelle lebendiger Menschen ein Haufen verstümmelter, blutiger Leichen, Köpfe liegen herum und Hände mit gekrümmten Fingern. Machno, der ruhig und mit irrsinnigen Lächeln zugesehen hatte, wie seine ‘braven Jungens’ sich abmühten, rafft sich unerwartet auf, geht zum Leichenhaufen und springt und trampelt auf Köpfen und Leibern der Toten herum. Die Stiefel sind mit Blut verschmiert. Eine Minute später sagt er ruhig: ‘I toljko!’“ Ebd., 124-133, zit. in Peters, Machno 120.
Der aufkommende Nationalsozialismus in Deutschland verschlechterte die Situation der Deutschen in Russland.65 Schon ein Jahr nach der Machter- greifung Hitlers wurden in der Sowjetunion Listen mit Deutschen angelegt und Pläne für ihre Deportation ausgearbeitet. Es kam in den folgenden Jah- ren zu Umsiedlungsaktionen, zu Auflösung deutscher Siedlungen und zu Massenverhaftungen von deutschen Männern. Allein die Mennoniten hat- ten in den Jahren 1936-1939 den Verlust von etwa 15.000 Männern zu be- klagen, die verhaftet, verurteilt und ermordet wurden.66 Die stalinistische Säuberungsaktion traf viele ethnische und soziale Gruppen, besonders die Intellektuellen, die Lehrer und die geistlichen Leiter der Glaubensgemein- schaften. Man deklarierte sie als Staatsfeinde und viele wurden willkürlich der Spionage verdächtigt. Die Funktionäre des Staates hatten den Auftrag, eine bestimmte Verhaftungsquote pro Verwaltungsregion zu erreichen. Kamen sie dieser Aufgabe nicht nach, drohte ihnen selbst eine Verhaf- tung.67 Die Situation verschlechterte sich noch zum Ende der 30er Jahre.68
Der Beginn des zweiten Weltkrieges brachte neues Elend für die Russ- landdeutschen, deren Ausmaß hier nicht in Kürze beschrieben werden kann. Die noch lebenden Männer wurden verhaftet und in die stalinisti- schen KZ gebracht, die man als Arbeitsarmee (Trudarmija) bezeichnete.69
Die in der Krim, Ukraine und im Wolgagebiet lebenden Deutschen, deren Familien fast nur noch aus Frauen und Kindern bestanden, verbannte man nach Sibirien, Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan und in andere Gebiete Russlands. Diese Zwangsdeportation wurde mit der Befürchtung begrün- det, die Deutschen könnten mit der einrückenden deutschen Wehrmacht kollaborieren.70 Von Juli bis September 1941 verloren etwa 900.000 Deut- sche ihre Heimat und mussten unter schweren Umständen um ihr Dasein kämpfen.71 „Die rasche Besetzung der Gebiete westlich des Dnjepr durch deutsche Truppen kam der Deportation weiterer 350.000 Deutscher zu- vor“.72
Als sich der Kriegsverlauf änderte und die deutsche Wehrmacht auf dem Rückzug war, wurden im Januar 1943 200.000 Russlanddeutsche aus den besetzten Gebieten nach Westpolen im Warthegau umgesiedelt. Die Russ- landdeutschen, die es nicht mehr schafften, mit der deutschen Wehrmacht zu fliehen, wurden von der Roten Armee nach Sibirien und Mittelasien verschleppt. Das gleiche Schicksal ereilte im Januar 1945 auch die 150.000 Deutschen aus der Sowjetunion, die aus dem Warthegau nicht mehr in die westlichen Besatzungszonen gelangen konnten. Der Hälfte der 150.000 Sowjetdeutschen, denen die Flucht in den Westen gelang, wurden von den West-Alliierten der UdSSR überstellt. Auch sie mussten das Schicksal der anderen Verbannten teilen. Die Deportation kostete etwa 80.000 Russ- landdeutschen das Leben.73
zu Zwangsarbeit in der Trudarmee verurteilt. Ein Schwager ist kurz danach im Gefängnis gestorben, die anderen konnten überleben.
2.4 Periode der Ceuorientierung (1945-1970)
Allein durch die Zwangsumsiedlungen des zweiten Weltkrieges wurden etwa 800.000 Deutsche aus dem Südwesten Russlands in den Norden und Osten umgesiedelt.74 Alle Kolonien im europäischen Teil des UdSSR - au- ßer den Orenburg-Siedlungen - wurden aufgelöst.75 Anstelle einer Heim- kehr nach den Wirren der Krieges ereilte alle Deutschen das Schicksal der Verbannung, in der sie bis 1955/1956 um ihr Überleben kämpfen mussten: „Etwa 1,5 Millionen Russlanddeutsche, vom Säugling bis zum Greis, wa- ren im Gewahrsam“.76
Das am 13. Dezember 1955 unterschriebene Dekret „Über die Aufhebung der Beschränkungen in der Rechtsstellung der Deutschen und deren Fami- lienangehörigen, die sich in Sondersiedlungen befinden“ hat den Deut- schen die Freiheit gegeben, die Verbannungsorte zu verlassen, doch in ihre Heimatorte durften sie nicht zurückkehren. Sie wurden sogar verpflichtet, eine Erklärung zu unterschreiben, dass sie nie wieder in ihre ehemaligen Wohngebiete zurückkehren werden.77 Sie zogen daher in die asiatischen Teile der Sowjetunion und blieben bis zu ihrer Auswanderung nach Deutschland Vertriebene im eigenen Lande.78 Die Flucht in das Land ihrer Vorfahren wurde daher zum einzigen Ausweg aus dieser unerträglichen Situation.79
2.5 Periode der Auswanderung (1970-1995)
Schon seit 1951 sind sporadisch Deutsche aus der ehemaligen SU nach Deutschland gekommen. Jedoch erst nach dem Abschluss der Ostverträge im Jahre 1972 schwoll der Strom der russlanddeutschen Aussiedler an.80 Die Gründe der Auswanderung, die bis heute noch anhält, sind folgende:81
(1) Das Trauma der Vergangenheit. Vertreibung, Leid, Verfolgung, Dis- kriminierung und Tod in den Reihen der Aussiedler haben bei ihnen Wun- den und Angst zurückgelassen, die bis heute nicht geheilt sind. (2) Die Verfolgungen der Christen. Abgesehen von der Anfangszeit und den Jah- ren 1917-1928, in denen die Kirchen relative Freiheit in der Ausübung ih- res Glaubens genossen, erlebten die deutschen Christen schwere Verfol- gungen. Sie waren es daher auch, die als erste Anträge auf Ausreise nach Deutschland stellten. Die Nichtchristen trafen erst viel später die Entschei- dung, auszureisen.82 (3) Der Wunsch, die deutsche Kultur ausleben zu kön- nen. Der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erwachte russische Na- tionalismus wandte sich auch gegen die kulturellen Bemühungen der Deut- schen in Russland. Seit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges begann der Prozess der Auflösung der deutschen Kultur. Das Verbot des Gebrauchs der deutschen Sprache und die Deportation von Wolhyniendeutschen im Jahre 1914 bildeten den Anfang der Maßnahmen der russischen Regierung gegen das kulturelle Leben der Russlanddeutschen. Die Familie und die Glaubensgemeinschaft bildeten schließlich den einzigen Raum, in dem die deutsche Sprache und Kultur gepflegt werden konnten.83 (4) Die unsichere wirtschaftliche und politische Lage in der GUS.84 Vielen Deutschen, die sich der kommunistischen Ideologie verschrieben hatten, wurde die Mög- lichkeit eingeräumt, ein Hochschulstudium zu absolvieren. Aufgrund ihres Fleißes und ihrer Loyalität bekamen sie gelegentlich in der Wirtschaft und im öffentlichen Leben einflussreiche Positionen. Doch das hat sich in den letzten Jahren geändert. Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage verloren viele ihren Arbeitsplatz. Zusätzlich trug der wachsende Nationa- lismus in den ehemaligen Republiken, die jetzt selbständige Staaten waren, dazu bei, dass sowohl Russen als auch Deutsche ihren Platz in der Wirt- schaft und im öffentlichen Leben zugunsten Einheimischer räumen muss- ten. Nicht selten wurde ihnen und den Russen deutlich gemacht, dass sie nicht gern gesehene Bürger des Landes sind. In den letzten Jahren kam es sogar zu Übergriffen, bei denen mehrere Deutsche getötet wurden. (5) Familienzusammenführung. Die Auswanderung der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion hat auf die zurückgebliebenen Deutschen eine Art Sogwirkung gehabt, „die von den bereits ausgereisten Russlanddeutschen ausging“.85 Sie wurde durch die Ausreiseerleichterung Ende der 80er Jahre und die politisch-wirtschaftliche Instabilität im Lande begünstigt.
3 Die konfessionellen Gruppierungen
Die Deutschen hatten nicht nur ihr Hab und Gut in das Russische Reich mitgebracht, sondern auch ihre Religion. Von den in der Zeit von 1763- 1862 nach Russland eingewanderten etwa 100.000 Deutschen waren 55% Protestanten (Lutheraner und Reformierte), 34% Katholiken und 11% Mennoniten.86 Nicht selten war gerade die Frage der Religionsfreiheit der Hauptgrund der Auswanderung nach Russland. Abgesehen von einigen Beschränkungen - so durften die Mennoniten unter den orthodoxen Chris- ten zum Beispiel nicht missionieren87 - bekamen die Deutschen von der Regierung für sich und ihre Nachkommen Religionsfreiheit, die ihnen die Möglichkeit einräumte, ihren Glauben zu leben.88 Nach Hans Hecker sah die Aufteilung der Religionsgemeinschaften der Deutschen (Muttersprach- ler) im Jahre 1897 wie folgt aus:89
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Religionsgemeinschaften der Deutschen im Jahre 1897
Auch wenn es in dieser Arbeit primär um die baptistisch-mennonitischen Freikirchen geht, dürfen auch die großen Kirchen nicht unerwähnt bleiben, weil aus ihnen zum Beispiel die ersten deutschen Baptisten kamen.
3.1 Römisch-katholische Kirche
Von Beginn an wurden die katholischen Christen von ihrer Kirche seelsor- gerlich betreut. Franziskaner, Kapuziner, Dominikaner, Trinitarier und Je- suiten, die im Jahre 1820 in Deutschland des Landes verwiesen wurden, waren aktiv in den deutschen Kolonien in Russland. Im Jahre 1847 beka- men sie eine eigene Kirchenverwaltung und im Jahre 1856 übernahm in Saratow ein Priesterseminar die Ausbildung des Priesternachwuchses.90 91 Das kirchliche Leben der Römisch-katholischen Kirche wurde in der Zeit der Verfolgung durch die systematische Schließung der Kirchen und die berufliche und physische Vernichtung der Geistlichkeit praktisch ausge- löscht. Von den 1195 Kirchen und Kapellen im Jahre 1918 blieben im Jah- re 1938 nur noch zwei offen.92 Erst nach Stalins Tod und besonders seit der Zeit der Perestroika konnte das kirchliche Leben wieder aufgenommen werden. Leider nimmt die anfängliche religiöse Freiheit der Perestroika- Ära in den letzten Jahren immer mehr ab. Sowohl die Russisch-Orthodoxe Kirche als auch die moslemischen Regierungen der asiatischen Länder schränken die religiöse Freiheit der deutschen Christen immer mehr ein. Diese Entwicklung trifft auf alle Kirchen und Glaubensgemeinschaften zu, die im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.
3.2 Evangelische Gemeinden
Die evangelisch-lutherischen Gemeinden bildeten von Anbeginn die größte Protestantische Kirche des Landes. Im Jahre 1832 vereinigten sich die finnischen, schwedischen, lettischen und estnischen Christen zur „Evangelisch-Lutherischen Kirche Russlands“. Auch in Südrussland waren die Lutheraner weit verbreitet.93
Die Evangelisch-Reformierte Kirche fand in Russland ebenfalls eine weite Verbreitung durch die Einwanderung von Deutschen. Im Jahre 1820 kamen die reformierten Gemeinden unter die Aufsicht des „Generalkonsistoriums der Evangelischen Kirche in Russland“. Seit der Zeit wurden diese Gemeinden sehr stark von lutherischen Pfarrern unterwandert, so dass mit der Zeit die Unterschiede zwischen diesen zwei Richtungen der Evangelischen Kirche verwischt wurden.94
Auch die deutschen Pietisten fanden in Russland einen großen Anklang. Besonders der württembergische Pietismus trug dazu bei, dass in Südruss- land unter den deutschen Kolonisten eine Erweckung ausbrach. Außerdem war der Pietismus Mitursache dafür, dass im Russischen Reich sowohl der Baptismus als auch die Mennonitenbrüder entstehen und sich ausbreiten konnten.95 Auf die Tätigkeit des Pietisten Pastor Eduard Wüst ist die Erweckungsbewegung unter den Mennoniten Mitte des 19. Jahrhunderts zurückzuführen.96
3.3 Die Mennoniten
Die Mennoniten, die sich als Nachfahren der Täufer des 16. Jahrhunderts verstehen, haben sich im Jahre 1789 in Südrussland niedergelassen, nach- dem sie ihre Heimat in Westpreußen verlassen hatten.97 Den Namen Men- noniten haben sie Menno Simons, einem ehemaligen Priester, zu verdan- ken. Während der Verfolgung der Täufer floh eine Gruppe von ihnen nach Holland, wo sie mit Menno Simons zusammentrafen. Der übernahm dann die Führung dieser Gruppe. Sehr früh bekamen sie den Namen „Mennisten“ und später Mennoniten. Auch in Süddeutschland wurden die Täufer so genannt, obwohl sie nie unter dem Einfluss von Menno Simons gestanden hatten.98 Viele Mennoniten ließen sich auf der Flucht in den Ostseeküstengebieten von Danzig bis zum Memelland nieder. Hier wurden sie zu den wohlhabendsten und erfolgreichsten Bauern ihrer Gegend. Doch es blieb nicht lange so. Die preußische Regierung unter Friedrich Wilhelm II. beschränkte die Ausweitungsmöglichkeiten der Mennoniten immer mehr. Ebenso waren die religiöse Freiheit und die Befreiung vom Wehr- dienst nicht mehr garantiert.99 Der Ruf der Zarin Katharina war ihnen in dieser Situation sehr gelegen. Denn sie versprach ihnen Vorrechte, die sie in Preußen immer mehr verloren. Bis zum ersten Weltkrieg bzw. dem Bür gerkrieg haben sich die Mennoniten zu reichen Bauern und Fabrikanten entwickelt, deren Kolonien in ganz Russland bekannt waren.
Nicht nur das landwirtschaftliche Können brachten die Mennoniten nach Russland, sondern auch den Glauben ihrer Väter. Die Grundlinien des mennonitischen Glaubens haben ihre Wurzeln im Schleitheimer Glaubens- bekenntnis der Täufer aus dem Jahre 1527. In den sieben Artikeln des ers- ten Bekenntnisses der Täufer geht es um:100 (1) Taufe. Als Glaubenstaufe durfte sie nur an Erwachsenen vollzogen werden. Die Gemeinde war somit eine Gemeinschaft von Gläubigen. (2) Bann als Mittel der Gemeindezucht. (3) Abendmahl, das nur getauften Christen ausgeteilt werden durfte. (4) Konsequente Trennung von der Welt. (5) Hirten, die von der Gemeinde gewählt und abberufen werden konnten. (6) Trennung zwischen weltlicher und Reichsgottesordnung. Christen durften nicht an der Weltobrigkeit teil- nehmen noch sich ihrer Mittel bedienen. (7) Eid, der Christen untersagt war. „Die Verweigerung des Eides und das Prinzip der Wehrlosigkeit ... wurden durch Menno Simons zu tragenden Säulen des mennonitischen Glaubens weiterentwickelt“.101 Zusätzlich wurden von den Mennoniten das allgemeine Priestertum und die Selbständigkeit der örtlichen Gemeinden betont. Trotzdem haben sich die Gemeinden in Russland im Jahre 1883 zur „Allgemeinen Bundeskonferenz der Mennonitengemeinden in Russland“ zusammengeschlossen. Dieser Zusammenschluss hatte die Funktion einer Arbeitsgemeinschaft von autonomen Gemeinden.102 Er existierte nur bis zur Zerstörung des geistlichen Lebens innerhalb der Kolonien und konnte bis zur Ausreise der Mennoniten nach Deutschland seine Tätigkeit nicht wieder aufnehmen.103
Das geistliche Leben in den Gemeinden entwickelte sich bei den Mennoni- ten nach zwei Generationen mehr und mehr zu inhaltslosen Ritualen und Formen. Soziologisch gesehen wurde mit der Zeit aus einer religiösen eine ethnische Gemeinschaft.104 Doch die Erweckungsbewegung im Russischen Reich,105 die ab Mitte des 19. Jahrhunderts an vielen Stellen gleichzeitig aufbrach, erreichte auch die mennonitischen Kolonien. Schriften baptisti- scher und pietistischer Autoren fanden große Beliebtheit unter den Men- noniten und erweckten die erstarrten Christen. Zu einem größeren geistli- chen Aufbruch führte jedoch erst die Wirksamkeit des Pietisten Eduard Wüst und des Baptisten August Liebig. Als Folge dieser Erweckung kam es im Jahre 1860 zur Gründung der Mennoniten-Brüdergemeinde. Auf- grund starker Einflüsse des Kontinentalbaptismus um Johann Gerhard Oncken durch Literatur, Briefwechsel, persönliche Kontakte und das Theo- logische Seminar in Hamburg nahmen die Mennonitenbrüder immer mehr baptistische Züge an.106
Um nicht die Privilegien der Mennoniten im Russischen Reich zu verlieren und wertvolle täuferische Prinzipien wie Wehrlosigkeit und Eidesverwei- gerung aufgeben zu müssen, haben sich die Mennonitenbrüder den deut- schen Baptisten nicht angeschlossen.
[...]
1 InfoDienst Deutsche Aussiedler 118 (Nov 2005).
2 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 222 spricht von ca. 420.000 im Jahre 2006. Im Jahre 2010 können wir mit ca. 500.000 rechnen, weil die Gemeinden weiter ge- wachsen sind. Die Zahl setzt sich zusammen aus den Kirchenmitgliedern und ihren Angehören.
3 Es wäre angebracht, hier von Kirchenmitgliedern zu sprechen. In der freikirchlichen Landschaft hat sich jedoch der Begriff Gemeindemitgliedschaft durchgesetzt. Ge- meint sind damit getaufte Mitglieder in der jeweiligen Kirchengemeinde.
4 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 368.
5 Heinrich Löwen, Russlanddeutsche Evangelikale - Band 2: Das religiöse Erschei- nungsbild russlanddeutscher Freikirchen in Deutschland. München: GRIN, 2011.
6 Falls nicht anders angeben, werden die Begriffe „Aussiedler“ und „Russlanddeut- sche“ synonym verwendet.
7 InfoDienst Deutsche Aussiedler 118 (Nov 2005).
8 Vgl. Ebd., 10.
9 Schnurr, „Aussiedler“ 29.
10 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 84.
11 Klassen, Jesus Christus leben 227.
12 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
13 Coggins, „Aussiedler“ 2.
14 Laut ideaSpektrum 47 (2010): 8 sehen die Zahlen der Freikirchen wie folgt aus: Mitglieder der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF): Bund Evangelisch- Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten- und Brüdergemeinden) 83.285; Evangelisch- methodistische Kirche 55.400; Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 46.000; Bund Freier evangelischer Gemeinden 38.000; Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden 5.000; Die Heilsarmee 4.000; Gemeinde Gottes (pfingstkirchlich) 3.000; Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden 3.000; Frei- kirchlicher Bund der Gemeinde Gottes 2.200; Kirche des Nazareners 1.300. Insge- samt 241.985 Zu den Gastmitglieder der VEF zählen: Freikirche der Siebenten- Tags-Adventisten 35.386; Herrnhuter Brüdergemeine 6.100; Freikirchliches Evan- gelisches Gemeindewerk 2.200; Anskar-Kirche 800. Insgesamt 44.486.
Die Zahlen für das Jahr 1997 sind entnommen bei Löwen Gemeindepädagogik 19.
15 Die Abkürzungen für die einzelnen Verbände werden nicht in jedem Fall von den Verbänden selbst geführt. Sie sollen hier lediglich als Hilfe dienen.
16 In der Kirchengeschichtsschreibung wird bei den russlanddeutschen Mennoniten zwischen den kirchlichen Mennoniten und den Mennonitenbrüdern unterschieden. Bei den kirchlichen Mennoniten geht es um die ursprünglich eingewanderten Men- noniten aus Preußen, die ihre Wurzeln in der Täuferbewegung der Reformationszeit sehen. Die Mennonitenbrüder entstanden 1860 als Erweckungsbewegung unter den Mennoniten in Russland. Sie wurden wesentlich vom deutschen Baptismus und dem deutschen Pietismus beeinflusst. Auch wenn zwischen den kirchlichen Men- noniten und den Mennonitenbrüdern in der Entstehungszeit der Mennonitenbrüder gravierende Unterschiede vorhanden waren (vgl. Epp, Verschiedenheiten), sah die Situation nach dem zweiten Weltkrieg doch ganz anders aus. Auch die kirchlichen Mennoniten wurden von der Erweckungsbewegung der Nachkriegszeit erfasst und entwickelten ein Gemeindeleben, das sich von den Mennonitenbrüdern und den Baptisten fast ausschließlich in der Form der Taufe unterschied; die ersteren tauften mit der Untertauchstaufe - die letzteren praktizierten die Besprengungstaufe.
In Deutschland wird von vielen Kirchengemeinden, die ihre Wurzeln bei den kirch- lichen Mennoniten haben, unter anderem auch die Untertauchstaufe praktiziert, wenn diese von den Taufkandidaten gewünscht wird. Sowohl in der theologischen
17 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
18 Siehe MonatsBlatt (Januar-Juni 1997); Christliche Missions-Verlags-Buchandlung; Gemeindebibelschule der Mennonitengemeinde Bielefeld.
19 Zur AGUM siehe Klassen, „200 Jahre“ 6.
20 Vgl. Klassen, „200 Jahre“ 8; siehe auch Tibusek, Ein Glaube 273.
21 Klassen, Jesus Christus leben 227.
22 Vgl. Mennonitisches Jahrbuch, 1996, 173.
23 Vgl. Glaubensbekenntnis, 1991 und Loewen, One Lord 175-178.
24 Klassen, Jesus Christus leben 227.
25 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
26 Vgl. Tibusek, Ein Glaube 282.
27 Vgl. Klassen, „200 Jahre“ 9.
28 Das Missionswerk „Friedensstimme“ bringt seine Beziehung zu den verfolgten Christen in seiner Selbstdarstellung „Missionswerk Friedensstimme: Im Auftrag der Verfolgten Christen in der UdSSR“ sehr deutlich zum Ausdruck. Vgl. Missions- werk Friedensstimme.
29 Mit „konservativ“ ist nicht die theologische Einstellung der Gemeinden oder Ge- meinderichtungen gemeint, sondern eine konservative Haltung bezüglich bestimm- ter Traditionen, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gebracht wurden.
30 Statistische Erhebungen des Autors. Vgl. Tibusek, Ein Glaube 282.
31 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
32 Vgl. Tibusek, Ein Glaube 282.
33 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
34 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
35 Mit dem Begriff „progressiv“ werden Gemeinden beschrieben, die bemüht sind, sich in Deutschland effektiv zu integrieren, und die gelernt haben, zwischen ethi- schen Normen der rußlanddeutschen Tradition und der Bibel zu unterscheiden. Zu- sätzlich sind es Gemeinden, die großen Wert auf Mission und theologische Zurüs- tung ihrer Mitarbeiter legen.
36 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
37 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
38 Klassen, Telefonisches Interview mit dem Autor, 27. Juni 1997.
39 Vgl. Tibusek, Ein Glaube 310f.
40 Vgl. „Arbeitsgemeinschaft der Evangeliums-Christen-Baptisten“.
41 Krell, Telefonisches Interview mit dem Autor, 26. Juni 1997.
40 Krell, Telefonisches Interview mit dem Autor, 1. Juli 1997 und Rust, Telefonisches Interview mit dem Autor, 1. Juli 1997. Vgl. auch Wieske, „Spätaussiedlergemein- den“ 1875.
43 Janzen, Telefonisches Interview mit dem Autor, 23. Dezember 2010.
44 Bei den registrierten Gemeinden geht es um Kirchengemeinden, die Teil des staat- lich zugelassenen Allunionsrates der Evangeliumschristen-Baptisten in der Sowjet- union waren.
45 Fast, Telefonisches Interview mit dem Autor, 27. Juni 1997; Berg, Telefonisches Interview mit dem Autor, 27. Juni 1997; Töws, Telefonisches Interview mit dem Autor, 27. Juni 1997; Ens, Telefonisches Interview mit dem Autor, 27. Juni 1997.
46 Klassen, Russlanddeutsche Freikirchen 373.
47 Klassen, Jesus Christus leben 227.
48 Dieser Verband wird im Folgeband Russlanddeutschen Evangelikale - Band 2 aus- führlicher vorgestellt, weil anhand dieses Verbandes das religiöse Erscheinungsbild russlanddeutscher Freikirchen in Deutschland dargestellt wird.
49 Zu den Perioden der Geschichte der Mennoniten siehe Froese, „Pädagogisches Kul- tursystem“ XIV-XVI, und Ehrt, Mennonitentum.
50 Siehe Williams, Germans; Buchsweiler, Volksdeutsche; Hecker, Deutschen; Kap- peler [u.a.], Deutschen; Fleischhauer und Jedig, Deutschen; Pinkus und Fleischhau- er, Deutschen; Fleischhauer, Deutschen. Weitere Literatur ist der Bibliographie zu entnehmen.
51 John N. Klassen, „Suprise“ 1.
52 Vgl. Reimer, Aussiedler 14; Fleischhauer, Deutschen 60.
53 Reimer, Aussiedler 14.
54 Klassen, „Suprise“ 2.
55 Vgl. Baaden, Kulturarbeit 13; Eisfeld, Rußlanddeutschen 12-37.
56 Stumpp, Auswanderung 21.
57 Klassen, „Suprise“ 3. Vgl. auch Baaden, Kulturarbeit 13.
58 Vgl. Ebd., 13f.
59 Mein Großvater mütterlicherseits verlor durch diese Deportation seinen Vater, viele Geschwister und einen großen Teil seiner Verwandten.
60 Peters, Machno 124-133.
61 Ein Auszug aus der Zeitung „Nedelja“ aus dem Jahre 1935 schildert diese Situation wie folgt: „Man hatte zu Machno eine Gruppe von Dorfwächtern gebracht. Die er- schreckten Leute beugten sich vor dem grausamen Ataman, der sie wie ein Raubtier mit einem tollwütigen Blick anstarrte. Machno schrie: ‘Zerhackt sie! I toljko! (Und fertig)’ Kaiko sprang hinzu und begann mit ungeübter Hand die Unglücklichen zu
62 Kotzian, Aussiedler 105 und Dietz und Hilkes, „Deutsche in der Sowjetunion“ 4, zit. in Baaden, Kulturarbeit 15.
63 Hecker, Deutsche 29.
64 Klassen, „Migration“ 128.
65 Baaden, Kulturarbeit 16.
66 Vgl. Klassen, „Migration“ 139. Mein Großvater väterlicherseits wurde 1937 verhaf- tet und erschossen, weil er ein paar Säcke Mehl versteckt hatte, um in der Hungers- zeit seine kinderreiche Familie zu versorgen. Dieses Schicksal traf fast alle russ- landdeutschen Familien. Die in dieser Arbeit erwähnten Beispiele aus meiner Fami- lie werden stelltvertretend für die Schicksale aller russlanddeutschen Familien ge- braucht. Denn man kann davon ausgehen, dass jede Familie im nahen oder weiten Verwandschaftskreise von gleichen Schicksalen betroffen war.
67 Baaden, Kulturarbeit 16.
68 Hecker, Deutsche 30.
69 Vgl. Hertel, „Bildung“ 178, und Stricker, „Deutsches Kirchenwesen“ 162. Auch die Brüder und die Schwäger von meinem Vater wurden zu Kriegsbeginn verhaftet und
70 Baaden, Kulturarbeit 16.
71 Ebd., 16.
72 Ebd., 16.
73 Ebd., 16f. Vgl. auch Hecker, Deutsche 31-35. Siehe auch die Dokumentationen zur Deportation, Sondersiedlung und Arbeitsarmee bei Eisfeld, Deportation.
74 Klassen, „Migration“ 132.
75 Ebd., 132.
76 Ebd., 132. Vgl. zur Situtiation nach dem Krieg Penner, Weltweite Bruderschaft326-328.
77 Vgl. Klassen, „Migration“ 133.
78 Vgl. Ebd., 133.
79 Zu dieser Zeitperiode siehe Baaden, Kulturarbeit 16f.
80 Reimer, Aussiedler 66.
81 Zu den Gründen der Auswanderung siehe auch Klassen, „Migration“ 137f; Dietz, Anpassung 105-109; Dietz und Hilkes, Rußlanddeutsche 115-119; ders. „Deutsche Aussiedler“ 67-69; Wölk, „Gründe“ 39-43.
82 Vgl. Wölk, „Gründe“ 41f.
83 Vgl. Dietz, Anpassung 105-109; Dietz und Hilkes, Rußlanddeutsche 115-119; ders. „Deutsche Aussiedler“ 67-69; Wölk, „Gründe“ 40f.
84 Vgl. Dietz, Anpassung 108f; Dietz und Hilkes, „Deutsche Aussiedler“ 68f; Wölk, „Gründe“ 42f.
85 Dietz, Anpassung 105.
86 Klassen, „Suprise“ 7.
87 Reimer, Aussiedler 44.
88 Stumpp, Auswanderung 22.
89 Hecker, „Deutschen“ 62.
90 Schnurr, Kirchen (kath. Teil); Stricker, „Katholizismus“ 109-129.
91 Reimer, Aussiedler 50f.
92 Pinkus und Fleischhauer, Deutschen 121.
93 Vgl. Schnurr, Kirchen (ev. Teil); Kahle, Evangelisch-lutherischen Gemeinden; ders. Lutherischen Kirchen.
94 Reimer, Aussiedler 49.
95 Vgl. Brandenburg, Schatten der Macht.
96 Kasdorf, Flammen unauslöschlich 67-68.
97 Zu den Mennoniten siehe Friesen, Brüderschaft; ders. Brotherhood.
98 Wisotzki, „Überlebungsstrategie“ 23.
99 Zu den Gründen der Auswanderung siehe Gerlach, Rußlandmennoniten, 18f.
100 Loewen, One Lord 79-84; Froese, „Pädagogisches Kultursystem“ V-Va.
101 Wisotzki, „Überlebungsstrategie“ 22.
102 Dueck, „Mennonite Churches“ 166.
103 Sawatsky, „Soviet Mennonites“ 311.
104 Francis, „Russian Mennonites“ 101-107.
105 Zu dieser Erweckungsbewegung siehe Löwen, Russische Freikirchen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Sprachvorschau, der den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und wichtigsten Themen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was behandelt das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst: Vorwort, Einleitung, einen allgemeinen Überblick über Russlanddeutsche in Deutschland (einschließlich Statistiken, Konfessionszugehörigkeit und überregionale Strukturen freikirchlicher Gruppen), die Geschichtsperioden, die konfessionellen Gruppierungen, das pädagogische Kultursystem, das Gemeindeleben nach dem Zweiten Weltkrieg, die theologischen Prinzipien, das Gemeindeverständnis, missionarische Bemühungen und kirchliche Aktivitäten in Russland und der ehemaligen Sowjetunion, eine Zusammenfassung, ein Literaturverzeichnis und Informationen zum Autor.
Welche Geschichtsperioden werden behandelt?
Die Geschichtsperioden umfassen: Periode des Aufbaus, Periode des Höchststandes, Periode der Auflösung, Periode der Neuorientierung und Periode der Auswanderung.
Welche konfessionellen Gruppierungen werden beschrieben?
Die konfessionellen Gruppierungen umfassen: Römisch-katholische Kirche, Evangelische Gemeinden, die Mennoniten, der deutsche Baptismus, die Evangeliumschristen und der russische Baptismus.
Welche Aspekte des pädagogischen Kultursystems werden behandelt?
Die Aspekte des pädagogischen Kultursystems umfassen die Familie und das Schulwesen.
Welche theologischen Prinzipien werden erläutert?
Die theologischen Prinzipien umfassen: Die Heilige Schrift als Autorität und Maßstab, Selbstständigkeit der Ortsgemeinden, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen, Gewissensfreiheit und Trennung von Kirche und Staat.
Was wird unter Gemeindeverständnis verstanden?
Das Gemeindeverständnis umfasst: Das Wesen der Gemeinde, die Praxis des Gemeindelebens, Heiligung und die Erhaltung der "reinen" Gemeinde, Konsequenzen für die Gemeindepädagogik und die sozialpsychologische Funktion der Gemeinde.
Welche missionarischen Bemühungen und kirchlichen Aktivitäten werden beleuchtet?
Es werden evangelistisch-missionarisches Engagement, Weiterführung im Glauben von Neubekehrten, Zurüstung von Gemeindemitgliedern, Ausbildung von Mitarbeitern/Weiterbildung von Leitern und Publikationstätigkeit betrachtet.
Was sind die Hauptaussagen des Vorworts?
Das Vorwort thematisiert die Integration von Einwanderern in Deutschland, insbesondere Russlanddeutschen, und betont die Bedeutung der Identitätsklärung für eine erfolgreiche Integration. Es wird die Notwendigkeit hervorgehoben, sowohl die eigene Identität zu kennen und zu akzeptieren als auch die deutsche Gesellschaft zu verstehen und sich in sie einzubringen.
Welche Rolle spielen Frauen im Gemeindeleben nach dem Zweiten Weltkrieg?
Frauen werden als Trägerinnen des Gemeindelebens in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgehoben.
Wie gestalten sich die Eingliederung und die Untergrundkirche?
Die Eingliederung in die neue Kirchenlandschaft und die Entstehung der Untergrundkirche werden als wichtige Aspekte des Gemeindelebens nach dem Krieg beleuchtet.
- Quote paper
- Dr. Heinrich Löwen (Author), 2010, Russlanddeutsche Evangelikale - Band 1, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163570