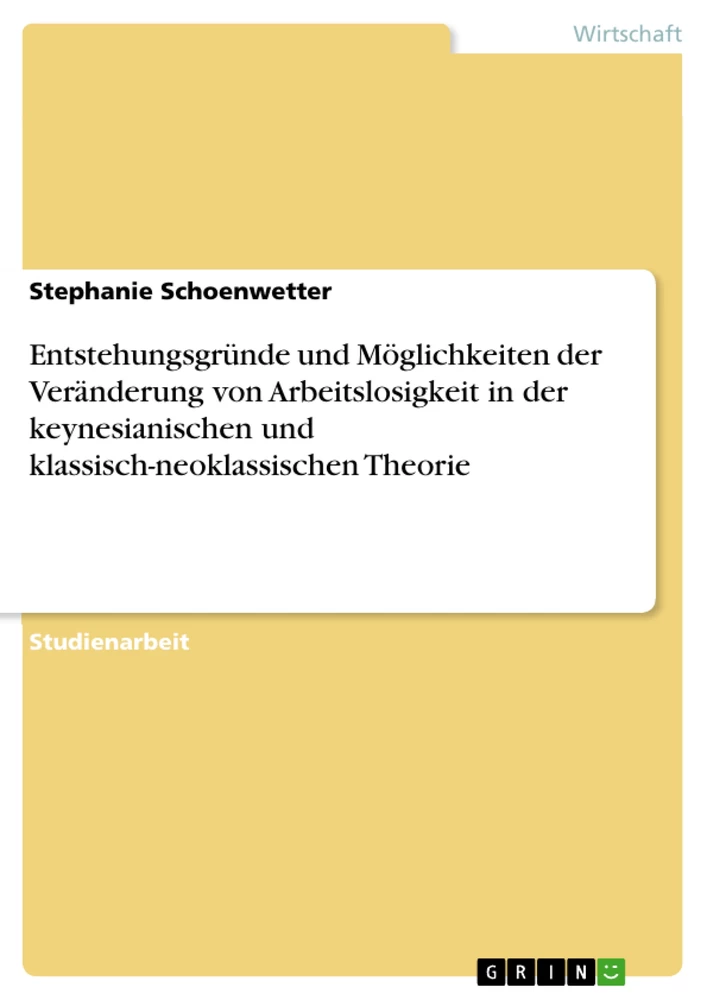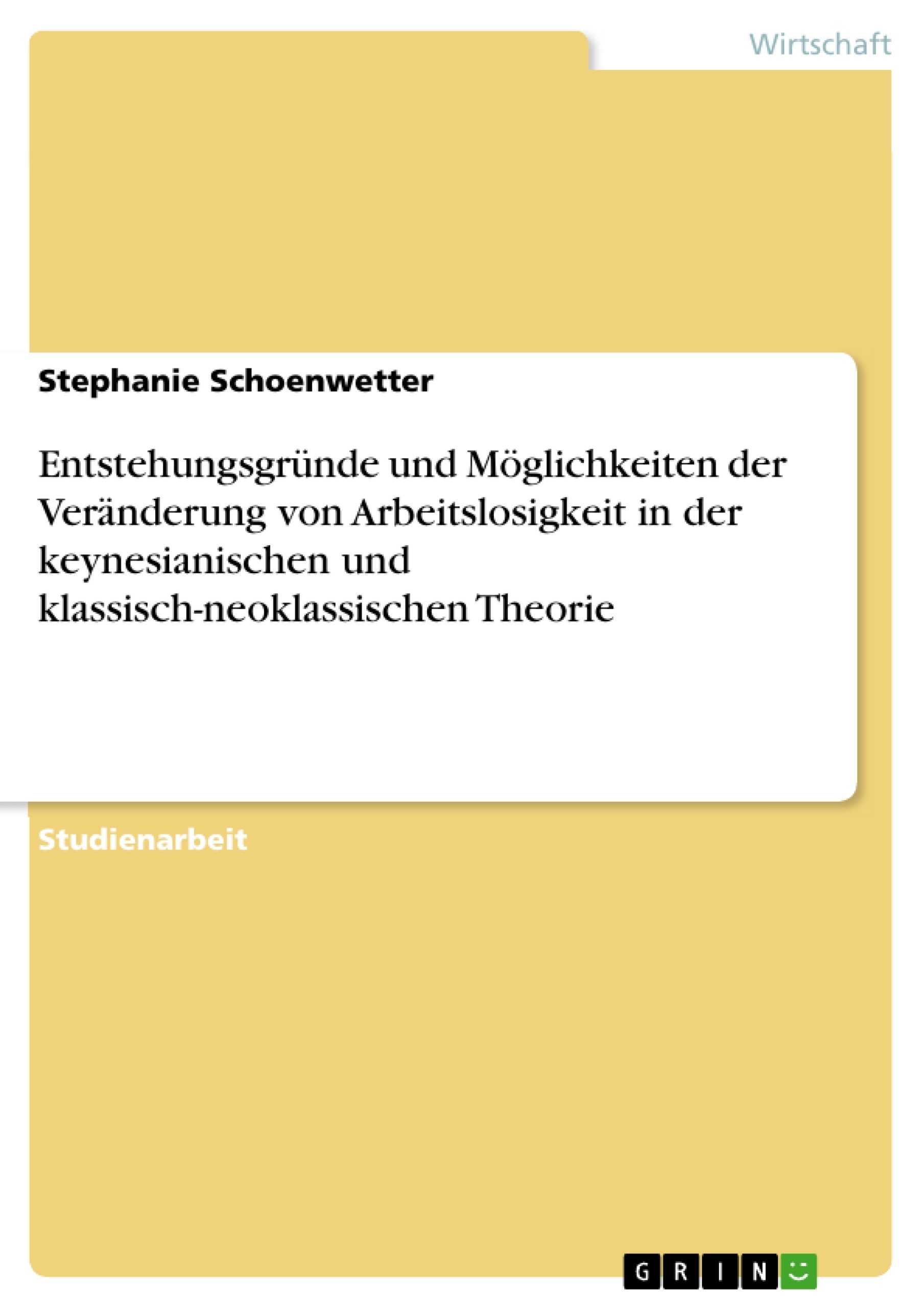Das Thema Arbeitslosigkeit ist in Deutschland kein neues Phänomen, sondern stellt schon seit
längerer Zeit ein bedeutendes ökonomisches sowie soziales Problem dar. Im „Goldenen
Zeitalter“(Promberger, Markus,In: Arbeit und Beruf, Jg. 56, H. 3/ 2005. S. 65) der 60er Jahre glaubte man, das Thema Arbeitslosigkeit wäre Vergangenheit.
Jedoch folgte kurz darauf die erste Rezession in den Jahren 1967/ 68. Seit 1975 ist die
Massenarbeitslosigkeit in Deutschland zum kontinuierlich anhaltenden Problem geworden.
Die saisonbereinigte Erwerbslosenquote in Deutschland beträgt derzeit 7,4 %, das sind 3,2
Millionen Menschen (Mai 2008). Somit ist eine der bedeutendsten makroökonomischen
Zielgrößen das Erreichen eines hohen Beschäftigungsgrades, welche sogar im § 1 des
Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 gesetzlich verankert ist. Um dieses Problem
aufzugreifen und ihm entgegnen zu können, gibt es ökonomische Theorien, die anhand von
Modellen Arbeitslosigkeit erklären. Die vorliegende Arbeit versucht, einen strukturellen
Überblick über zwei konträre Theorien zur Erklärung der Arbeitslosigkeit und ihrer Gründe
zu geben. In diesem Rahmen werden schließlich entsprechende Möglichkeiten zur
Veränderung der Arbeitslosigkeit erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Klassik und Neoklassik
- Grundannahmen/ Allgemeines Marktmodell
- Die Arbeitsnachfrage
- Das Arbeitsangebot
- Ursachen der Arbeitslosigkeit
- Keynesianische Theorie
- Grundannahmen
- Kurzfristiges gesamtwirtschaftliches Angebot und Vollbeschäftigungsangebot (Gütermarkt)
- Gesamtwirtschaftliche Nachfrage
- Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht
- Ursachen der Arbeitslosigkeit: Effekte einer deflationären Lücke
- Therapie der Arbeitslosigkeit
- Neoklassische Ansicht
- Keynesianische Ansicht: Kaufkrafttheorie der Löhne
- Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Veränderung von Arbeitslosigkeit im Kontext der keynesianischen und klassisch-neoklassischen Theorien. Ziel ist es, einen strukturierten Überblick über die gegensätzlichen Ansätze beider Theorien zu geben und Möglichkeiten zur Veränderung der Arbeitslosigkeit zu erörtern.
- Unterschiedliche Entstehungsgründe von Arbeitslosigkeit in der keynesianischen und klassisch-neoklassischen Theorie
- Grundannahmen und Modelle beider Theorien
- Analyse des Arbeitsmarktes in beiden theoretischen Rahmen
- Möglichkeiten zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit aus keynesianischer und neoklassischer Perspektive
- Vergleich und Gegenüberstellung der beiden Theorien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema Arbeitslosigkeit als ein bedeutendes ökonomisches und soziales Problem in Deutschland vor und gibt einen historischen Überblick. Sie führt in die Thematik ein und begründet die Notwendigkeit, verschiedene ökonomische Theorien zur Erklärung der Arbeitslosigkeit zu betrachten. Die Arbeit selbst wird als ein Versuch, einen strukturellen Überblick über zwei gegensätzliche Theorien zu bieten, vorgestellt.
1. Klassik und Neoklassik: Dieses Kapitel beschreibt die Grundannahmen der klassisch-neoklassischen Theorie, die von einem System unabhängiger Konkurrenzmärkte ausgeht. Hierbei streben Haushalte und Unternehmen Nutzen- bzw. Gewinnmaximierung an, wobei flexible Preise die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft garantieren sollen. Das Saysche Gesetz wird erläutert, welches besagt, dass jedes Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Das Kapitel beschreibt das allgemeine Marktmodell und den Arbeitsmarkt mit Nachfrage- und Angebotskurven. Der Gleichgewichtslohn und die Gleichgewichtsmenge werden definiert und die Rolle des Preismechanismus in der Erreichung des Gleichgewichts wird betont.
1.1 Grundannahmen/ Allgemeines Marktmodell: Dieser Abschnitt detailliert das klassisch-neoklassische Modell, welches von unabhängigen Konkurrenzmärkten und der individuellen Nutzen- und Gewinnmaximierung von Haushalten und Unternehmen ausgeht. Die Rolle flexibler Preise und das Saysche Gesetz werden hier als zentrale Mechanismen zur Erreichung eines Marktgleichgewichts ohne Überschüsse hervorgehoben. Das Modell wird als "Tauschökonomie" beschrieben, deren reibungsloses Funktionieren von nicht-eingreifenden externen Faktoren abhängig ist. Der Arbeitsmarkt wird als ein Markt unter vielen dargestellt, der den gleichen Prinzipien folgt.
1.1.1 Die Arbeitsnachfrage: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Arbeitsnachfrage seitens der Unternehmen. Die Gewinnmaximierung als Zielsetzung der Unternehmen wird erläutert, und es wird dargelegt, wie die Unternehmen unter Bedingungen vollständiger Konkurrenz als „Mengenanpasser“ agieren. Die Produktionsfunktion wird eingeführt, und es wird gezeigt, wie der gewinnmaximale Arbeitseinsatz durch die Gleichsetzung der Grenzproduktivität der Arbeit mit dem Reallohn bestimmt wird. Abnehmende Grenzerträge bei variabler Arbeit und konstantem Kapital werden als wichtiger Aspekt diskutiert.
2. Keynesianische Theorie: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundannahmen der keynesianischen Theorie, einschließlich des kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Angebots und der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Es analysiert das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht und die Ursachen der Arbeitslosigkeit im Kontext einer deflationären Lücke. Im Gegensatz zur klassischen Theorie steht hier die Bedeutung der aggregierten Nachfrage im Mittelpunkt.
3. Therapie der Arbeitslosigkeit: Hier werden neoklassische und keynesianische Lösungsansätze zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit verglichen. Die neoklassische Sichtweise betont die Notwendigkeit flexibler Märkte und den Abbau von Marktversagen, während die keynesianische Perspektive sich auf die Stärkung der Nachfrage und die Kaufkrafttheorie der Löhne konzentriert.
Schlüsselwörter
Arbeitslosigkeit, Keynesianische Theorie, Klassisch-neoklassische Theorie, Arbeitsmarkt, Gleichgewicht, Nachfrage, Angebot, Reallohn, Gewinnmaximierung, Deflationäre Lücke, Kaufkraft, Gesamtwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Arbeitslosigkeit im Kontext keynesianischer und klassisch-neoklassischer Theorien
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet eine umfassende Übersicht über die Entstehung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, indem er die keynesianische und die klassisch-neoklassische Theorie vergleicht. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf dem Unterschied der beiden Theorien in Bezug auf die Ursachen von Arbeitslosigkeit und deren jeweilige Lösungsansätze.
Welche Theorien werden verglichen?
Der Text vergleicht die keynesianische und die klassisch-neoklassische Theorie der Arbeitslosigkeit. Die klassisch-neoklassische Theorie basiert auf dem Modell unabhängiger Märkte, flexibler Preise und dem Sayschen Gesetz, während die keynesianische Theorie die Bedeutung der aggregierten Nachfrage und möglicher Nachfragedefizite hervorhebt.
Welche sind die Hauptpunkte der klassisch-neoklassischen Theorie?
Die klassisch-neoklassische Theorie geht von selbstregulierenden Märkten aus, in denen flexible Preise ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herstellen. Arbeitslosigkeit wird hier primär als freiwillige Arbeitslosigkeit gesehen, die durch zu hohe Lohnforderungen entsteht. Das Saysche Gesetz besagt, dass jedes Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Das Modell betont die Rolle der Gewinnmaximierung von Unternehmen und der Nutzenmaximierung von Haushalten.
Welche sind die Hauptpunkte der keynesianischen Theorie?
Die keynesianische Theorie betont die Bedeutung der aggregierten Nachfrage für die Beschäftigung. Arbeitslosigkeit kann hier durch unzureichende Nachfrage entstehen (deflationäre Lücke). Flexible Preise sind im keynesianischen Modell nicht zwingend Voraussetzung für ein Gleichgewicht, und es wird die Möglichkeit staatlicher Eingriffe zur Stimulierung der Nachfrage postuliert.
Wie wird der Arbeitsmarkt in beiden Theorien modelliert?
In der klassisch-neoklassischen Theorie wird der Arbeitsmarkt als ein Markt unter vielen betrachtet, der den Prinzipien von Angebot und Nachfrage folgt. Das Gleichgewicht wird durch den Reallohn bestimmt. In der keynesianischen Theorie wird der Arbeitsmarkt im Kontext der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage betrachtet. Die Arbeitslosigkeit wird als ein makroökonomisches Problem gesehen, das nicht unbedingt durch Marktmechanismen allein behoben werden kann.
Welche Lösungsansätze zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit werden vorgestellt?
Der Text präsentiert neoklassische Lösungsansätze, die auf der Flexibilisierung von Märkten und dem Abbau von Marktversagen beruhen. Keynesianische Lösungsansätze konzentrieren sich auf die Stärkung der Nachfrage durch staatliche Eingriffe und die Kaufkrafttheorie der Löhne.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Arbeitslosigkeit, Keynesianische Theorie, Klassisch-neoklassische Theorie, Arbeitsmarkt, Gleichgewicht, Nachfrage, Angebot, Reallohn, Gewinnmaximierung, Deflationäre Lücke, Kaufkraft, Gesamtwirtschaft.
Wie ist der Text strukturiert?
Der Text ist strukturiert in Einleitung, Kapitel zu Klassik/Neoklassik und Keynesianischer Theorie, ein Kapitel zur Therapie der Arbeitslosigkeit und einen Vergleich der beiden Ansätze. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Liste der Schlüsselbegriffe.
- Quote paper
- Stephanie Schoenwetter (Author), 2008, Entstehungsgründe und Möglichkeiten der Veränderung von Arbeitslosigkeit in der keynesianischen und klassisch-neoklassischen Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163326