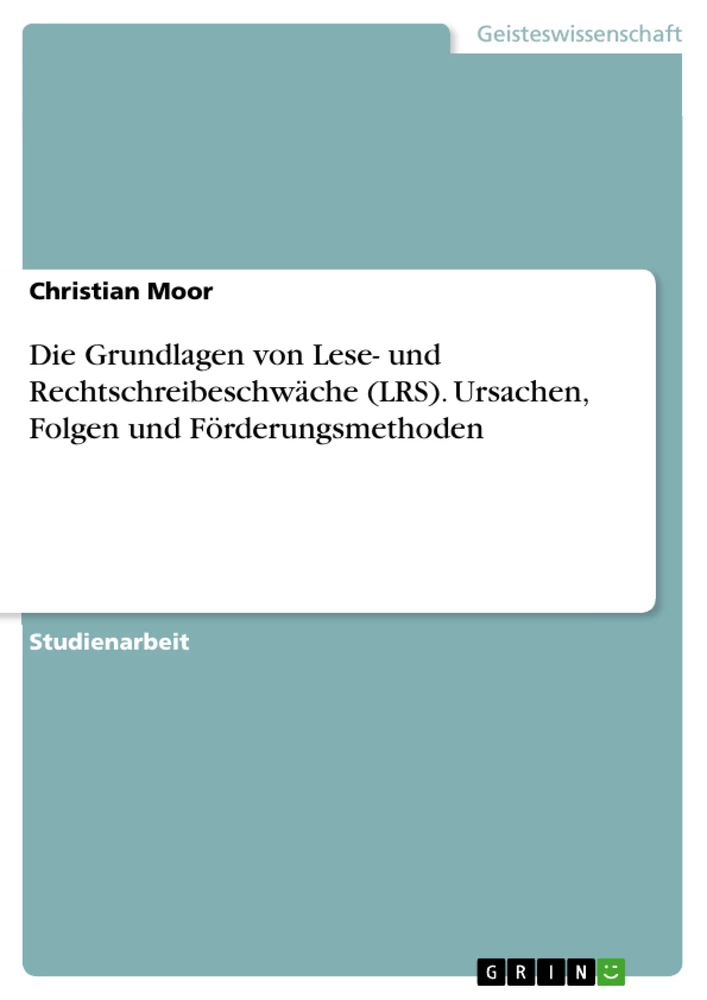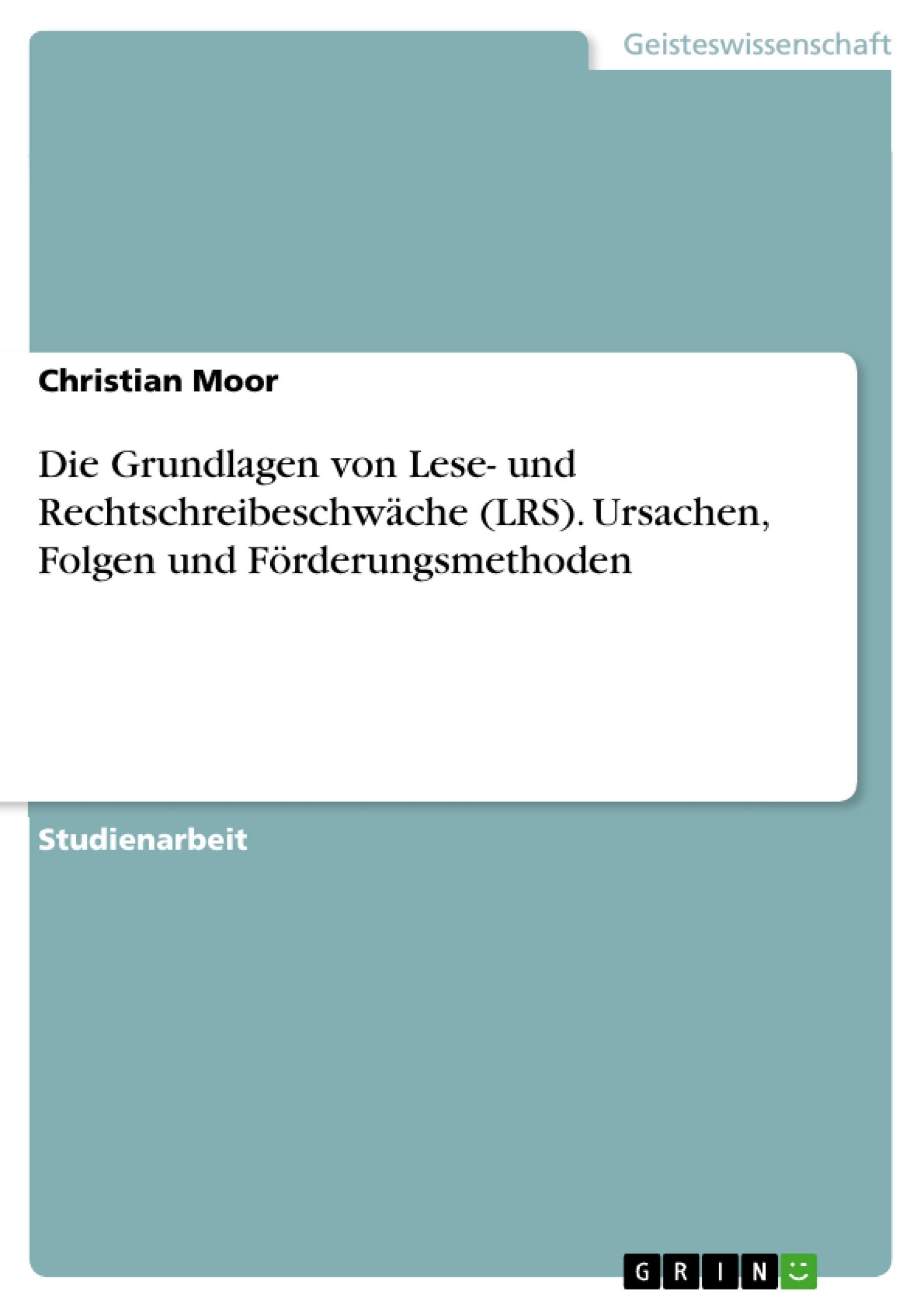Weltweit gibt es zahlreiche Menschen, die Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens hatten und haben. Für Deutschland wird davon ausgegangen, dass ca. 3 Millionen Deutsche von einer Lese- Recht-schreibschwäche betroffen sind und dies trotz regelmäßigen Schulbesuchs und Beherrschens der deutschen Sprache.
Dieses Störungsbild wurde bereits im 19. Jahrhundert durch Augenärzte beschrieben.
Zuallererst ist zu klären, was unter LRS, auch „Lese-Rechtschreibschwäche“, „Lese-Rechtschreibstörung“ oder auch „Legasthenie“ genannt zu ver-stehen ist.
Dabei ist festzuhalten, dass es zurzeit keine Einheitlichkeit in Bezug auf die Verwendung von Begriffen und Definitionen für Schwierigkeiten beim Erwerb von Lese- und Rechtschreibfähigkeiten gibt.
Es wird aber auf jeden Fall eine Störung/Schwäche bezeichnet, die durch ausgeprägte Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und/oder Recht-schreibens gekennzeichnet ist .
Dabei geht es um normgerechtes Lernen. Die Rechtschreibleistung wird in Beziehung zum IQ oder zum Alter gesetzt. Eine Rechtschreibstörung liegt vor, wenn die Rechtschreibleistung um einen bestimmten Betrag unterhalb dessen liegt, was zu erwarten wäre.
Liegt sowohl eine Störung beim Umsetzten von gesprochener zu geschriebener Sprache als auch umgekehrt vor und verfügen die Kinder über eine normale oder sogar überdurchschnittliche Intelligenz, gehen regelmäßig zur Schule, werden dort fachgerecht unterrichtet und sind ansonsten nicht organisch (z.B. durch Hör- oder Sehbehinderung) beeinträchtigt, so spricht man von einer Legasthenie, wobei dieser Begriff wörtlich übersetzt (legere (lateinisch) = lesen/ astheneia (griechisch) = Schwäche) soviel wie Leseschwä
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärung
- 3. Symptome
- 4. Folgen
- 5. Ursachen
- 6. Diagnostik
- 7. Förderung
- 7.1. Aspekte für eine Förderung
- 7.2. Konzeptionelle Einordnung
- 7.3. Vorschulische und Schulische Förderung
- 7.4. Außerschulische Förderung
- 7.5. Dauer und Umfang der Förderung
- 7.6. Förderprogramme und Methoden
- 7.7. Leistungsbewertung
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) umfassend zu beleuchten. Sie beleuchtet die Definition, Symptome, Folgen, Ursachen, Diagnose und Förderungsmöglichkeiten dieser Störung.
- Begriffserklärung und Abgrenzung von LRS, Legasthenie und anderen Störungen
- Symptome und Auswirkungen von LRS auf verschiedene Lebensbereiche
- Ursachenforschung und aktuelle Erkenntnisse zur Entstehung von LRS
- Diagnostische Verfahren und Möglichkeiten der Früherkennung
- Verschiedene Ansätze und Methoden zur Förderung von Kindern mit LRS
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Bedeutung der Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) als Lernschwierigkeit heraus und gibt einen Überblick über die Verbreitung und Geschichte des Themas.
- Begriffserklärung: Die Definition und Abgrenzung von LRS, Legasthenie und anderen Störungen wird erläutert. Der Text verdeutlicht die Komplexität der Thematik und die verschiedenen Begriffsverständnisse.
- Symptome: Die Arbeit beschreibt die typischen Symptome einer Lese-Rechtschreibschwäche, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben. Sie zeigt, wie sich diese Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen des Lebens auswirken.
- Folgen: Die Arbeit beleuchtet die negativen Folgen von LRS auf die schulische Entwicklung, das Selbstwertgefühl und die soziale Integration. Sie verdeutlicht die Herausforderungen, denen Kinder mit LRS im schulischen und außerschulischen Kontext begegnen.
- Ursachen: Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien zur Entstehung von LRS. Sie beleuchtet sowohl biologische als auch umweltbedingte Faktoren.
- Diagnostik: Die Arbeit stellt verschiedene diagnostische Verfahren vor, die zur Erkennung von LRS eingesetzt werden können. Sie zeigt, wie wichtig eine frühzeitige Diagnose für eine effektive Förderung ist.
- Förderung: Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte der LRS-Förderung, darunter die konzeptionelle Einordnung, die vorschulische und schulische Förderung sowie die außerschulische Förderung. Sie diskutiert verschiedene Förderprogramme und Methoden sowie die Bedeutung der Leistungsbewertung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themenbereiche Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie, Lernschwierigkeiten, Diagnostik, Förderung, Schulische Integration, Frühförderung, Methoden, Leistungsbewertung und inklusives Lernen. Der Text beleuchtet die Bedeutung einer differenzierten Betrachtung von LRS und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Förderung, um betroffenen Kindern optimale Unterstützung zukommen zu lassen.
- Quote paper
- Christian Moor (Author), 2010, Die Grundlagen von Lese- und Rechtschreibeschwäche (LRS). Ursachen, Folgen und Förderungsmethoden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163278