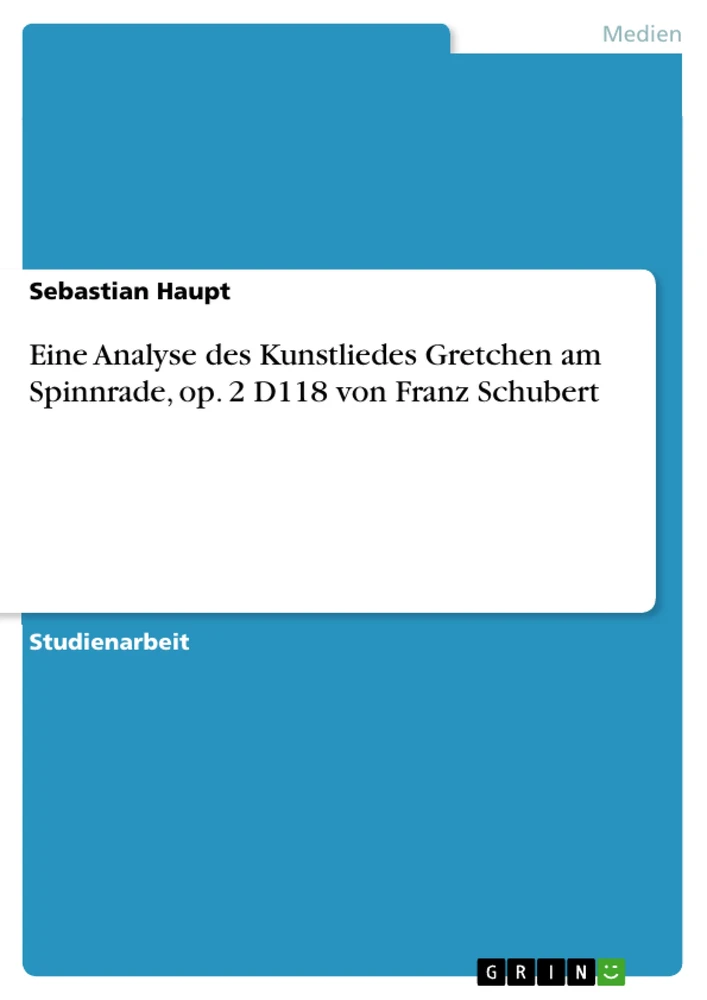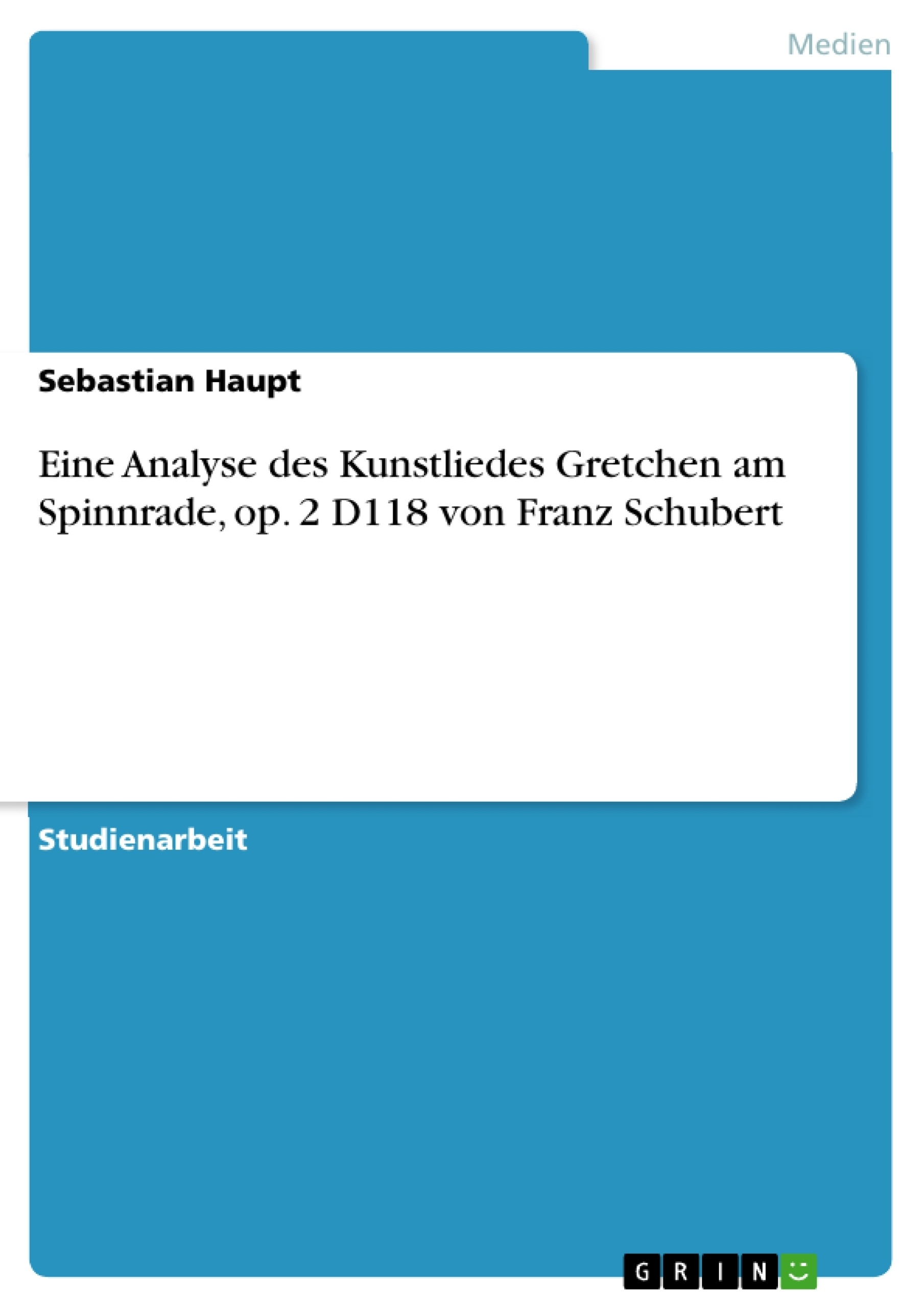Die Geburtsstunde des deutschen romantischen Liedes, so findet man in „Die Musik in Ge-schichte und Gegenwart“, erfolgt nach weitgehend konsentierter Einschätzung im Jahre 1814 mit der Komposition von Gretchen am Spinnrade durch den 17-jährigen Franz Schubert.1 Ein nach heutigen Maßstäben nicht einmal volljähriger Junge begründet also eine ganze Epoche und lässt eine Gattung aufleben, geradezu reifen, in ihrer Neuartigkeit überhaupt erst entstehen, der bis dahin die Zugehörigkeit zur großen Kunst abgesprochen worden war.2 Der bedeutende Liedinterpret und Opernsänger Dietrich Fischer- Dieskau notiert für diese Zeit ebenfalls die Entstehung einer besonderen Liedgattung, der des Schubertliedes, würdigt, die „Vereinigung von Poesie und Tönen [ist] noch nie vorher so vollkommen gelungen“.3 Schu-bertlied und Romantisches Lied lassen sich dabei scheinbar nicht voneinander trennen, wird der Komponist doch oft als Inbegriff eben jener Epoche verstanden, zu deren Entstehung er beitrug. Der Musikwissenschaftler Thrasybulos Georgiades geht noch einen Schritt weiter, teilt die abendländische Musiktradition ein in die beiden wesentlichen Epochen vor und nach Schubert.4 Zwar bezieht er damit auch dessen Instrumentalschaffen ein, doch stellt die Lied-kunst des Komponisten als seine vollkommenste Stärke heraus.
Wie konsistent und sinnvoll sind jedoch diese Einteilungen, wie viel Gehalt darf man den Worten beimessen und wie viel davon ist übertriebene Schwärmerei? Anders formuliert: Welche Bedeutung hat das Lied „Gretchen am Spinnrade“ tatsächlich und aus welchem Grund besitzt es in der Literatur diese herausragende Stellung?
Das zu klären, soll das Ziel dieser Arbeit sein. Dazu ist es notwendig, zuvorderst einen Blick auf die Ausgangslage des Liedes zu werfen und zu beleuchten, welche Entwicklung diese Gattung bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts genommen hat. Im Anschluss soll ein kurzer Überblick über den Lebenslauf des Komponisten Schubert gegeben werden, mögliche Ein-flüsse herausgearbeitet und das Wirken seiner Lehrer dargestellt werden. Bevor sich dann der Analyse des Liedes gewidmet wird, bietet es sich an, das Verhältnis von Goethe und Schubert zu umreißen und die Textvorlage näher zu beleuchten. Um die oben angeführte Frage zu beantworten, werden abschließend die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und die Bedeutung des Werkes auf Schuberts Gesamtschaffen sowie die Entwicklung der Gattung projiziert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gattung Lied im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert
- Lebenslauf und erste musikalische Einflüsse
- Die Textvorlage
- Analyse des Liedes „Gretchen am Spinnrade“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse des Liedes „Gretchen am Spinnrade“ von Franz Schubert und der Bedeutung dieses Werkes für die Entwicklung der Liedgattung im frühen 19. Jahrhundert. Die Arbeit beleuchtet die historische und musikalische Ausgangslage des Liedes, zeichnet Schuberts Lebensweg und künstlerische Einflüsse nach und untersucht die Textvorlage aus Goethes „Faust“ I. Schließlich wird die Musik des Liedes in Detail analysiert, wobei die Beziehung zwischen Text und Musik, sowie die musikalischen Gestaltungselemente im Vordergrund stehen.
- Die Entwicklung der Liedgattung im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert
- Die Bedeutung von Franz Schubert für die Entstehung des romantischen Liedes
- Die Beziehung zwischen Text und Musik im Lied „Gretchen am Spinnrade“
- Die Analyse der musikalischen Gestaltungselemente im Lied „Gretchen am Spinnrade“
- Schuberts musikalische Einflüsse und seine künstlerische Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Liedes „Gretchen am Spinnrade“ für die Musikgeschichte dar und skizziert den Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.
- Die Gattung Lied im späten 18. und beginnenden 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Liedgattung im ausgehenden 18. Jahrhundert und den Einfluss der Zweiten Berliner Liederschule auf die musikalische Gestaltung.
- Lebenslauf und erste musikalische Einflüsse: In diesem Kapitel wird Schuberts Lebenslauf und seine musikalische Ausbildung beschrieben, wobei insbesondere die Bedeutung seiner Lehrer und musikalischen Vorbilder im Vordergrund steht.
- Die Textvorlage: Dieses Kapitel behandelt Goethes „Faust“ I als Textgrundlage für das Lied „Gretchen am Spinnrade“ und untersucht die Beziehung zwischen Schubert und Goethe sowie die Relevanz der Textvorlage für das Lied.
- Analyse des Liedes „Gretchen am Spinnrade“: Dieses Kapitel widmet sich der detaillierten Analyse des Liedes, wobei die Beziehung zwischen Text und Musik, die musikalischen Gestaltungselemente sowie die Stimmung und Dramaturgie des Liedes im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Liedes „Gretchen am Spinnrade“ von Franz Schubert und thematisiert dabei die Entwicklung der Liedgattung im frühen 19. Jahrhundert, die Bedeutung von Text und Musik, die musikalischen Gestaltungselemente, sowie Schuberts Lebensweg und künstlerische Einflüsse. Wichtige Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Liedgattung, Romantisches Lied, Franz Schubert, Johann Wolfgang von Goethe, „Faust“, Text-Musik-Beziehung, Harmonik, Melodie, Rhythmus, Dramaturgie, musikalische Gestaltungselemente.
- Quote paper
- Sebastian Haupt (Author), 2010, Eine Analyse des Kunstliedes Gretchen am Spinnrade, op. 2 D118 von Franz Schubert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162483