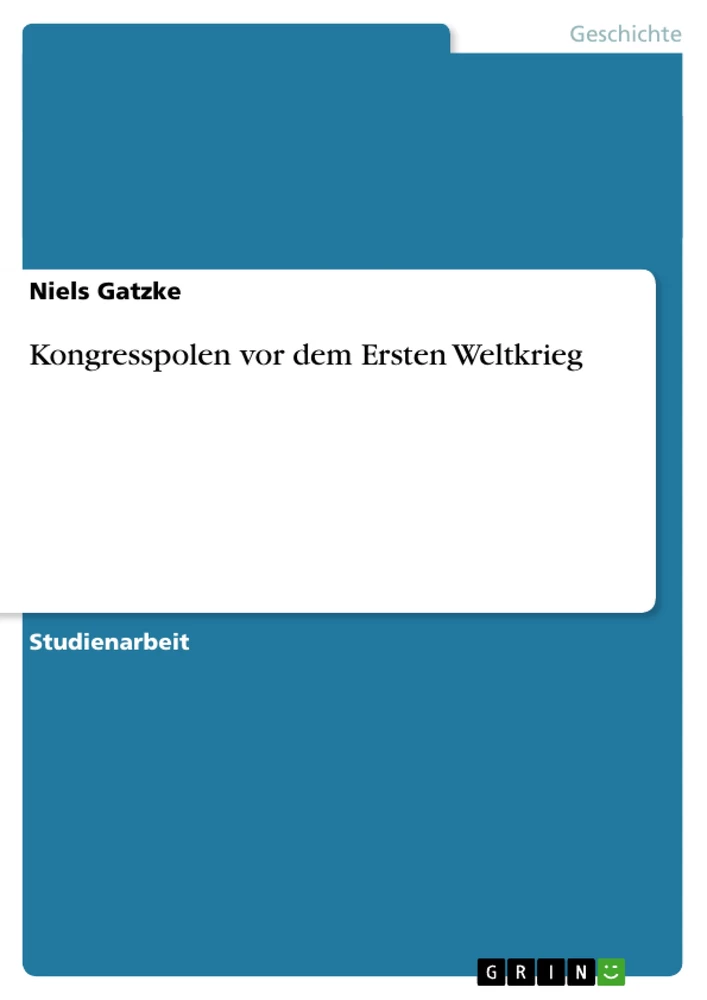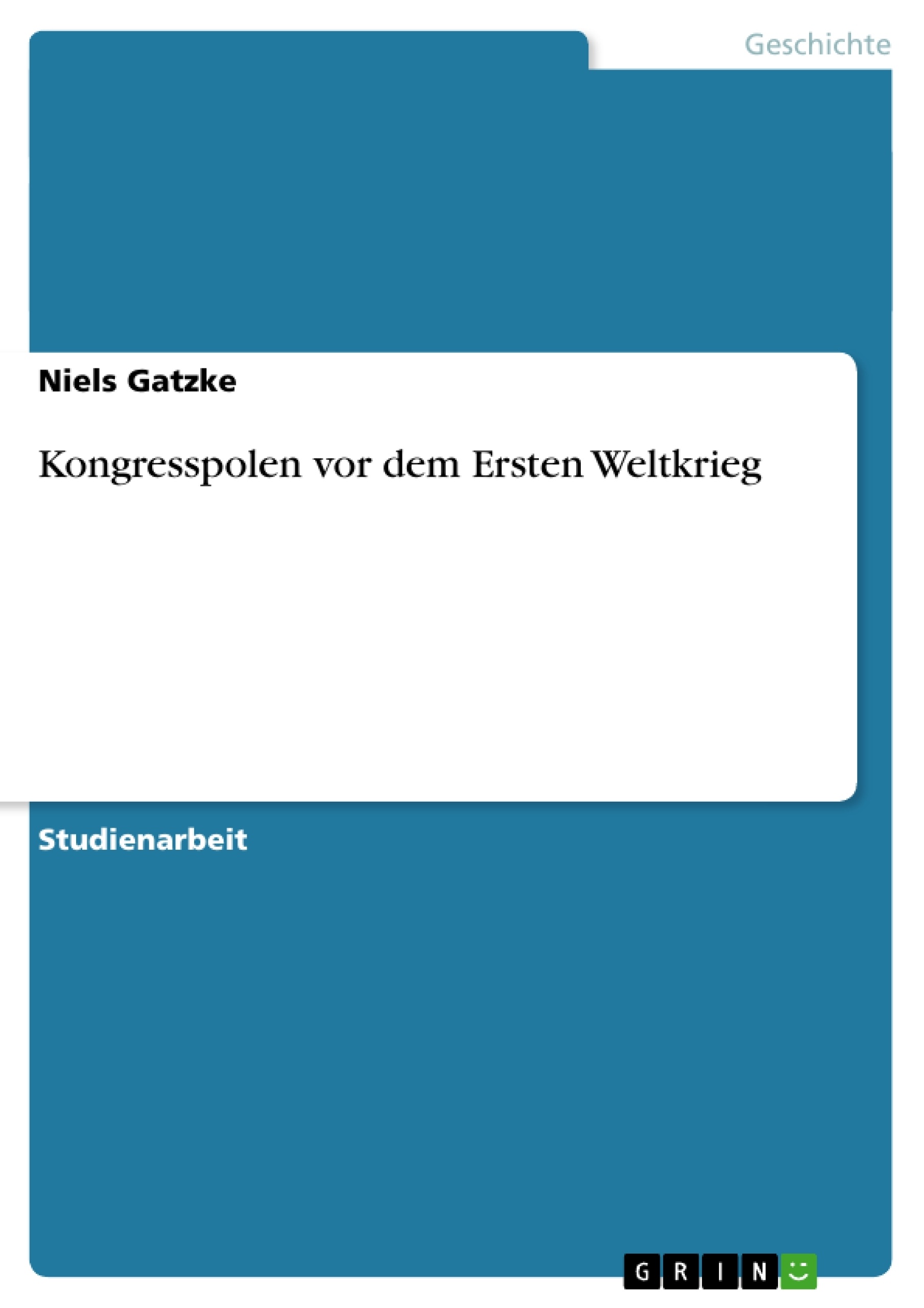Ein polnischer Staat bestand zur Wende des 19. zum 20. Jahrhundert nicht, Polen war seit 1795 vollständig zwischen Preußen, Russland und Österreich geteilt. Die vorliegende Arbeit untersucht die Situation des russischen Teils Polens, der im Wiener Kongress als „Königreich Polen“ in Personalunion mit dem Kaiserreich Russland eingerichtet worden war, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Dabei soll das damalige Kongresspolen mit anderen europäischen Staaten verglichen werden. Aus diesem Grund folgt die Gliederung der Arbeit einer Themenstruktur, die grundsätzlich auf alle europäischen Staaten des betrachteten Zeitabschnitts anwendbar ist. Die vorliegende Arbeit ist im Detail wie folgt aufgebaut: Unter „Bevölkerung und Gesellschaft“ werden kurz einige statistische Daten aufbereitet. Das Kapitel „Politisches System“ stellt die allgemeine und rechtliche Situation des Königreichs angesichts russischer Fremdherrschaft dar. In „Wirtschaft. Industrialisierung und Landwirtschaft“ wird der Stand der kongresspolnischen Entwicklung und das daraus resultierende Verhältnis von Industrialisierung und Landwirtschaft nachgezeichnet. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Kapiteln ist der nächste Abschnitt „Politische Kultur und öffentliche Meinung“ noch einmal untergliedert, um auf die Besonderheiten der kongresspolnischen Entwicklung näher eingehen zu können. „Politische Bewegung und Parteien“ vollzieht die Gründung von politischen Parteien in Kongresspolen nach und geht kurz auf die Zeitungslandschaft ein. Der Titel des Kapitels „1905: Erste Revolution oder vierter Polnischer Aufstand“ deutet an, dass die Ereignisse des Jahres 1905 als sozialistische Revolution oder als nationaler Aufstand gedeutet werden können. Im Unterpunkt „Nation und Unabhängigkeitsbewegung“ wird der Versuch unternommen, die Entwicklung des polnischen Nationalismus und des Bemühens um Unabhängigkeit zur Jahrhundertwende zu beschreiben, um daraus eine Charakteristik abzuleiten. In „Kultur und Zeitgeist“ werden schließlich „Literatur“, „Malerei“ und „Musik“ Polens in der Epochenwende zum 20. Jahrhunderts dargestellt. In allen Kapiteln werden – wo dies möglich ist – Vergleiche zu anderen europäischen Staaten und Gebieten gezogen, um die jeweiligen Themen aus einer europäisch vergleichenden Perspektive betrachten zu können.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Bevölkerung und Gesellschaft
3. Politisches System
4. Wirtschaft. Industrialisierung und Landwirtschaft
5. Politische Kultur und öffentliche Meinung
5.1. Politische Bewegungen und Parteien
5.2. 1905: Erste Revolution oder vierter Polnischer Aufstand
5.3. Nation und Unabhängigkeitsbewegung
6. Kultur und Zeitgeist
6.1. Literatur
6.2. Malerei
6.3. Musik
7. Resümee
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Ein polnischer Staat bestand zur Wende des 19. zum 20. Jahrhundert nicht, Polen war seit 1795 vollständig zwischen Preußen, Russland und Österreich geteilt. Die vorliegende Arbeit untersucht die Situation des russischen Teils Polens, der im Wiener Kongress als „Königreich Polen“ in Personalunion mit dem Kaiserreich Russland eingerichtet worden war, in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Dabei soll das damalige Kongresspolen mit anderen europäischen Staaten verglichen werden. Aus diesem Grund folgt die Gliederung der Arbeit einer Themenstruktur, die grundsätzlich auf alle europäischen Staaten des betrachteten Zeitabschnitts anwendbar ist.
Die vorliegende Arbeit ist im Detail wie folgt aufgebaut: Unter „Bevölkerung und Gesellschaft“ werden kurz einige statistische Daten aufbereitet. Das Kapitel „Politisches System“ stellt die allgemeine und rechtliche Situation des Königreichs angesichts russischer Fremdherrschaft dar. In „Wirtschaft. Industrialisierung und Landwirtschaft“ wird der Stand der kongresspolnischen Entwicklung und das daraus resultierende Verhältnis von Industrialisierung und Landwirtschaft nachgezeichnet. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Kapiteln ist der nächste Abschnitt „Politische Kultur und öffentliche Meinung“ noch einmal untergliedert, um auf die Besonderheiten der kongresspolnischen Entwicklung näher eingehen zu können. „Politische Bewegung und Parteien“ vollzieht die Gründung von politischen Parteien in Kongresspolen nach und geht kurz auf die Zeitungslandschaft ein. Der Titel des Kapitels „1905: Erste Revolution oder vierter Polnischer Aufstand“ deutet an, dass die Ereignisse des Jahres 1905 als sozialistische Revolution oder als nationaler Aufstand gedeutet werden können. Im Unterpunkt „Nation und Unabhängigkeitsbewegung“ wird der Versuch unternommen, die Entwicklung des polnischen Nationalismus und des Bemühens um Unabhängigkeit zur Jahrhundertwende zu beschreiben, um daraus eine Charakteristik abzuleiten. In „Kultur und Zeitgeist“ werden schließlich „Literatur“, „Malerei“ und „Musik“ Polens in der Epochenwende zum 20. Jahrhunderts dargestellt. In allen Kapiteln werden - wo dies möglich ist - Vergleiche zu anderen europäischen Staaten und Gebieten gezogen, um die jeweiligen Themen aus einer europäisch vergleichenden Perspektive betrachten zu können. In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Kongresspolen“ und „Königreich Polen“ synonym verwendet.
2. Bevölkerung und Gesellschaft
Das Gebiet des Königreichs Polen umfasste 1913 126.955 km 2. Auf dieser Fläche lebten knapp 13 Millionen Menschen. Die genannte Fläche entsprach 2,6 Prozent des Gebiets des damaligen europäischen Russlands. Die Bevölkerungszahl machte 10,3 Prozent der Gesamtbevölkerung im europäischen Russland aus.1 Damit war das Gebiet größer als das souveräner, europäischer Staaten wie Belgien, die Niederlande oder Dänemark und hatte mehr Einwohner als jeder Balkanstaat. Von der Bevölkerung lebten 4,1 Millionen Menschen in Städten und etwas weniger als 9 Millionen auf dem Land.2 Der Grad der Urbanisierung war damit doppelt so hoch wie im gesamten europäischen Russland.3 Dennoch war die überwiegende Zahl der polnischen Städte Kleinstädte, die vielfach fließende Übergänge zum Dorf aufwiesen.4 Konfessionell waren 75 Prozent der Einwohner Katholiken, 14 Prozent mosaischen Glaubens, über 5 Prozent protestantischen und über 4 Prozent griechisch-orthodoxen Glaubens.5 Es gab einen großen Geburtenanstieg.6 Dies beförderte eine starke Auswanderung, die ihren Höhepunkt ab 1890 erreichte.
41,8 Prozent der in Russland lebenden Polen waren lesefähig, während im gesamten Russland lediglich 27,7 Prozent lesen konnten. Innerhalb Russlands lagen in der Alphabetisierungsquote lediglich Balten, Juden und Deutsche vor den Polen. Allerdings lag der Anteil bei den Männern gleich hoch wie bei den Russen, d.h. dass prozentual mehr polnische Frauen als russische in Russland lesen konnten. Die Hälfte der lesefähigen Polen konnte auch Russisch lesen.7
3. Politisches System
Nach dem polnischen Aufstand von 1863 setzten die verstärkten russischen Repressivmaßnahmen ein. Kongresspolen sollte, wie die ehemaligen polnischen Ostgebiete, zur russischen Provinz werden. Mit zahlreichen Einzelverfügungen verlor das Königreich bis 1874 schrittweise seine Sonderstellung innerhalb Russlands.8 Es wurde vollständig unter die Zentralverwaltung in St. Petersburg gestellt.9 Dies zeigte sich symbolisch in der Bezeichnung „Weichselland“ (Privislinskij kraj) oder „Weichselgouvernements“ (Privislinskie gubernie) anstelle von „Königreich Polen“.10 Der Titel „Vizekönig“ war erloschen, es bestanden nur noch Generalgouverneure in Warschau, allerdings mit großen Sondervollmachten: Sie konnten Straf- und Verwaltungsverfahren selbst entscheiden, Zivilisten vor ein Militärgericht bringen oder ohne Verfahren in die Verbannung schicken.11 Russisch war alleinige Verwaltungssprache und alle höheren Verwaltungsstellen waren von Russen besetzt. An der Stelle von fünf polnischen Verwaltungseinheiten traten zehn Gouvernements nach russischem Vorbild, die ausnahmslos von Russen verwaltet und geführt wurden. Obwohl der Code Napoléon offiziell in Kraft blieb, wurde das Gerichtswesen russifiziert. Die bis 1870 bestehende eigene Finanzverwaltung und das eigene Budgetrecht wurden aufgehoben, und somit sank die Bank Polski zu einer Zweigstelle der zaristischen Bank ab.12 Auf Kongresspolen übertrug der Zar die in Russland erreichten Reformen nicht, wie etwa die Justizreform oder die Selbstverwaltung des Adels in Städten und auf dem Land (zemstvo). Die Gutsbesitzer hatten ihre Polizeigewalt in den Dörfern verloren und wurden durch gewählte Schulzen (sołtys) oder russische Beamte ersetzt. Die Äußerungen der polnischen Presse waren durch Zensur eingeschränkt.
4. Wirtschaft. Industrialisierung und Landwirtschaft
Die Bevölkerungszählung von 1897 deutet auf eine Wirtschaft im frühen Stadium der industriellen Entwicklung hin, aufgrund der hohen Zahl von Beschäftigten in der Landwirtschaft, in häuslichen Diensten und der ungelernten Arbeiter.13 Insbesondere waren die Gesundheits- und Bildungswesen unzulänglich. Die Landwirtschaft war mit 47,9 Prozent aller Beschäftigten der größte Sektor der Wirtschaft.14 Im zunehmenden Maße setzten sich die arbeitsintensivere Produktion von Zuckerrüben, Flachs, Kartoffeln gegenüber Getreideanbau15 durch. Gründe waren die im europäischen Vergleich kleinen Höfe16 und für russische Verhältnisse dichte Besiedlung des Bodens.
Da es eine hohe Anzahl besitzloser Landbevölkerung gab17, waren die Möglichkeiten für Kleinbauern, bei Großgrundbesitzern etwas dazuzuverdienen, eingeschränkt. Durch eine verhältnismäßig hohe Bevölkerungswachstumsrate wuchsen vor allem die städtischen Regionen.18 Es gab dadurch auch eine starke saisonale Wanderung zu landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen nach Deutschland, Dänemark und in die Provinzen des europäischen Russlands19 und eine dauerhafte Auswanderung ins Ruhrgebiet, nach Nord- und Südamerika, sowie nach Frankreich und Belgien.20 Auch der Prozess der Landveräußerung schritt voran21, da die Großgrundbesitzer unter der Konkurrenz derexpandierenden landwirtschaftlichen Regionen in Südrussland litten.22
[...]
1 Vgl. Fischer, Wolfram (Hg.), Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg (Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 5), Stuttgart 1985, S. 584.
2 Vgl. Ebd.
3 Vgl. Ebd.
4 Vgl. Jaworski, Rudolf /Lübke, Christian /Müller, Michael G., Eine kleine Geschichte Polens, Frankfurt am Main 2000, S. 283.
5 Vgl. Fischer, Wolfram (Hg.), S. 584.
6 Die Jährliche Wachstumsrate der Bevölkerung schwankt in den fünf Jahrzehnten zwischen 1861 bis 1910 zwischen 1,5 und 2,2 Prozent. Vgl. Grabski, Wladyslaw (Hg.), Rocznik Statystyczny Krolestwa Polskiego, Rok 1913, Warschau 1913, in: Fischer, Wolfram (Hg.), S.584.
7 Vgl. Kappeler, Andreas, Russland als Vielvölkerreich. Entstehung - Geschichte - Zerfall. München 1992, S. 256 ff.
8 Vgl. Schmidt-Rösler, Polen. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 1996, S. 91 oder Rhode, Gotthold, Geschichte Polens. Ein Überblick, Darmstadt 1980, S. 401.
9 Alle polnischen Verwaltungsinstanzen waren aufgelöst worden: der Staatsrat, der Verwaltungsrat (die Regierung) und die Regierungskommissionen (die Ministerien). Vgl. Alexander, Manfred, Kleine Geschichte Polens, Stuttgart 2003, S. 238.
10 Vgl. Rhode, Gotthold, Geschichte…, S. 401f.
11 Vgl. Alexander, Manfred, S. 238.
12 Vgl. Hoensch, Jörg K., Geschichte Polens, Stuttgart 1998, S. 220f.
13 Vgl. Fischer, Wolfram (Hg.), S. 585.
14 Vgl. Ebd., S. 586.
15 Ursache für den Rückgang des Getreideanbaus war neben dem Bevölkerungsdruck, eine Erhöhung der Einfuhrzölle nach Deutschland. Vgl. Craig, Gordon A., Geschichte Europas 1815-1980. Vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart. Dritter Teil 1871-1914, München 1989, S. 307.
16 Vgl. Główny Urząd Statystyczny (1991 a), S. 77 Tab. 68, in: Scherner, Jonas, Eliten und wirtschaftliche Entwicklung. Kongresspolen und Spanien im 19. Jahrhundert, Münster 2001, S. 127, Tab. 4.1.
17 Die Zahl der Landlosen betrug zu Beginn des 20. Jahrhunderts ca. 1,2 Millionen, d.h. etwa 12 Prozent der Gesamtbevölkerung. Vgl. Scherner, Jonas, S. 142.
18 Der Anteil der Einwohner in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern stieg von 1865 bei ca. 5 Prozent, über ca. 9 Prozent in 1880, ca. 9,9 Prozent in 1897 auf ca. 10,6 Prozent in 1910 an. Vgl. Ebd., S. 12.
19 Vgl. Fischer, Wolfram (Hg.), S. 588. Kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges betrug die jährliche Zahl der Saisonarbeiter nach Deutschland ca. 400.000 Personen. Vgl. Orpiszewski, L. v., Die Abwanderung der landwirtschaftlichen Arbeiter aus dem Königreich Polen nach Deutschland, Inaugural-Dissertation, Göttingen 1907, S. 35, nach Scherner, Jonas, S. 150. Nach Arnold, St. /Żychoski, M. betrug die Anzahl nur 200.000 bis 300.000. Arnold, St. /Żychoski, M., Abriß der Geschichte Polens, Warschau 1967, S. 152ff., nach Fuhrmann, Rainer, Polen: Abriß der Geschichte, Hannover 1981, S. 99.
20 Zwischen 1870 und 1914 haben rund 3,6 Millionen Menschen Polen verlassen, davon 36 Prozent aus dem Teilungsgebiet in Russland. Vgl. Davies, Norman, Heart of Europe - a short history of Poland, Oxford u.a. 1987, S. 256.
21 Zwei Drittel des Adels übten um 1897 bereits städtische Berufe aus. Vgl. Rhode, Gotthold, Geschichte…, S. 405.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der thematische Fokus dieses Textes über Polen?
Der Text analysiert die Situation des russischen Teils Polens, bekannt als Kongresspolen oder Königreich Polen, vor dem Ersten Weltkrieg. Er vergleicht Kongresspolen mit anderen europäischen Staaten, wobei eine Themenstruktur verwendet wird, die auf alle europäischen Staaten der Zeit anwendbar ist.
Wie ist der Text gegliedert?
Der Text ist in folgende Kapitel unterteilt: Einleitung, Bevölkerung und Gesellschaft, Politisches System, Wirtschaft (Industrialisierung und Landwirtschaft), Politische Kultur und Öffentliche Meinung (einschließlich politischer Bewegungen, der Revolution von 1905, und der National- und Unabhängigkeitsbewegung), Kultur und Zeitgeist (Literatur, Malerei, Musik), Resümee und Literaturverzeichnis.
Welche demografischen Informationen werden über Kongresspolen bereitgestellt?
Im Jahr 1913 umfasste Kongresspolen 126.955 km². Es hatte knapp 13 Millionen Einwohner, wovon 4,1 Millionen in Städten und fast 9 Millionen auf dem Land lebten. 75% der Bevölkerung waren Katholiken, 14% mosaischen Glaubens, über 5% protestantischen und über 4% griechisch-orthodoxen Glaubens. Es gab eine hohe Geburtenrate und starke Auswanderung.
Wie war die Alphabetisierung in Kongresspolen im Vergleich zu Russland?
Die Alphabetisierungsrate in Kongresspolen betrug 41,8%, während sie im gesamten Russland nur 27,7% betrug. Nur Balten, Juden und Deutsche hatten innerhalb Russlands höhere Alphabetisierungsquoten. Ein bedeutender Anteil polnischer Frauen konnte lesen, und die Hälfte der lesefähigen Polen beherrschte auch Russisch.
Wie wurde das politische System Kongresspolens von Russland beeinflusst?
Nach dem polnischen Aufstand von 1863 verschärften sich die russischen Repressalien. Kongresspolen sollte zu einer russischen Provinz werden und verlor bis 1874 schrittweise seine Sonderstellung. Es wurde der Zentralverwaltung in St. Petersburg unterstellt und als "Weichselland" bezeichnet. Generalgouverneure in Warschau hatten Sondervollmachten, Russisch war alleinige Verwaltungssprache und höhere Verwaltungsstellen waren von Russen besetzt. Reformen, die in Russland durchgeführt wurden, wurden nicht auf Kongresspolen übertragen.
Wie sah die wirtschaftliche Situation in Kongresspolen aus?
Die Wirtschaft befand sich in einem frühen Stadium der industriellen Entwicklung, mit einem hohen Anteil an Beschäftigten in der Landwirtschaft (47,9%). Es gab eine Zunahme arbeitsintensiver Produktion von Zuckerrüben, Flachs und Kartoffeln im Vergleich zum Getreideanbau. Die Landwirtschaft war durch kleine Höfe und dichte Besiedlung gekennzeichnet. Aufgrund von Landlosigkeit und Bevölkerungswachstum gab es erhebliche saisonale Wanderung und dauerhafte Auswanderung.
Welche Rolle spielte die Landveräußerung in Kongresspolen?
Die Landveräußerung schritt voran, da Großgrundbesitzer unter der Konkurrenz expandierender landwirtschaftlicher Regionen in Südrussland litten. Dies führte dazu, dass viele Adlige städtische Berufe ausübten.
- Quote paper
- Mag. Niels Gatzke (Author), 2006, Kongresspolen vor dem Ersten Weltkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162421