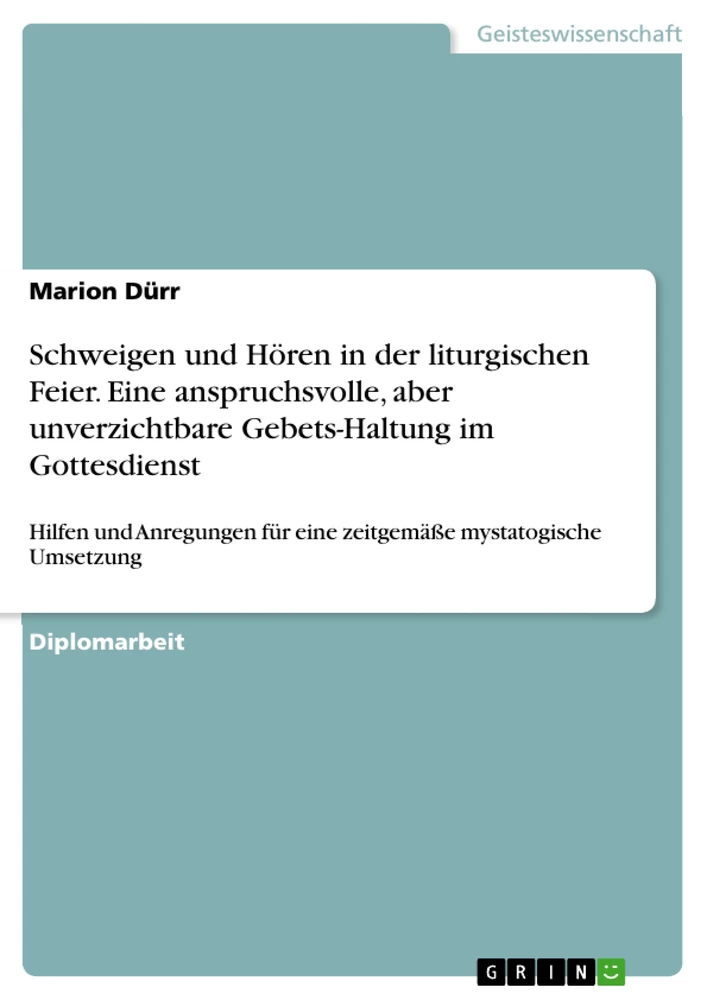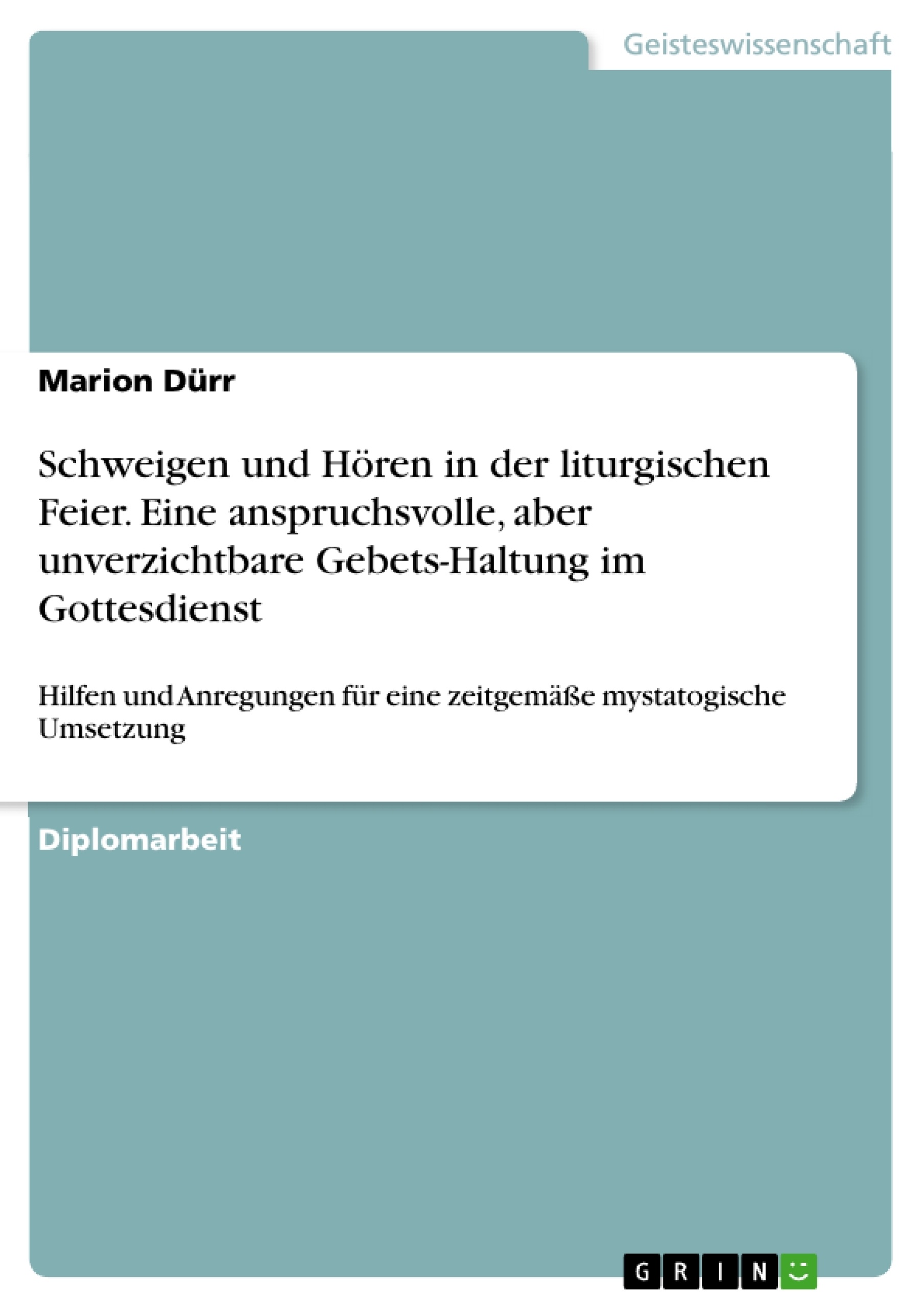In unserer hektischen und lauten Welt sind die Menschen auf der Suche nach Ruhe und Stille und vermissen dies darum oft auch in unseren Gottesdiensten. Zu viel wird da geredet und es bleibt so wenig Raum für die innere Einkehr, das stille Gebet und das Nachklingen des Gesagten. Der Mensch kann jedoch in solchen Gottesdiensten, die keine Stille mehr kennen, nur schwer Erfahrungen der Gegenwart Gottes machen. Die Mystiker bezeugen es: Der Mensch kann Gott in seinem Innersten nur in Stille und Schweigen begegnen.
Demzufolge wird eine Liturgie, die Räume der Stille ermöglicht, zu einer mystagogischen Liturgie, in der Hören und Horchen gelernt werden kann und in der Gott und Mensch sich begegnen können.
Die Liturgiekonstitution spricht vom "Heiligen Schweigen", für welches auch die Allgemeinen Einführung in das Messbuch an verschiedenen Stellen Stille empfiehlt.
Die vorliegende Arbeit zeigt diese Räume des Schweigens und Hörens in der liturgischen Feier auf, benennt mögliche Gestaltungsformen und schließt mit einem praktischen Veranstaltungsvorschlag zu diesem Thema in der Arbeit mit Wortgottesdienstleitern.
Inhaltsverzeichnis
- Bedeutung des Schweigens und Hörens für den heutigen Menschen
- Schweigen und Hören - grundlegend für das Menschsein
- DIE,,SCHWEIGE- UND HÖRFÄHIGKEIT“ DES HEUTIGEN MENSCHEN
- RELEVANZ dieser ErkenNTNISSE FÜR DIE LITURGISCHE Feier
- Die Bedeutung des Schweigens und Hörens für die Gottes-beziehung
- SCHWEIGEN UND HÖREN IM THEOLOGISCH-BIBLISCHEN KONTEXT
- Das Schweigen des Menschen vor Gott
- Jesus - ein schweigender und hörender Mensch
- Das Schweigen Gottes gegenüber dem Menschen
- Konsequenzen für die liturgische Feier
- SCHWEIGEN UND HÖREN BEI DEN MYSTIKERN
- Meister Eckhart (1260-1327)
- Teresa von Avila (1515-1582)
- Johannes vom Kreuz (1542-1591)
- Relevanz für die liturgische Feier
- Schweigen und Hören in der liturgischen Feier
- DIE STILLE ALS WICHTIGER BESTANDTEIL EINER MYSTAGOGISCHEN LITURGIE
- SCHWEIGEN UND HÖREN ALS „Tätige TeilnaHME“
- SCHWEIGEN UND HÖREN ALS GEBET
- SCHWEIGEN UND HÖREN SCHAFFT GEMEINSCHAFT
- „DIE DREI KONSTITUTIVEN DIMENSIONEN DER CHRISTLICHEN GOTTESDIENSTFeier: Katabase, DIABASE UND ANABASE“
- Mögliche „Orte“ des „Heiligen Schweigens\" und des „Hörens“ in der liturgischen Feier und ihre Formen
- SCHWEIGEN UND HÖREN IM ERÖFFNUNGSTEIL DES GOTTESDIENSTES
- Die Stille vor dem Allgemeinen Schuldbekenntnis
- Die Stille zwischen Gebetseinladung und Oration
- SCHWEIGEN UND HÖREN IN DER WORTGOTTESFEIER
- Schweigen und Hören im Umkreis der Verkündigung des Wortes Gottes
- Die Stille beim Allgemeinen Gebet
- SCHWEIGEN UND HÖREN IN DER EUCHARISTIEFEIER
- Das,,Heilige Schweigen“ während der Gabenbereitung
- Schweigen und Hören im Hochgebet
- Schweigen und Hören im Umkreis der Kommunionausteilung
- Schweigen und Hören in anderen Gottesdienstformen
- SCHWEIGEN UND HÖREN IM MORGEN – UND ABENDLOB
- SCHWEIGEN UND HÖREN IN DER (EUCHARISTISCHEN) ANDACHT
- SCHWEIGEN UND HÖREN IN DER FEIER VOM LEIDEN UND STERBEN JESU AM KARFREITAG
- Was im Umgang mit der Stille im Gottesdienst beachtet werden sollte
- MUSS DIE STILLE IMMER „GEFÜLLT“ SEIN?
- WIE VIEL STILLE BRAUCHT DER GOTTESDIENST?
- DIE ROLLE DES VORSTEHERS
- Zusammenfassung und Ausblick
- Liturgiekatechetische Tage für Wortgottesdienstleiter: „Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr...“
- ADRESSATEN UND GROBZIEL DER VERANSTALTUNG
- ZEIT UND ORT DER VERANSTALTUNG
- ABLAUFPLAN DER VERANSTALTUNG
- BESCHREIBUNG DES ABLAUFS UND BEGRÜNDUNG DER Feinziele
- Beginn der Veranstaltung
- 1. Einheit
- Abendlob/Morgenlob
- 2. Einheit
- 3. Einheit
- 4. Einheit
- Bausteine für die Wortgottesfeier
- 5. Einheit
- Abschluss der Veranstaltung
- HANDREICHUNGEN FÜR DIE TEILNEHMER
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Schweigens und Hörens im Kontext der liturgischen Feier. Ziel ist es, die Chancen und Schwierigkeiten einer anspruchsvollen, aber unverzichtbaren Gebets-Haltung im Gottesdienst aufzuzeigen und Hilfen sowie Anregungen für eine zeitgemäße mystagogische Umsetzung zu liefern.
- Die Bedeutung des Schweigens und Hörens im Menschsein und in der Kommunikation
- Das Schweigen und Hören in der Gottesbeziehung im theologisch-biblischen Kontext und bei den Mystikern
- Die Rolle des Schweigens und Hörens in der liturgischen Feier als wichtiger Bestandteil einer mystagogischen Liturgie
- Mögliche „Orte“ des „Heiligen Schweigens“ und des „Hörens“ in verschiedenen Gottesdienstformen
- Praktische Hinweise und Reflexionen zum Umgang mit der Stille im Gottesdienst
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Schweigens und Hörens für den heutigen Menschen. Es werden die grundlegenden Aspekte des Horchens im Menschsein sowie die Herausforderungen, die der heutige Mensch in Bezug auf seine Schweige- und Hörfähigkeit hat, erörtert. Das Kapitel schließt mit der Relevanz dieser Erkenntnisse für die liturgische Feier.
Kapitel zwei widmet sich der Bedeutung des Schweigens und Hörens für die Gottesbeziehung. Es werden sowohl die Perspektive des Menschen vor Gott als auch die des Schweigens Gottes gegenüber dem Menschen beleuchtet. Zudem wird die Bedeutung des Schweigens und Hörens im Leben Jesu sowie bei den Mystikern beleuchtet. Die Relevanz dieser Erkenntnisse für die liturgische Feier wird ebenfalls hervorgehoben.
Kapitel drei untersucht die Rolle des Schweigens und Hörens in der liturgischen Feier. Es wird die Stille als wichtiger Bestandteil einer mystagogischen Liturgie herausgestellt. Die Bedeutung des Schweigens und Hörens als „tätige Teilnahme“ sowie als Gebet wird erläutert. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Schweigens und Hörens für die Gemeinschaft beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit möglichen „Orten“ des „Heiligen Schweigens“ und des „Hörens“ in verschiedenen Abschnitten der liturgischen Feier, wie z.B. im Eröffnungsteil, in der Wortgottesfeier und in der Eucharistiefeier. Die verschiedenen Formen des Schweigens und Hörens in diesen Abschnitten werden analysiert.
Kapitel fünf widmet sich dem Schweigen und Hören in anderen Gottesdienstformen, wie z.B. im Morgen- und Abendlob, in der (eucharistischen) Andacht und in der Feier vom Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag.
Das sechste Kapitel geht auf wichtige Aspekte im Umgang mit der Stille im Gottesdienst ein. Es werden Fragen nach der Notwendigkeit von Stille im Gottesdienst, der optimalen Dauer von Stille sowie der Rolle des Vorstehers im Umgang mit Stille erörtert.
Schlüsselwörter
Schweigen, Hören, Liturgische Feier, Mystagogie, Gottesbeziehung, Theologie, Bibel, Mystiker, Meister Eckhart, Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Kommunikation, Stille, Gebet, Gemeinschaft, Gottesdienstformen, Morgenlob, Abendlob, Andacht, Karfreitag, Liturgiekatechese
- Quote paper
- Marion Dürr (Author), 2003, Schweigen und Hören in der liturgischen Feier. Eine anspruchsvolle, aber unverzichtbare Gebets-Haltung im Gottesdienst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16239