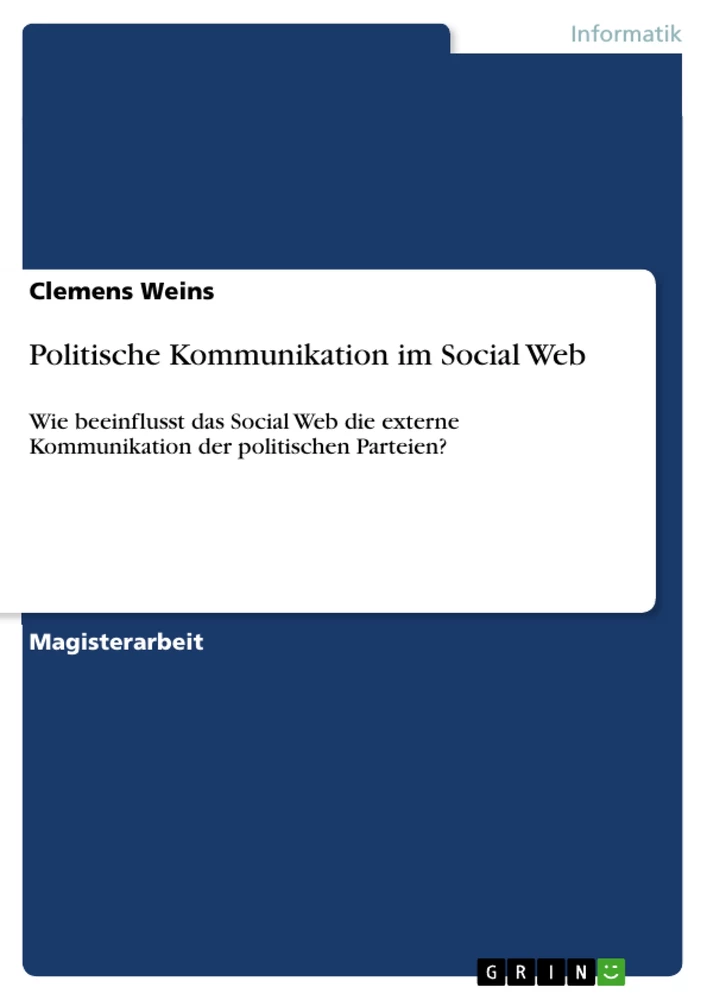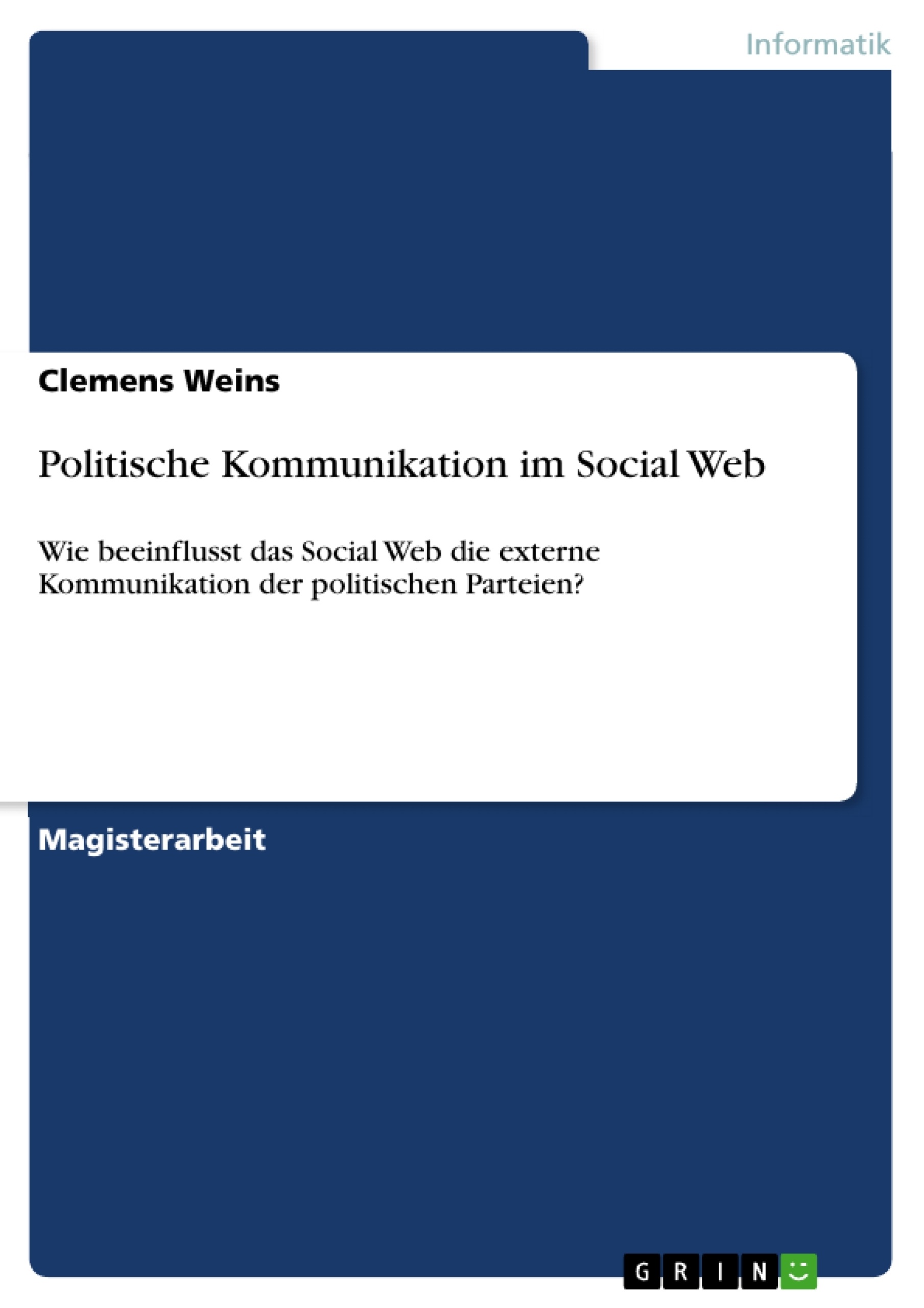Der Bürger hat sich in den letzten 15 Jahren das Internet zu Eigen gemacht - einerseits durch allgemeinverständlich anwendbare Kommunikations- und Partizipationswerkzeuge und andererseits mittels dezentraler mobiler Nutzung. Heute nutzen knapp 70% der Deutschen das Internet. Dementsprechend steigen auch die Teilnehmerzahlen in Sozialen Netzwerken an. Menschen tauschen online Bilder des letzten Urlaubes miteinander aus und kommunizieren auf verschiedenen Dialogplattformen multimedial. Die Teilnehmer des sogenannten Social Web prägen demzufolge durch ihr Verhalten das Netz, indem sie es als beliebig öffentliches Kommunikations- und Dialogmedium nutzen.
In diesem Raum, in dem der Bürger frei agiert, räsoniert und diskutiert, findet Politik statt. Zunehmend treten die politischen Parteien und Politiker in diesen öffentlichen digitalen Raum ein. Da sich das Social Web durch den Dialog begründet, stellt sich die Frage, inwiefern die Parteien und Politiker als Teilnehmer des Social Web verstanden werden können. Sind sie als Sender von Information außerhalb oder als Dialogpartner innerhalb dieses öffentlichen Raumes präsent? Damit einhergehend stellt sich die zentrale Frage dieser Arbeit: Wie kann das Social Web die externe Kommunikation politischer Parteien beeinflussen?
Im Folgenden wird aus idealtheoretischer Sichtweise erarbeitet, wie sich das Social Web zusammensetzt, wie die Bürger in diesem Raum leben, in welcher Rolle sie agieren, wie sich Politiker und Parteien präsentieren und inwiefern Letztere in Anlehnung an die Logik des Social Web mit dem Bürger interagieren.
Da in dieser Arbeit die öffentlichen Akteure Bürger, Politiker und Parteien im Social Web idealtheoretisch analysiert werden, stehen einzelne Social Media-Anwendungen nicht im Fokus der Untersuchungen, sondern werden lediglich als notwendige Werkzeuge erwähnt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Politische Kommunikation
- 2.1. Aufgaben, Ziele und Funktionen politischer Kommunikation
- 2.2. Herausforderungen politischer Kommunikation
- 2.2.1. Mögliche Dysfunktionen
- 2.2.2. Die Dependenz- und Instrumentalisierungsthese
- 2.2.3. Der mediale Kompromiss zwischen interner und externer Kommunikation
- 2.3. Öffentlichkeit
- 2.3.1. Strukturwandel der Öffentlichkeit – Untergang des räsonierenden Bürgers?
- 2.3.2. Parteienkommunikation und öffentliche Meinung
- 2.3.2.1. Modelle öffentlicher Meinung
- 2.3.2.2. Problem der Public Relations in der Politik
- 2.4. Wahlkampf als Sonderform politischer Kommunikation
- 2.5. Fazit
- 3. Kommunikation und Partizipation im Social Web
- 3.1. Das Internet
- 3.1.1. Die Entstehung des Internets
- 3.1.1.1. Technische Entwicklung: Von HTML bis HTML5 und Ajax
- 3.1.1.2. Das Internet wird mobil
- 3.1.1. Die Entstehung des Internets
- 3.2. Das Web 2.0 - eine Begriffsdiskussion
- 3.2.1. User Generated Content
- 3.2.2. Der Bottom-Up-Ansatz
- 3.2.3. Web 2.0 und das kommunikative Selbstverständnis
- 3.3. Das Social Web
- 3.3.1. Definitionsversuch „Social Web”
- 3.3.2. Politische Öffentlichkeit und Kommunikation im Social Web
- 3.3.2.1. Gleichheit
- 3.3.2.2. Offenheit
- 3.3.2.3. Diskursivität
- 3.4. Der Bürger im Social Web
- 3.4.1. Leben in Sozialen Netzwerken
- 3.4.1.2. Selbstdarstellung im Social Web - ein neues digitales Selbstbewusstsein
- 3.4.1.3. Globale Netze – lokale Nutzung – persönliche Themen
- 3.4.2. Politisches Engagement im öffentlichen digitalen Raum
- 3.4.2.2. Global vernetzen, lokal handeln
- 3.4.3. Bürger im Social Web - das Fazit
- 3.4.1. Leben in Sozialen Netzwerken
- 3.5. Parteien im Social Web
- 3.5.1. Webauftritte der Bundesparteien
- 3.5.1.1. SPD.de
- 3.5.1.2. CDU.de
- 3.5.1.3. die-linke.de
- 3.5.1.4. fdp.de
- 3.5.1.4. gruene.de
- 3.5.1.5. Zwischenfazit
- 3.5.2. Parteieigene Soziale Netzwerken
- 3.5.2.1. meineSPD.de
- 3.5.2.2. team2009.de
- 3.5.2.3. linksaktiv.de
- 3.5.2.4. Wurzelwerk.gruene.de
- 3.5.2.5. my.fdp.de
- 3.5.2.6. Zwischenfazit
- 3.5.3. Die Nutzung externer sozialer Netzwerke durch Parteien und Politiker
- 3.5.3.1. Die Facebook-Accounts der fünf Bundesparteien
- 3.5.3.2. Die Twitter-Accounts der Bundespolitiker
- 3.5.3.2.1. Twitter-Account Guido von Westerwelle (FDP, Jahrgang 1961)
- 3.5.3.2.3. Titter-Account von Halina Wawzyniak (Die Linke, Jahrgang 1973)
- 3.5.3.2.4. Twitter-Account von Steffi Lemke (Bündnis 90/ Die Grünen, Jahrgang 1968)
- 3.5.3.2.4. Twitter-Account von Hubertus Heil (SPD, Jahrgang 1971)
- 3.5.4. Parteien im Social Web - das Fazit
- 3.5.1. Webauftritte der Bundesparteien
- 3.6. Fazit
- 3.1. Das Internet
- 4. Wie kann das Social Web die externe Kommunikation der politischen Parteien beeinflussen?
- 4.1. Die Social Media-Eignung
- 4.1.1. Authentizität vs. Parteiverschwiegenheit und politisches Hinterzimmer
- 4.1.2. Effektive Nutzung von Social Media und Parteienhierarchie
- 4.1.2.1. Parteienhierarchie und potenzielle Reichweite
- 4.1.2.2. Parteienhierarchie und Dialogaufwand
- 4.1.2.3. Parteienhierarchie und Dialogaufmerksamkeit
- 4.2. Fazit
- 4.1. Die Social Media-Eignung
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der Frage, wie das Social Web die externe Kommunikation politischer Parteien beeinflusst. Sie untersucht, wie die Logik des Social Webs auf die Kommunikation von Parteien und Politikern wirkt, und analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen, die sich durch die Nutzung sozialer Medien für die politische Kommunikation ergeben.
- Der Einfluss des Social Webs auf die politische Kommunikation
- Die Rolle des Bürgers als Akteur im Social Web
- Die Präsenz von Parteien und Politikern im Social Web
- Die Herausforderungen für Parteien in der Nutzung des Social Webs
- Mögliche Auswirkungen des Social Webs auf die politische Landschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der politischen Kommunikation, wobei die Aufgaben, Ziele und Herausforderungen politischer Kommunikation im Detail erläutert werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle der Öffentlichkeit und den Wandel des Bürgers im digitalen Zeitalter gelegt. Der Wahlkampf als Sonderform politischer Kommunikation wird ebenfalls betrachtet.
Im Anschluss wird das Social Web als öffentlicher digitaler Raum analysiert. Die Entwicklung des Internets, die Entstehung des Web 2.0 und die Definition des Social Webs bilden den Ausgangspunkt. Die Rolle des Bürgers im Social Web, sein politisches Engagement und die Präsenz von Parteien und Politikern in diesem Raum stehen im Mittelpunkt. Es werden die Webauftritte von Bundesparteien, parteieigene Soziale Netzwerke und die Nutzung externer sozialer Medien durch Parteien und Politiker untersucht.
Abschließend wird die Frage erörtert, wie das Social Web die externe Kommunikation der politischen Parteien beeinflussen kann. Die Social Media-Eignung und die Herausforderungen für Parteien in der Nutzung dieser Medien werden beleuchtet. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Politische Kommunikation, Social Web, Bürgerbeteiligung, Online-Kommunikation, Parteienkommunikation, Social Media, Wahlkampf, politische Partizipation, Digitalisierung, Public Relations, Öffentlichkeit, Medienwandel
- Citar trabajo
- Clemens Weins (Autor), 2010, Politische Kommunikation im Social Web, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162399