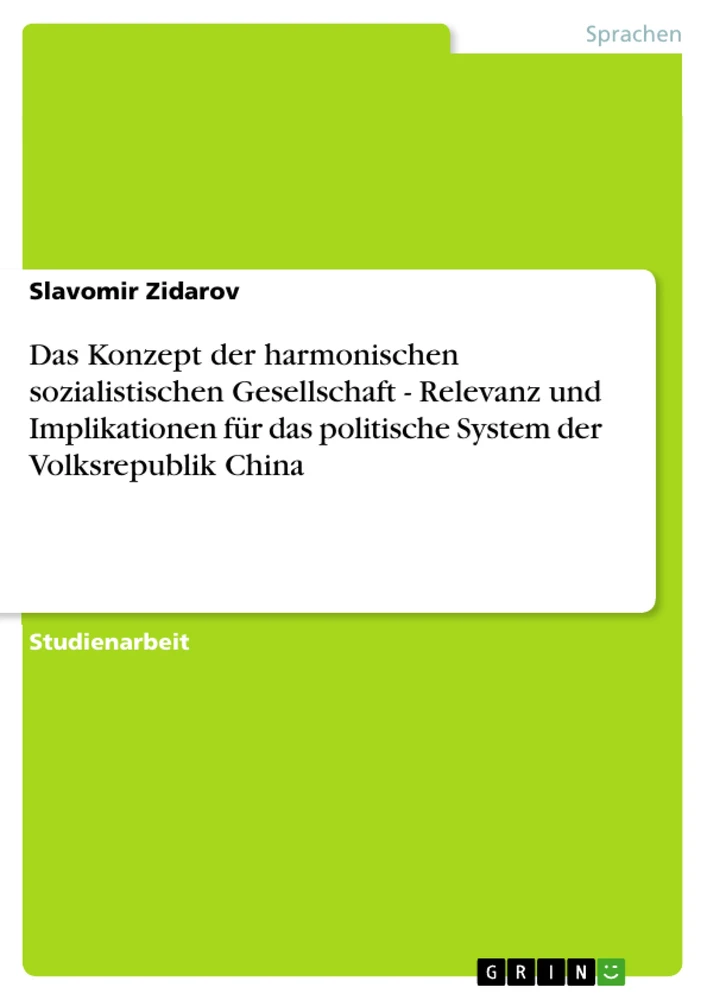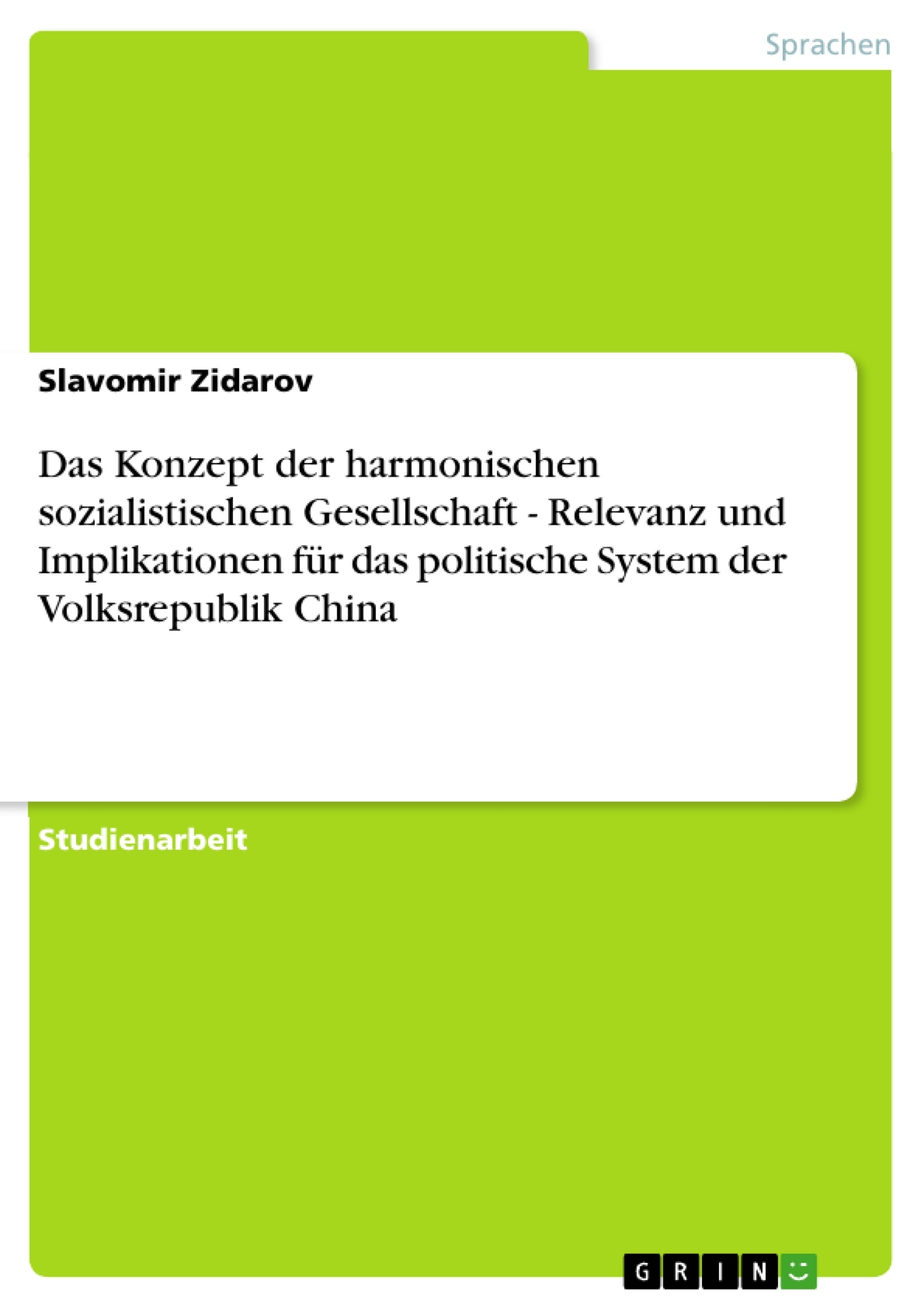Seit Beginn der Reform- und Öffnungspolitik Ende der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts und der damit verbundenen Liberalisierungsmaßnahmen, hat die chinesische Volkswirtschaft ein stetiges und ununterbrochenes Wachstum erfahren, dessen Ausmaße, empirische Eckzahlen und Inhalte sowohl in der Fachliteratur als auch in der populären Presse zu genüge beschrieben worden sind und weiterhin reichlich Diskussionsstoff liefern. Eine der wichtigsten positiven Folgen dieser Entwicklung ist die allgemeine Steigerung des Lohn- und Wohlstandsniveaus und die daraus resultierende dramatische Reduzierung der in Armut lebenden Bevölkerungsschichten. Andererseits hat sich die wirtschaftliche Liberalisierung als nur unzureichend erwiesen, wenn nach der Breitenwirkung von Wohlfahrtsstreuung und Einkommensverteilung in der chinesischen Gesellschaft gefragt wird. Die im Zuge des ökonomischen Aufschwungs auftretenden Einkommensunterschiede begünstigen die Entstehung von klar sichtbaren sozialen Schichten und verschärfen die Trennlinien zwischen ihnen. Die daraus resultierenden Spannungsfelder innerhalb der chinesischen Gesellschaft lassen sich einerseits auf der makroskopischen Ebene ausmachen in Form von Entwicklungs- und Einkommensdiskrepanzen zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung. Andererseits kommen diese auch in einem räumlichen Kontext zum Ausdruck, indem sie den Gegensatz zwischen den durch die Reform- und Öffnungspolitik begünstigten und zu einem beachtlichen Wohlstandsniveau gelangten Küstenregionen im Osten, und den ärmeren, immer noch unterentwickelten Provinzen im Landesinneren, verdeutlichen. Als eine Gegenmaßnahme zu der so entstandenen sozialen Polarisierung wurde das Konzept der „harmonischen sozialistischen Gesellschaft“ (shehuizhuyi hexie shehui) entwickelt, bzw. zum ersten Mal in die Programmatik der KPCh aufgenommen. Holbig bezeichnet diese „harmonische sozialistische Gesellschaft“, zusammen mit den anderen beiden Entwicklungsmodellen des „wissenschaftlichen Entwicklungskonzepts“ (kexue fazhan guan) und der „eigenständigen Innovationskraft“ (zizhu chuangxin nengli) als neue „Visionen“ für die weitere Entwicklung des Landes im politischen Programm der chinesischen Führung unter Hu und Wen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I. 1 Zum Konzept der harmonischen sozialistischen Gesellschaft
- I. 2 Zur Fragestellung
- II. Soziale Spannungen und Ungleichheit in China
- II. 1 Makrostrukturen sozialer Ungleichgewichte
- II. 2 Empirie sozialer Ungleichheit
- II. 3 Charakterisierung neuer sozialer Schichten
- II. 3. 1 Unternehmertum
- II. 3. 2 Mittelschicht
- II. 3. 3 Verarmte städtische Bevölkerung/Wanderarbeiter
- III. Implikationen für das politische System – Lösungsansätze
- III. 1 Theoretische Ansätze
- III. 2 Praktische Umsetzung
- IV. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet das Konzept der "harmonischen sozialistischen Gesellschaft" in der Volksrepublik China, insbesondere im Kontext der sozialen Spannungen und Ungleichheit, die durch die Reform- und Öffnungspolitik entstanden sind. Er analysiert die Implikationen dieses Konzepts für das politische System und untersucht Lösungsansätze.
- Entwicklung der "harmonischen sozialistischen Gesellschaft" als Gegenmaßnahme zur sozialen Polarisierung in China
- Analyse der Makrostrukturen und empirischen Daten sozialer Ungleichheit in China
- Bedeutung des Konzepts für das politische System der Volksrepublik China
- Theoretische und praktische Ansätze zur Umsetzung der "harmonischen sozialistischen Gesellschaft"
- Relevanz des Konzepts im Kontext der Pluralisierungstendenzen in der chinesischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Textes führt das Konzept der "harmonischen sozialistischen Gesellschaft" ein und beleuchtet die Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft seit den 1970er Jahren. Das erste Kapitel analysiert das Konzept genauer, inklusive seiner Definition, Ziele und Dimensionen. Es stellt die "harmonische sozialistische Gesellschaft" als eine Antwort auf die Herausforderungen der Risikogesellschaft dar, die durch soziale Ungleichheit, Umweltverschmutzung und mangelnde Rechtsstaatlichkeit gekennzeichnet ist.
Das zweite Kapitel untersucht die sozialen Spannungen und Ungleichheiten in China. Es analysiert Makrostrukturen, wie die Diskrepanz zwischen Stadt und Land, sowie empirische Daten zur sozialen Ungleichheit. Außerdem wird die Entstehung neuer sozialer Schichten wie Unternehmertum, Mittelschicht und verarmte städtische Bevölkerung/Wanderarbeiter diskutiert.
Schlüsselwörter
Harmonische sozialistische Gesellschaft, soziale Spannungen, Ungleichheit, Reform- und Öffnungspolitik, Risikogesellschaft, politische System, Lösungsansätze, Unternehmertum, Mittelschicht, Wanderarbeiter, Pluralisierung.
- Arbeit zitieren
- Slavomir Zidarov (Autor:in), 2008, Das Konzept der harmonischen sozialistischen Gesellschaft - Relevanz und Implikationen für das politische System der Volksrepublik China, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162355