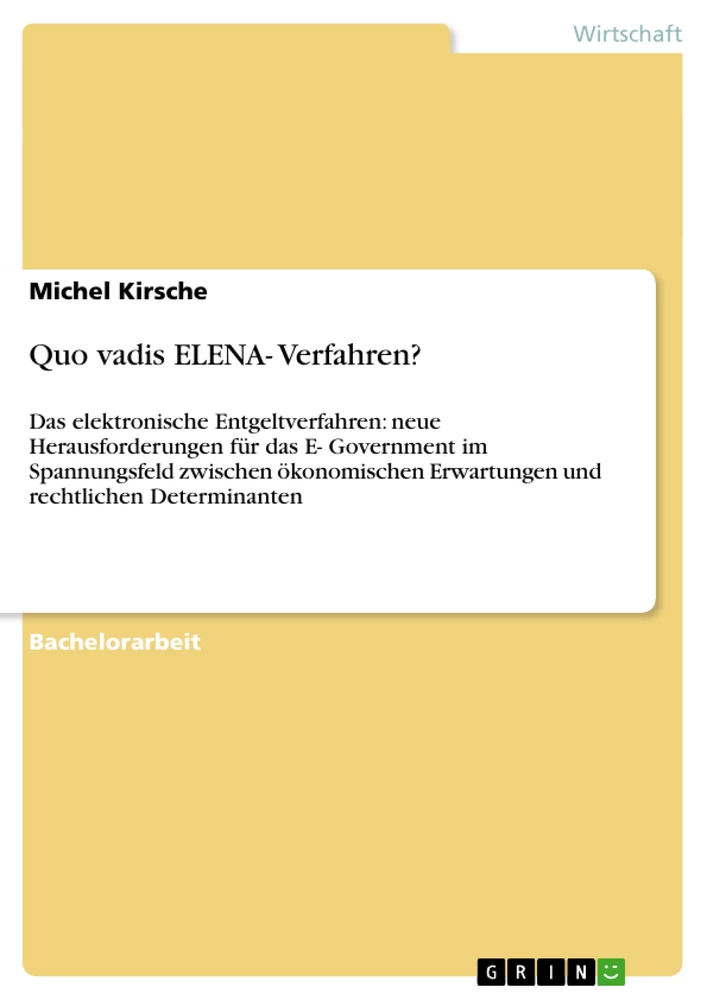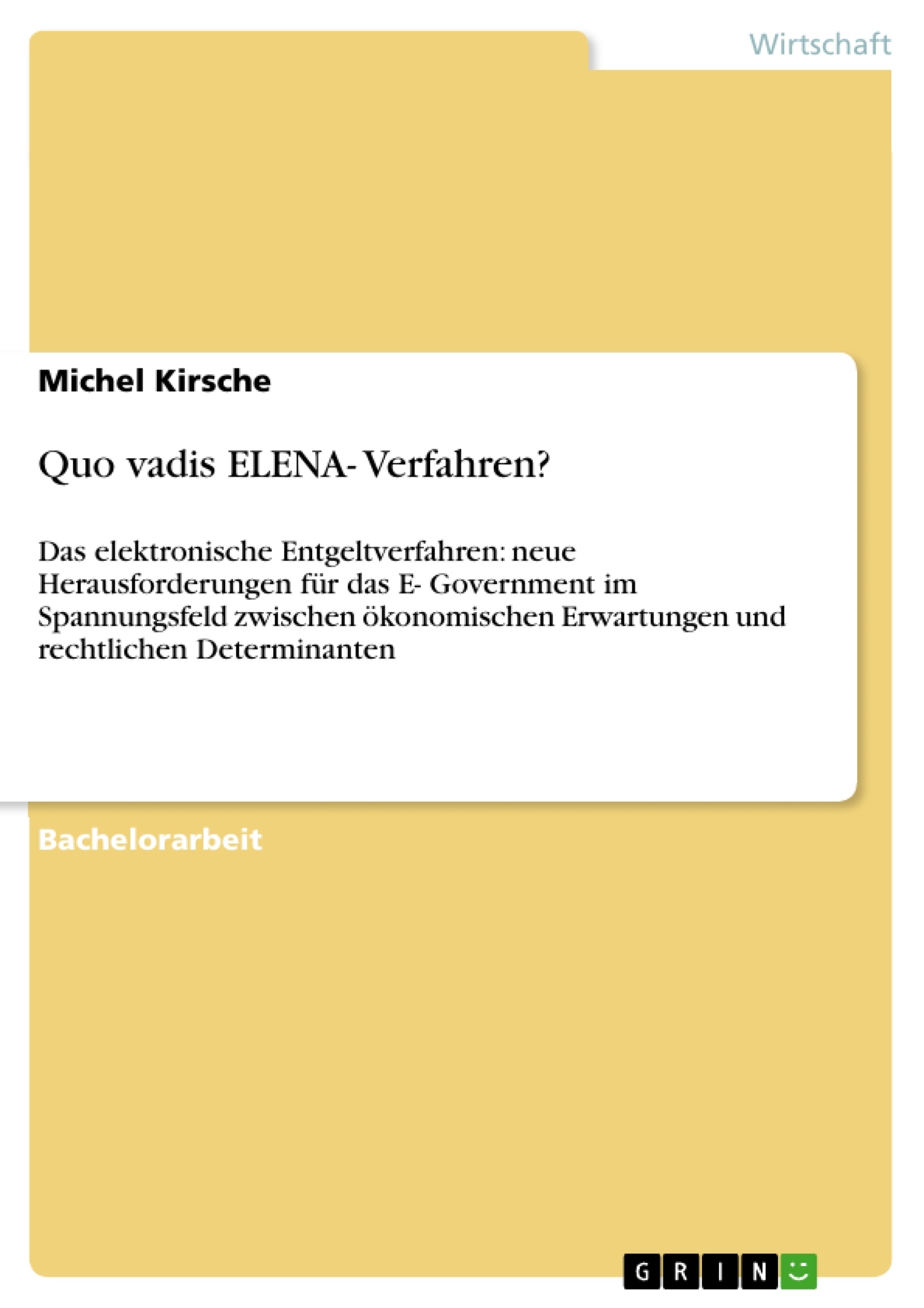Das Internet hat in den letzten Jahren eine geradezu explosionsartige Entwicklung hinter sich.Mehr als die Hälfte der knapp 500 Millionen EU- Bürger nutzt dieses Medium um Rechtsgeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Die neue elektronische Infrastruktur bietet seit einigen Jahren Möglichkeiten für Unternehmen, Bürger und öffentlichen Stellen, die Effizienz von konkreten Abläufen zu steigern. Eine ganz wesentliche Aufgabe im Rahmen des Binnenmarktes ist die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen durch die Schaffung eines großen Heimatmarktes und eines unternehmerfreundlichen Klimas. Zum 1. Januar 2010 startete das elektronische Entgeltnachweisverfahren (ELENA- Verfahren). Arbeitgeber sind damit verpflichtet, sensible Entgelt- und Beschäftigungsdaten ihrer Arbeitnehmer an eine zentrale Speicherstelle zumelden. Die Befürworter des Verfahrens betonen die wahrscheinlich beträchtliche
Kostenentlastung der Wirtschaft. Auch würde es eine Beschleunigung und Vereinfachung von Leistungsanträgen geben. Sollte die notwendige, sichere Infrastruktur zur elektronischen Kommunikation einmal geschaffen worden sein, würde dies Deutschland einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und somit wichtige Arbeitsplätze sichern. Kritiker hingegen sehen erhebliche Datenschutz- und verfassungsrechtliche Bedenken welche bisher nicht
ausgeräumt werden konnten.
„Quo vadis ELENA- Verfahren?“. Frei übersetzen kann man diese aus dem Lateinischen stammende Phrase mit „Wohin gehst du ELENA- Verfahren?“. Im Rahmen dieser Arbeit sollen dem Leser notwendige rechtliche Grundlagen näher gebracht werden, um sodann den Schwerpunkt auf die vielfältigen Kritiken zu legen. Ergänzt und abgerundet wird die Thesis mit Darlegungen zu alternativen Handlungsmöglichkeiten im operativen Geschäftsbetrieb, um Beteiligten zu einer effektiveren Transponierung der neuen digitalen Technik zu verhelfen. Diese Arbeit soll nach dem Rechtstand vom 30. Juni 2010, die Erfordernisse und Rahmenbedingungen des ELENA- Verfahrens zu verdeutlichen, um abschließend den Versuch zu unternehmen, zu urteilen ob ELENA nur ein Risiko oder eine
echte Chance für Deutschland und Europa ist.
Inhaltsverzeichnis
- Hintergründe zur Einführung des ELENA-Verfahrens
- Die Problematik eines obsoleten Bescheinigungswesens
- Probleme durch Eingriffe in die Rechte von Beschäftigten und Arbeitgebern
- Defizite bei Nachkontrollen
- Grundrechtseingriffe gegenüber Arbeitgebern
- Vorläufiger Ausblick auf das elektronische Bescheinigungsverfahren
- Ziel und Zweckmäßigkeit des ELENA-Verfahrens
- Vom Modellversuch bis zum Gesetz - ein Rückblick
- Das ELENA-Verfahren unter der Lupe
- Zum bisherigen Ablauf
- Zukünftige Aussichten des ELENA-Verfahrens
- Die Beteiligten am ELENA-Verfahren
- Der Arbeitgeber im Verfahren
- Die Anmeldung ausgewählter Teilnehmergruppen
- Die Protokollierung und Löschung von Daten
- Die ZSS in Zusammenarbeit mit den Trustcenter und der Registratur Fachverfahren
- Die Trustcenter bzw. Zertifizierungsdienstanbieter
- Leistungsgewährende/Abrufende Stellen
- Die Arbeitnehmer im Verfahren
- Zum Inhalt des multifunktionalen Verdienstdatensatzes
- Kritik am ELENA-Verfahren
- Die Freiwilligkeit der Einwilligung von Betroffenen
- Ausweitung durch Gesetz
- Zur Sicherheit des ELENA-Verfahrens
- Die Gefahr menschlichen Fehlverhaltens
- Verwendung der Daten durch öffentliche Stellen
- Abhandenkommen des PIN
- Verlust der Karte
- Wirtschaftliche Kritik
- Risiko der Arbeitgeber bei Ablösung der Bescheinigungspflicht
- Das ELENA-Verfahren in KMU
- Der finanzielle Aspekt
- Das ELENA-Verfahren aus der Datenschutzperspektive
- Zweckbindung der Verfahrensdaten
- Datenvermeidung und Datensparsamkeit/Berechtigungskonzept
- Fehlende Transparenz für Beschäftigte
- Freitextfeld „Kündigung/Entlassung“
- Datenerhebung bei besonderen Personengruppen
- Das ELENA-Verfahren aus verfassungsrechtlicher Sicht
- ELENA im Lichte des Volkszählungsurteils
- ELENA im Lichte der BVerfG Entscheidung zur BND-Telekommunikationsüberwachung
- ELENA im Lichte der jüngsten BVerfG Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung
- Zusammenfassung der Kritiken
- Die Problematik des bisherigen Bescheinigungswesens und die Notwendigkeit einer Modernisierung.
- Die Funktionsweise und der Ablauf des ELENA-Verfahrens.
- Die datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekte des ELENA-Verfahrens.
- Wirtschaftliche Auswirkungen und Kritikpunkte am ELENA-Verfahren.
- Zukünftige Herausforderungen und Perspektiven für das ELENA-Verfahren.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorthesis untersucht das elektronische Entgeltnachweisverfahren (ELENA) im deutschen E-Government. Ziel ist es, die Herausforderungen des Verfahrens im Spannungsfeld zwischen ökonomischen Erwartungen und rechtlichen Determinanten zu analysieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Hintergründe zur Einführung des ELENA-Verfahrens: Dieses Kapitel beleuchtet die Defizite des alten Bescheinigungssystems, die Eingriffe in die Rechte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sowie die unzureichenden Möglichkeiten der Nachkontrolle. Es wird die Notwendigkeit eines modernen, elektronischen Systems herausgestellt und die Ziele und die Entwicklung des ELENA-Verfahrens bis zum Gesetzesstatus erläutert. Die Kapitelteile zeigen konkret die Probleme auf, die durch das veraltete System entstehen, und bilden eine fundierte Basis für die folgende Analyse des ELENA-Verfahrens.
Das ELENA-Verfahren unter der Lupe: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Ablauf des ELENA-Verfahrens, die beteiligten Akteure (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Leistungsgewährende Stellen, Trustcenter), und den Aufbau des multifunktionalen Verdienstdatensatzes. Es beleuchtet den bisherigen Ablauf und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Der Schwerpunkt liegt auf der technischen Funktionsweise und den verschiedenen Rollen der Beteiligten im Verfahren, um ein umfassendes Verständnis des Systems zu vermitteln.
Kritik am ELENA-Verfahren: Dieser Abschnitt befasst sich kritisch mit verschiedenen Aspekten des ELENA-Verfahrens. Es werden die Freiwilligkeit der Einwilligung, die Ausweitung durch Gesetzgebung, Sicherheitsaspekte (Datenverlust, menschliches Fehlverhalten), wirtschaftliche Belastungen für Arbeitgeber (insbesondere KMUs) und die Datenschutzproblematik ausführlich diskutiert. Die Kapitelteile verknüpfen die einzelnen Kritikpunkte und stellen ihre Bedeutung im Gesamtzusammenhang des ELENA-Verfahrens heraus.
Schlüsselwörter
ELENA-Verfahren, elektronischer Entgeltnachweis, E-Government, Datenschutz, Verfassungsrecht, Wirtschaftlichkeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Sicherheit, Datenschutzrecht, Modellversuch, Gesetzgebung, Trustcenter, KMUs.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Das elektronische Entgeltnachweisverfahren (ELENA)
Was ist das Ziel dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit analysiert das elektronische Entgeltnachweisverfahren (ELENA) im deutschen E-Government. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen des Verfahrens im Spannungsfeld zwischen ökonomischen Erwartungen und rechtlichen Determinanten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Problematik des bisherigen Bescheinigungswesens, die Funktionsweise und den Ablauf von ELENA, die datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekte, wirtschaftliche Auswirkungen und Kritikpunkte sowie zukünftige Herausforderungen und Perspektiven für ELENA.
Welche Probleme des bisherigen Bescheinigungswesens werden angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet Defizite des alten Systems wie Eingriffe in die Rechte von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie unzureichende Möglichkeiten der Nachkontrolle. Konkrete Probleme, die durch das veraltete System entstanden sind, werden detailliert dargestellt.
Wie funktioniert das ELENA-Verfahren?
Das Kapitel "Das ELENA-Verfahren unter der Lupe" beschreibt detailliert den Ablauf, die beteiligten Akteure (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Leistungsgewährende Stellen, Trustcenter) und den Aufbau des multifunktionalen Verdienstdatensatzes. Der bisherige Ablauf wird erläutert und zukünftige Entwicklungen werden in Aussicht gestellt.
Welche Akteure sind am ELENA-Verfahren beteiligt?
Am Verfahren beteiligt sind Arbeitgeber, Arbeitnehmer, leistungsgewährende/abrufende Stellen und Trustcenter/Zertifizierungsdienstanbieter. Die jeweiligen Rollen und Aufgaben der Beteiligten werden detailliert beschrieben.
Welche Kritikpunkte am ELENA-Verfahren werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert kritisch die Freiwilligkeit der Einwilligung, die Ausweitung durch Gesetzgebung, Sicherheitsaspekte (Datenverlust, menschliches Fehlverhalten), wirtschaftliche Belastungen für Arbeitgeber (insbesondere KMU) und die Datenschutzproblematik.
Welche datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht ELENA im Lichte des Volkszählungsurteils, der BVerfG-Entscheidung zur BND-Telekommunikationsüberwachung und der jüngsten BVerfG-Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung. Die Zweckbindung der Verfahrensdaten, Datenvermeidung und -sparsamkeit sowie die fehlende Transparenz für Beschäftigte werden ebenfalls analysiert.
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen und Kritikpunkte werden betrachtet?
Die wirtschaftliche Kritik umfasst das Risiko für Arbeitgeber bei Ablösung der Bescheinigungspflicht, die Auswirkungen auf KMU und den finanziellen Aspekt des Verfahrens.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung der Kapitel "Hintergründe zur Einführung des ELENA-Verfahrens", "Das ELENA-Verfahren unter der Lupe" und "Kritik am ELENA-Verfahren", welche die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse jedes Kapitels hervorhebt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: ELENA-Verfahren, elektronischer Entgeltnachweis, E-Government, Datenschutz, Verfassungsrecht, Wirtschaftlichkeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Sicherheit, Datenschutzrecht, Modellversuch, Gesetzgebung, Trustcenter, KMU.
- Arbeit zitieren
- Michel Kirsche (Autor:in), 2010, Quo vadis ELENA- Verfahren?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162312