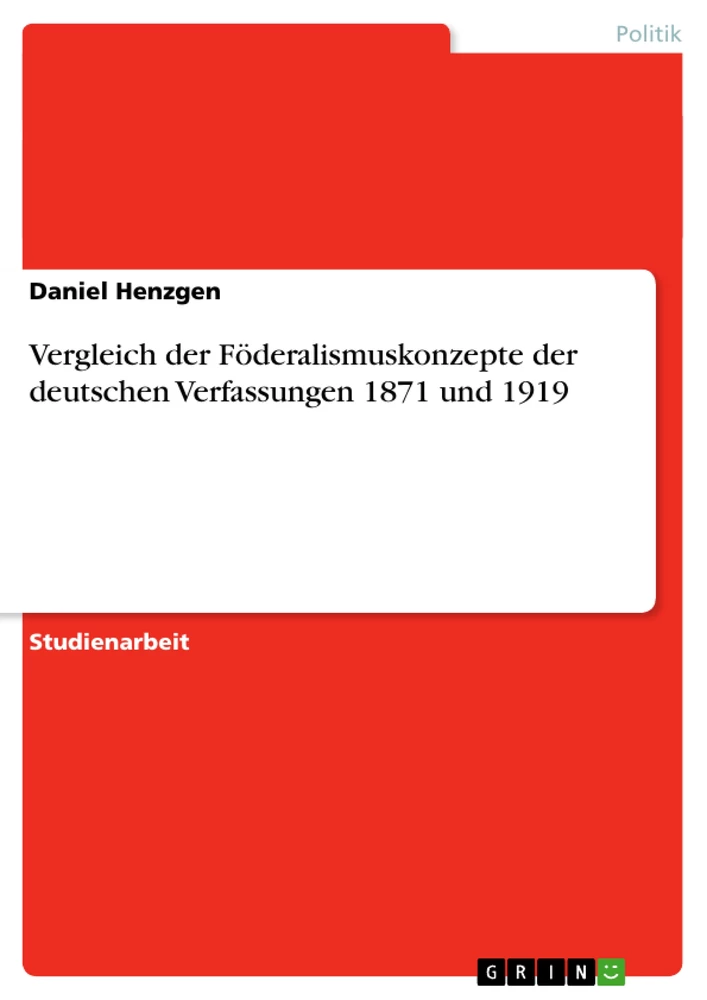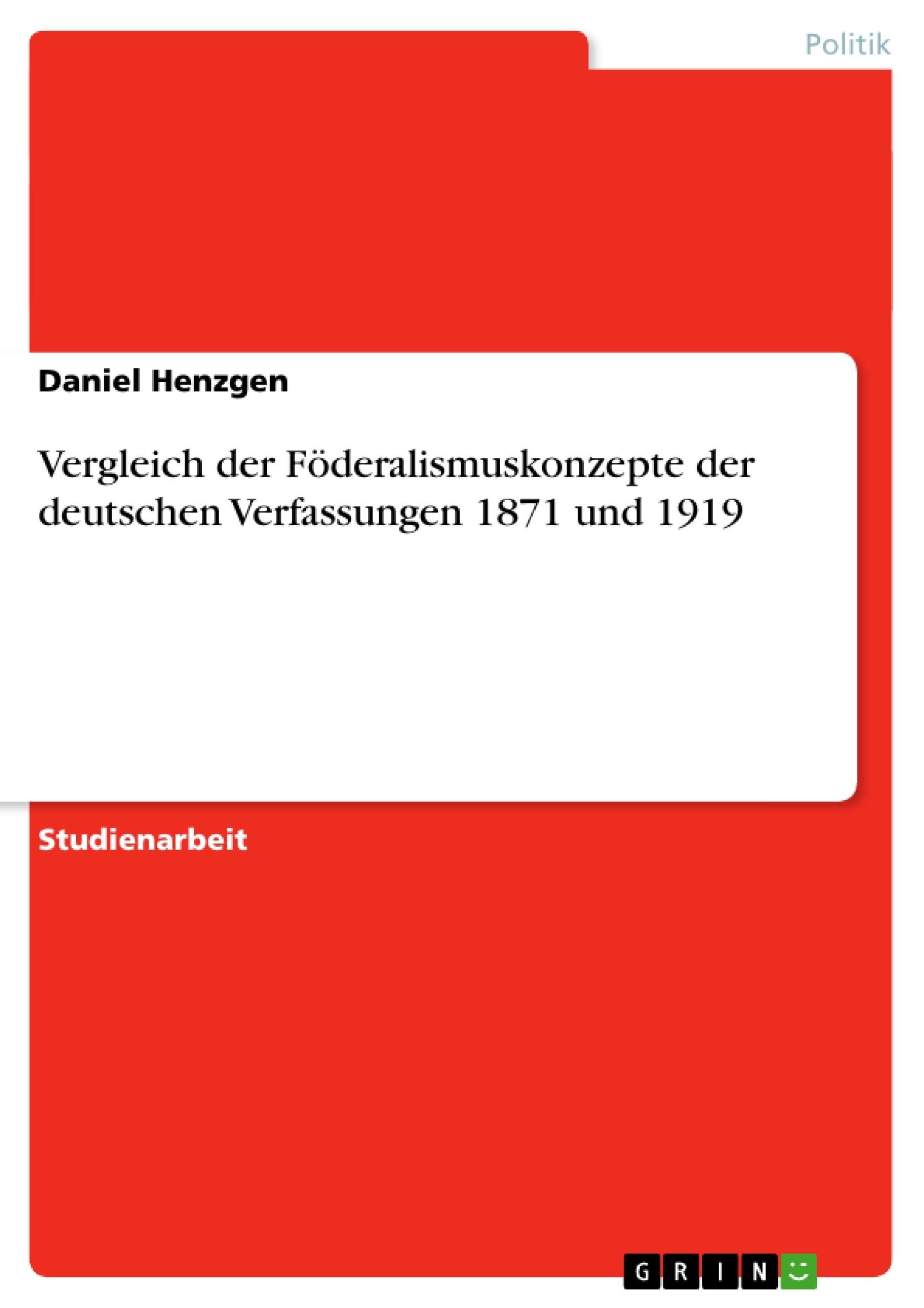Der Zustand und die Reform des deutschen Föderalismus sind immer wieder auf der
politischen Tagesordnung gewesen. Gerade in den letzten Jahren wurde eine breite
Diskussion über seine Leistungsfähigkeit geführt. Beispielhaft seien hier die
Blockadevorwürfe im Zusammenhang mit der Steuerreform der Regierung Kohl im
Jahr 1997 und die stark kritisierte Abstimmung im Bundesrat über das
Zuwanderungsgesetz der rot-grünen Bundesregierung Anfang des Jahres 2002
erwähnt.
Nach innen in seiner Ausgestaltung kritisiert, wird der Föderalismus nach außen als
Strukturprinzip einer weiterentwickelten Europäischen Union von vielen deutschen
Politikern empfohlen. Föderalismus ist damit ein sehr aktuelles Thema, auf
nationaler wie auf europäischer Ebene.
Die spezifisch deutschen Erfahrungen mit unterschiedlichen Föderalismuskonzepten
lassen sich meiner Meinung nach sehr gut im Vergleich der Verfassungen des
Deutschen Reiches 1871 und der Weimarer Republik 1919 darlegen. Hierbei wird
ihre gegensätzliche Zielsetzung bei gleichzeitiger Herausstellung ihrer
Gemeinsamkeiten anhand von drei Themenkomplexen veranschaulicht:
1. Der Bundesrat/Reichsrat
2. Die Kompetenzverteilung bei Gesetzgebung und Verwaltung
3. Die Finanzverfassung
Nach einer kurzen historischen Einleitung zu einer Verfassung werden die drei
aufgeführten Bereiche bearbeitet. Am Ende dieser Arbeit steht die Beantwortung der
Frage, inwieweit das Föderalismuskonzept der Weimarer Republik ein Gegenentwurf
zu demjenigen des Deutschen Reiches war.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Inhalt und Aufbau der Arbeit
- 2. Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871
- 2.1 Historische Einleitung
- 2.2 Der Bundesrat
- 2.3 Die Kompetenzverteilung bei Gesetzgebung und Verwaltung
- 2.4 Die Finanzverfassung
- 3. Die Weimarer Reichsverfassung von 1919
- 3.1 Historische Einleitung
- 3.2 Der Reichsrat
- 3.3 Die Kompetenzverteilung bei Gesetzgebung und Verwaltung
- 3.4 Die Finanzverfassung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Föderalismuskonzepte der deutschen Verfassungen von 1871 und 1919. Ziel ist es, die gegensätzlichen Zielsetzungen beider Verfassungen aufzuzeigen und gleichzeitig ihre Gemeinsamkeiten herauszustellen. Der Fokus liegt auf der Analyse dreier zentraler Themenkomplexe, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Föderalismusmodelle zu beleuchten.
- Der Bundesrat/Reichsrat
- Die Kompetenzverteilung bei Gesetzgebung und Verwaltung
- Die Finanzverfassung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Inhalt und Aufbau der Arbeit: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und begründet die Wahl des Vergleichs der Verfassungen von 1871 und 1919 zur Untersuchung des deutschen Föderalismus. Es werden aktuelle Debatten um den deutschen Föderalismus angesprochen und die drei zentralen Themenkomplexe (Bundesrat/Reichsrat, Kompetenzverteilung, Finanzverfassung) als Untersuchungsgegenstände benannt. Die Arbeit verfolgt das Ziel, den Grad der Gegenläufigkeit des Föderalismuskonzepts der Weimarer Republik im Vergleich zum Deutschen Reich zu ermitteln.
2. Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Betrachtung der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871. Die historische Einleitung beschreibt den Entstehungsprozess, die Rolle Bismarcks und die „kleindeutsche Lösung“. Es wird deutlich, dass die Verfassung nicht eine Neuschöpfung war, sondern auf der Verfassung des Norddeutschen Bundes aufbaute und durch „Reservatsrechte“ für süddeutsche Staaten angepasst wurde. Diese Anpassungen betrafen vor allem die Post- und Heeresverwaltung sowie die Veto-Möglichkeiten bei Verfassungsänderungen. Der Fokus liegt auf der Erläuterung der politischen Machtkonstellation und den damit verbundenen Implikationen für das föderale System.
2.2 Der Bundesrat: Dieser Abschnitt analysiert die Struktur und Funktion des Bundesrates im Deutschen Reich von 1871. Die Analyse konzentriert sich auf dessen Charakter als Exekutivorgan, die Stimmverteilung zugunsten Preußens und die daraus resultierende faktische Vormachtstellung Preußens im Bundesrat. Die Abhängigkeiten der kleineren Staaten von Preußen werden erläutert, und die Bedeutung der Veto-Möglichkeiten Preußens bei Verfassungsänderungen wird hervorgehoben. Die Rolle der preußischen Staatsbahn im Kontext der Abhängigkeiten wird ebenfalls diskutiert.
Schlüsselwörter
Föderalismus, Deutsches Reich, Weimarer Republik, Verfassung 1871, Verfassung 1919, Bundesrat, Reichsrat, Kompetenzverteilung, Finanzverfassung, Bismarck, Preußen, Reichsgründung, klein- und großdeutsche Lösung.
FAQ: Vergleich der Föderalismuskonzepte der deutschen Verfassungen von 1871 und 1919
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Föderalismuskonzepte der deutschen Verfassungen von 1871 (Deutsches Reich) und 1919 (Weimarer Republik). Sie analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme anhand dreier zentraler Themen: den Bundesrat/Reichsrat, die Kompetenzverteilung bei Gesetzgebung und Verwaltung sowie die Finanzverfassung. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu beiden Verfassungen, ein Fazit und ein Glossar wichtiger Begriffe.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die gegensätzlichen Zielsetzungen der Verfassungen von 1871 und 1919 aufzuzeigen und gleichzeitig ihre Gemeinsamkeiten herauszustellen. Der Fokus liegt auf der Analyse der drei genannten Themenkomplexe, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der jeweiligen Föderalismusmodelle zu beleuchten und den Grad der Gegenläufigkeit des Föderalismuskonzepts der Weimarer Republik im Vergleich zum Deutschen Reich zu ermitteln.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Inhalt und Aufbau der Arbeit; 2. Die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 (mit Unterkapiteln zu historischer Einleitung, Bundesrat, Kompetenzverteilung und Finanzverfassung); 3. Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 (mit analogen Unterkapiteln); 4. Fazit.
Was wird im Kapitel zur Verfassung von 1871 behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Entstehungsprozess der Verfassung von 1871, die Rolle Bismarcks und die „kleindeutsche Lösung“. Es analysiert die Verfassung als Weiterentwicklung des Norddeutschen Bundes, die Anpassungen für süddeutsche Staaten (insbesondere bei Post, Heer und Verfassungsänderungen) und die politische Machtkonstellation mit ihren Auswirkungen auf das föderale System. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Bundesrat.
Was wird im Kapitel zum Bundesrat (1871) behandelt?
Dieser Abschnitt analysiert die Struktur und Funktion des Bundesrates im Deutschen Reich von 1871. Schwerpunkte sind dessen Charakter als Exekutivorgan, die Stimmverteilung zugunsten Preußens, die daraus resultierende preußische Vormachtstellung, die Abhängigkeiten kleinerer Staaten von Preußen und die Bedeutung des preußischen Vetos bei Verfassungsänderungen. Die Rolle der preußischen Staatsbahn im Kontext der Abhängigkeiten wird ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Föderalismus, Deutsches Reich, Weimarer Republik, Verfassung 1871, Verfassung 1919, Bundesrat, Reichsrat, Kompetenzverteilung, Finanzverfassung, Bismarck, Preußen, Reichsgründung, klein- und großdeutsche Lösung.
Welche Themenkomplexe stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf drei zentrale Themenkomplexe: den Bundesrat/Reichsrat, die Kompetenzverteilung bei Gesetzgebung und Verwaltung und die Finanzverfassung.
- Quote paper
- Daniel Henzgen (Author), 2002, Vergleich der Föderalismuskonzepte der deutschen Verfassungen 1871 und 1919, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16226