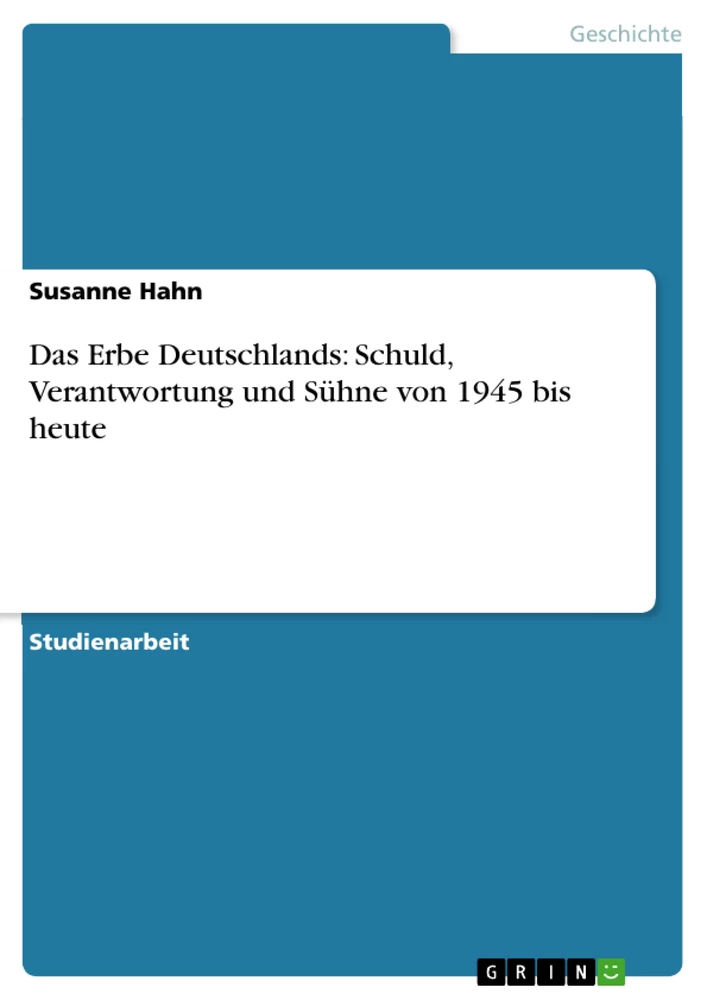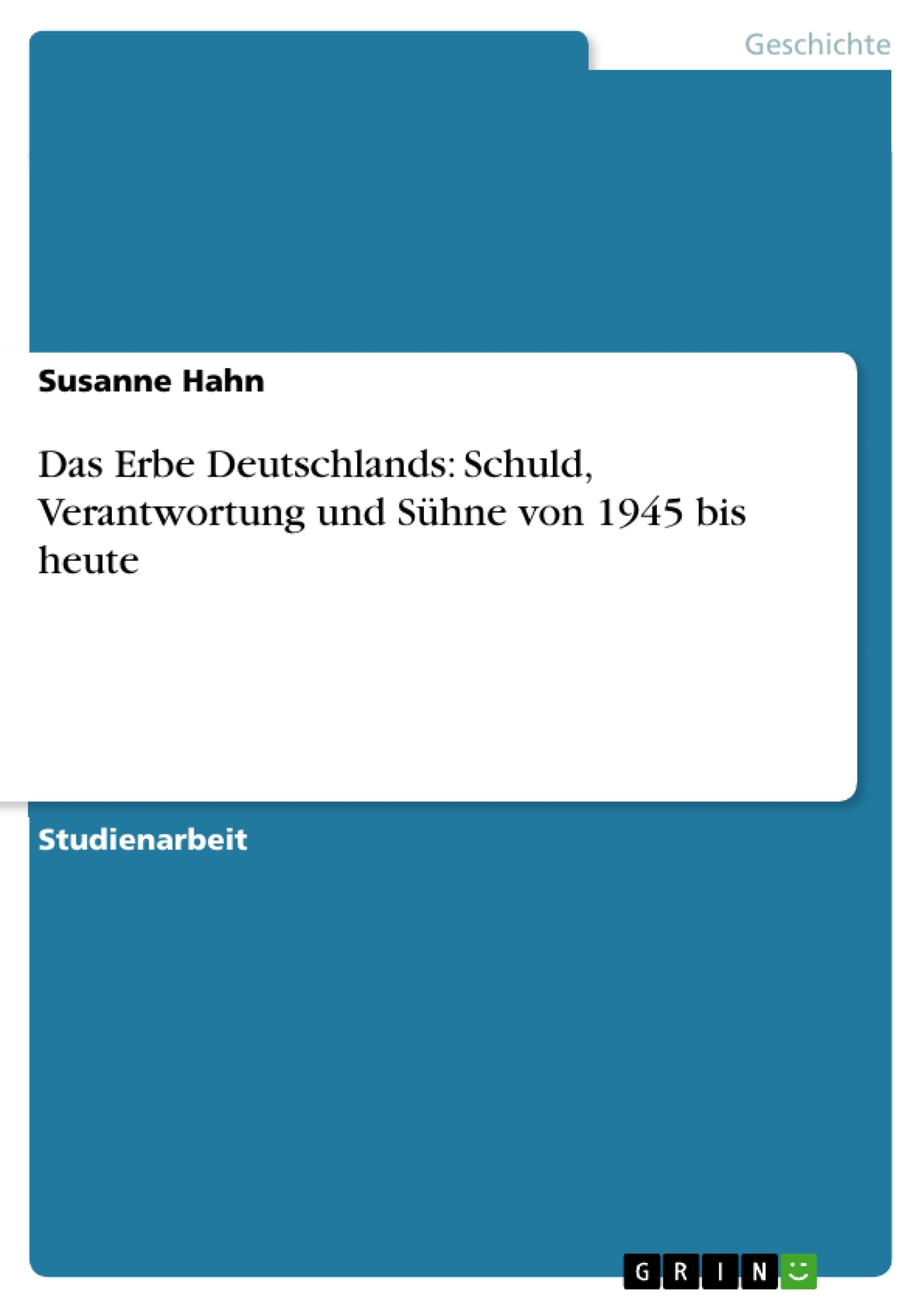Die Schuldfrage und die Frage nach der Verantwortung in einer Handlung spielen schon seit Menschengedenken eine wesentliche Rolle in dem Leben und Zusammenleben der Menschen. Doch was ist Schuld? Schuld oder die Frage nach der Schuld entsteht immer erst dann, wenn eine Tat ausgeführt wird, bei der ein anderes Lebewesen oder das Eigentum einer Person zu Schaden kommt. In keinem Punkt unserer Menschheitsgeschichte wurden die Menschen schwerer geschädigt und ihrer Würde beraubt, als durch die Taten im Nationalsozialismus.
Nachdem der Zweite Weltkrieg und damit der Nationalsozialismus beendet wurden, war es an der Zeit gewesen die Gerechtigkeit zu fördern und die Schuldigen für all jene menschenunwürdigen Taten zu bestrafen. Doch plötzlich lösten sich jene überzeugten Nationalsozialisten, aus Angst vor juristischer Verfolgung und Bestrafung für ihre Taten, in Luft auf und der Schrei „Wir sind nie Nazis gewesen!“ oder „Die anderen haben auch Verbrechen begangen“ schallte durch das Land. Als Hitlerdeutschland kapitulierte, verschwanden die Schuldigen plötzlich und waren sich ihrer Schuld nicht mehr bewusst. Stattdessen vergaßen und ignorierten sie das Geschehene des Nationalsozialismus und suchten die Schuld für die Taten gegen Millionen von Menschen bei anderen. Bei Diskussionen über die Schuldfrage im Nationalsozialismus ertönt oft die Aussage, dass ganz Deutschland aus der Sicht der Welt einer kollektiven Schuld unterlag bzw. unterliegt, doch ist es tatsächlich so gewesen? Lud ein ganzes Land Schuld auf sich? Aber wenn nicht, wer oder welche Gruppen gehörten zu den Schuldigen der Zeit und wie tat das Land Buße, um in der Welt wieder einen Platz einnehmen und versuchen zu können, Verantwortung zu tragen und zu entschädigen?
Wird den neugeborenen Generationen in unserer Gegenwart, knapp über sechzig Jahre nach Kriegsende, Schuld zugewiesen und welche Verantwortung besitzen die Kinder und Kindeskinder aufgrund der Taten bis weit in die Zukunft hinein?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Erbe Deutschlands: Schuld, Verantwortung und Sühne von 1945 bis heute
- Die Geschehnisse im Nationalsozialismus
- Die Schuldfrage
- Die verschiedenen Arten der Schuld
- Die Träger der Schuld
- Entschuldigungsstrategien und das Verdrängen der Schuld
- Entnazifizierung und Sühne
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage nach der deutschen Schuld, Verantwortung und Sühne nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie untersucht die Geschichte des Nationalsozialismus und die Folgen für Deutschland und die Welt.
- Die Geschehnisse im Nationalsozialismus und die Entstehung der NS-Herrschaft
- Die Frage nach der Schuld und deren verschiedene Arten
- Entschuldigungsstrategien und die Verdrängung der Schuld in der deutschen Gesellschaft
- Die Entnazifizierung und die Bemühungen um Sühne
- Die Frage nach der Verantwortung der Nachkriegsgenerationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung der Schuldfrage im Kontext des menschlichen Zusammenlebens und stellt den Nationalsozialismus als ein beispielloses Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.
Kapitel 2.1 beschreibt die Entwicklung der NS-Herrschaft von der Ernennung Hitlers zum Führer der NSDAP bis zum Erlass des Ermächtigungsgesetzes, das den Nationalsozialisten uneingeschränkte Macht verlieh. Es werden die wichtigsten Ereignisse und Personen, wie Adolf Hitler, Hindenburg und das Ermächtigungsgesetz, erläutert.
Kapitel 2.2 widmet sich der Schuldfrage und untersucht die verschiedenen Arten von Schuld, die im Kontext des Nationalsozialismus relevant sind. Es werden die Träger der Schuld, wie Einzelpersonen, Institutionen und die deutsche Gesellschaft insgesamt, analysiert.
Kapitel 2.3 beleuchtet die verschiedenen Entschuldigungsstrategien, die in der deutschen Nachkriegsgesellschaft eingesetzt wurden, um die Schuld zu verdrängen oder herunterzuspielen. Es wird die Frage nach der individuellen und kollektiven Verantwortung für die NS-Verbrechen diskutiert.
Kapitel 2.4 befasst sich mit der Entnazifizierung und den Bemühungen um Sühne in Deutschland. Es werden die verschiedenen Methoden der Entnazifizierung, die Rolle der Alliierten und die Frage nach der Wirksamkeit dieser Maßnahmen betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet zentrale Themen wie Nationalsozialismus, Schuld, Verantwortung, Sühne, Entnazifizierung, kollektive Schuld, individuelle Verantwortung und die deutsche Geschichte nach 1945. Weitere wichtige Begriffe sind: Ermächtigungsgesetz, Ausnahmezustand, Grundrechte, Völkermord, Konzentrationslager, NS-Ideologie, Verdrängung und Erinnerungskultur.
- Quote paper
- Susanne Hahn (Author), 2010, Das Erbe Deutschlands: Schuld, Verantwortung und Sühne von 1945 bis heute, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162206