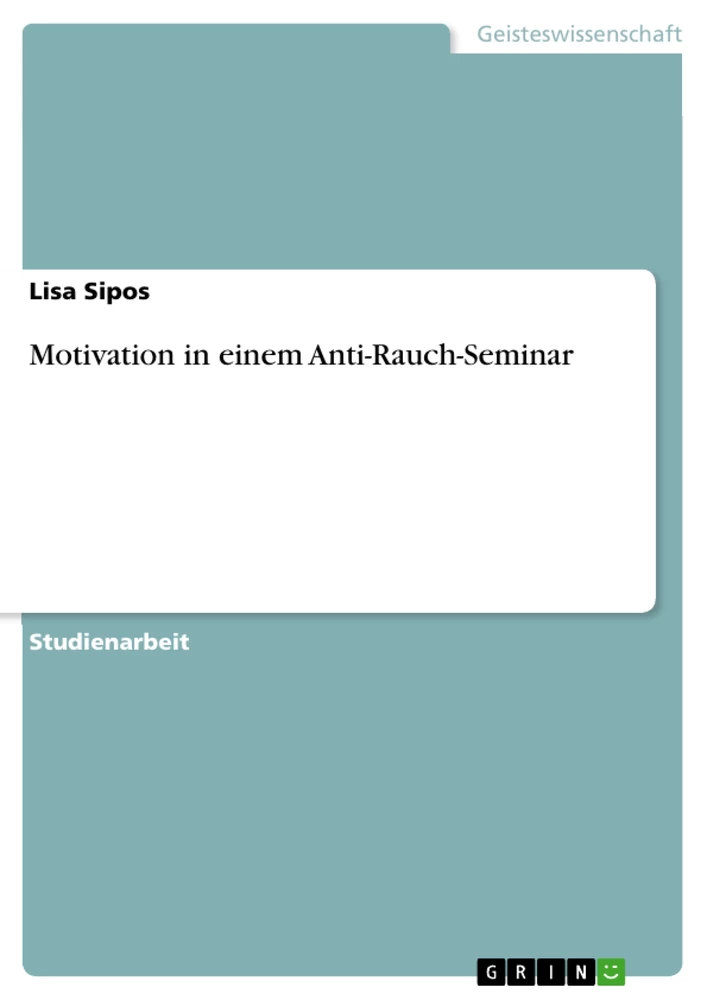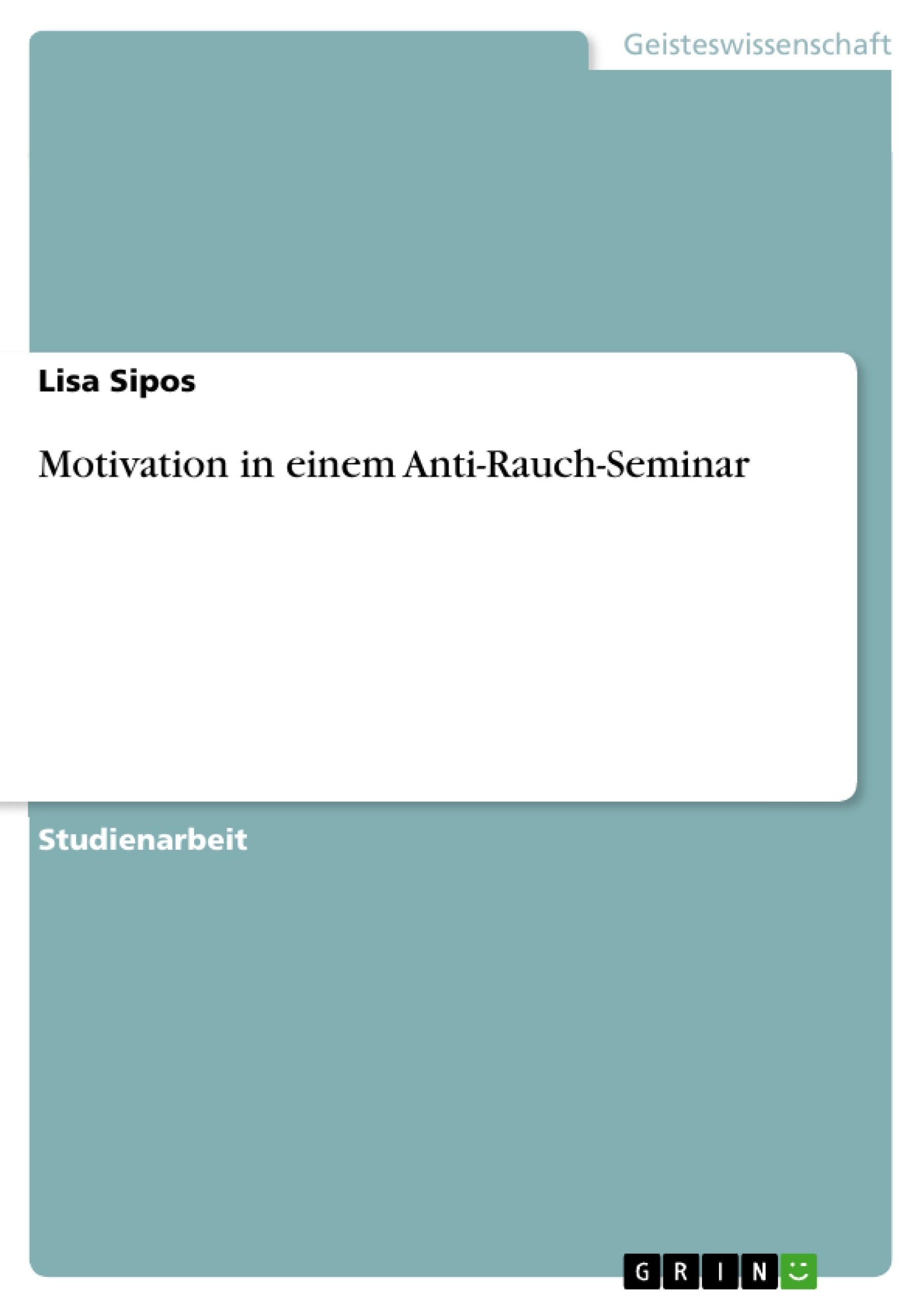„Ich höre auf zu Rauchen“ – ist ein Entschluss, den sich viele Raucher schon mehrmals in ihrem Leben gesetzt haben. Doch in vielen Fällen, ist das Ziel des Nichtrauchens nicht erreicht worden. Das Abgewöhnen des Tabakkonsums ist eine meist langwierige Angelegenheit, für die es jede Menge Ausdauer und Motivation bedarf.
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit verschieden motivationsfördernden Faktoren, die anschließend auf die Leistung des Entwöhnens übertragen werden sollen. Zunächst werden die Begriffe Motivation und Motiv erläutert, das Risikowahl-Modell von Atkinson vorgestellt, um den Moment der Motivierung zu verdeutlich, und auf Kausalattributionen von Erfolg bzw. Misserfolg und die Selbstbewertung eingegangen. Anschließend wird das erweiterte Motivationsmodell von Heckhausen vorgestellt und Theorien zur Selbstwirksamkeit, zu Bezugsnormen der Leistungsbewertung, intrinsischer und extrinsischer Motivation, dem Flow-Erleben, der Selbstbestimmung und Zielen und Interessen. Anhand dieser Theorien werden Einheiten eines Anti-Rauch-Seminars vorgestellt, die helfen sollen, eine anhaltende Motivation zur Entwöhnung aufrecht zu erhalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation und Personenmerkmal Motiv
- Risikowahlmodell
- Ursachenerklärung von Erfolg und Misserfolg
- Selbstbewertung
- Das erweiterte kognitive Motivationsmodell von Heckhausen
- Selbstwirksamkeit
- Bezugsnormen der Leistungsbewertung
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Selbstbestimmungstheorie
- Ziele und Interessen
- Fördereinheit
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit motivationsfördernden Faktoren im Kontext eines Anti-Rauch-Seminars. Ziel ist es, verschiedene Theorien der Motivationspsychologie zu beleuchten und ihre Relevanz für die Förderung von dauerhafter Rauchentwöhnung aufzuzeigen.
- Motivation und Motiv als Personenmerkmal
- Das Risikowahlmodell von Atkinson
- Kausalattributionen von Erfolg und Misserfolg
- Selbstwirksamkeit und Bezugsnormen der Leistungsbewertung
- Intrinsische und extrinsische Motivation sowie Selbstbestimmungstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Schwierigkeit des Rauchens aufzugeben und skizziert die Themen, die in der Hausarbeit behandelt werden.
- Motivation und Personenmerkmal Motiv: In diesem Kapitel werden die Begriffe Motivation und Motiv definiert und verschiedene Grundtendenzen wie Machtmotiv, Leistungsmotiv und Anschlussmotiv erläutert.
- Risikowahlmodell: Dieses Kapitel stellt das Modell von Atkinson vor, das erklärt, wie Motivation durch Anreize des Erfolgs, Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und Aufgabenschwierigkeit angeregt wird.
- Ursachenerklärung von Erfolg und Misserfolg: Hier werden die Theorien zu Kausalattributionen, Selbstbewertung und dem erweiterten kognitiven Motivationsmodell von Heckhausen behandelt.
- Selbstwirksamkeit: In diesem Kapitel werden die Konzepte der Selbstwirksamkeit, Bezugsnormen der Leistungsbewertung und die Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation diskutiert.
- Selbstbestimmungstheorie: Dieser Abschnitt beleuchtet die Selbstbestimmungstheorie und erklärt, wie Ziele und Interessen zur Motivation beitragen können.
- Fördereinheit: Dieses Kapitel enthält Vorschläge für Einheiten in einem Anti-Rauch-Seminar, die die Motivation zur Entwöhnung fördern können.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Motivation, Motiv, Risikowahlmodell, Kausalattribution, Selbstwirksamkeit, Bezugsnormen der Leistungsbewertung, intrinsische und extrinsische Motivation, Selbstbestimmung, Ziele und Interessen im Kontext eines Anti-Rauch-Seminars.
- Quote paper
- Lisa Sipos (Author), 2010, Motivation in einem Anti-Rauch-Seminar, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162194