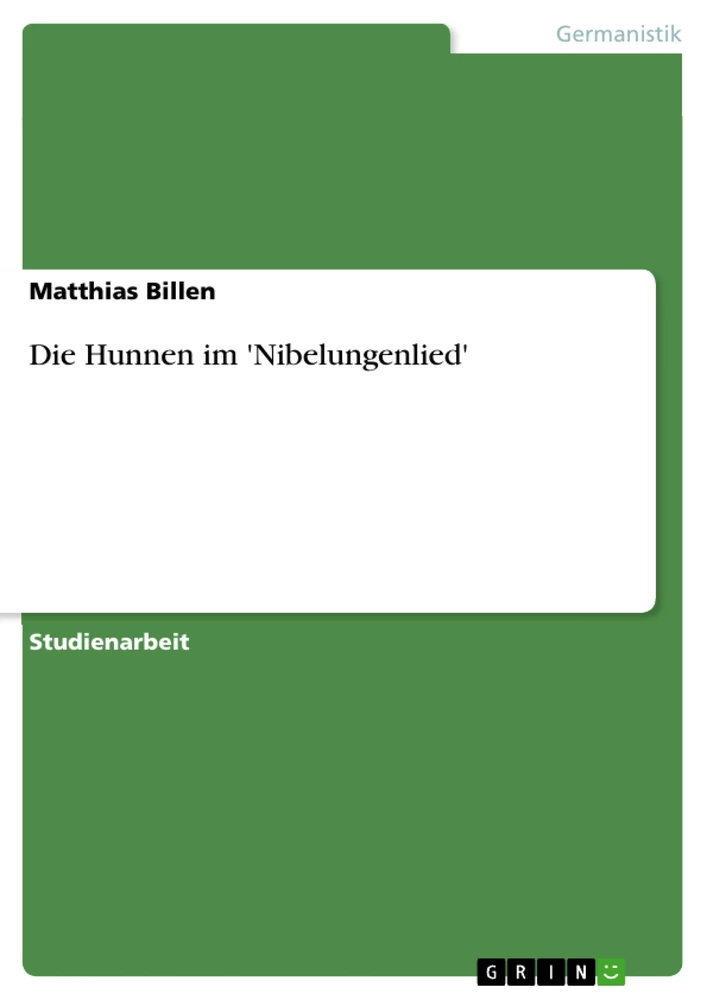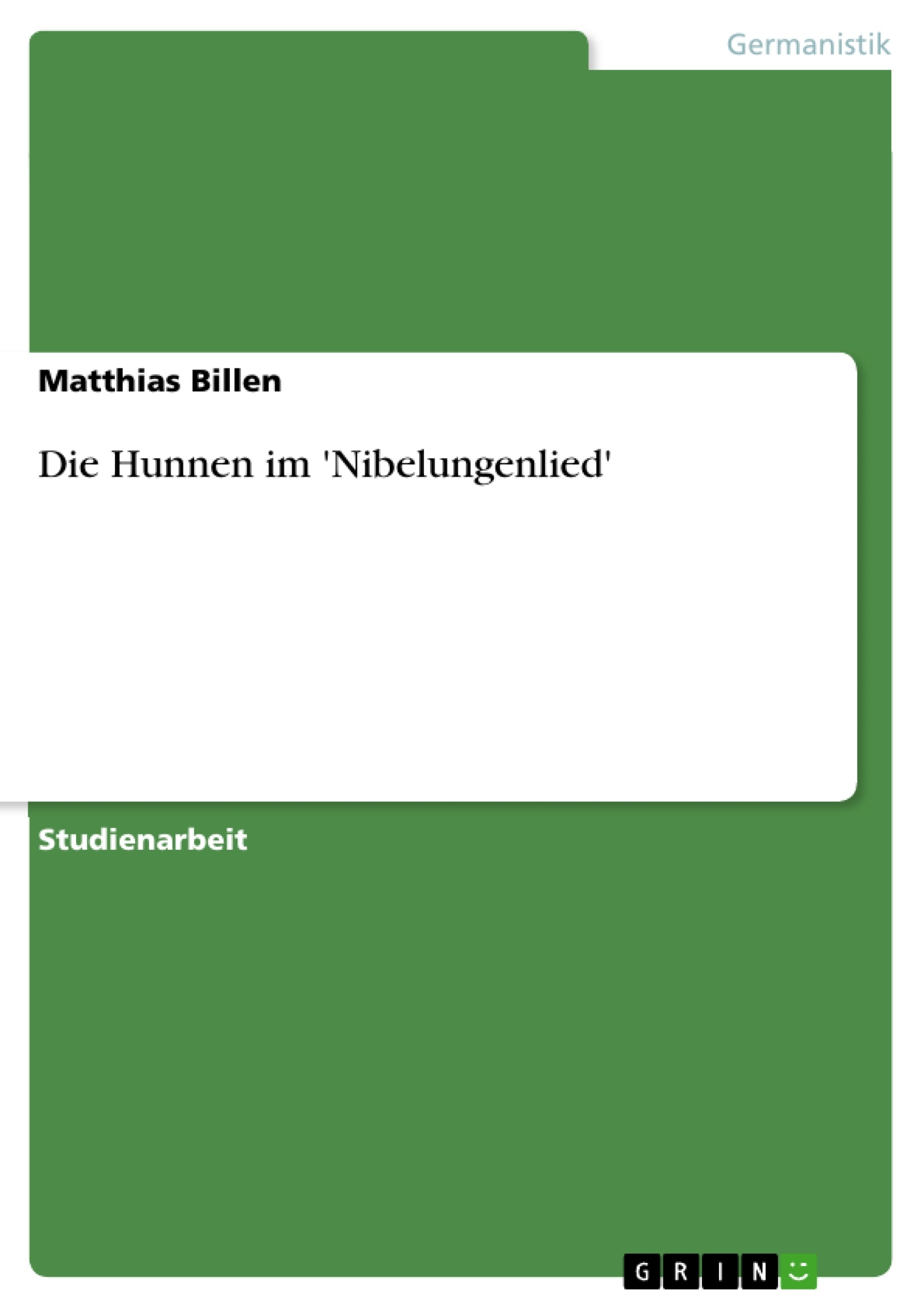„Attila der Hunne“ stellt noch heute einen Ausdruck dar, welcher für den Hörer negative Assoziationen hervorruft. Oftmals wird damit ein Kriegerkönig oder ein mächtiger Herr-scher über ein riesiges Reich verbunden, welcher seine Schlachten gnadenlos führt und kein Erbarmen zeigt. Dies sind jedoch tendenziell subjektive Einschätzungen, welche es nicht er-möglichen, den Hunnenkönig Attila normativ oder psychologisch einzuordnen. Ebenso verhält es sich mit dem gesamten Volk der Hunnen, welches gleichermaßen bei ober-flächlicher und unreflektierter Betrachtung als wildes Steppenvolk betrachtet wird. „Attila (…), der mächtige Oberherr, der keine Macht neben sich, sondern nur unter sich duldet“, wurde im Jahre 453 n.Chr. geboren und war Herrscher über das Reich der Hunnen, dessen Herrschaftszentrum in heutigen Ungarn lag. Es ist von einem Herrscher auszugehen, welcher durch taktisches Geschick bzw. sinnstiftendes Delegieren von Herrschaftsaufträgen ein funktionierendes System um sich herum aufgebaut hat. Ohne eine klare Kompetenz-verteilung mit Attila im Zentrum war ein solches Reich nicht zu regieren. „The great king of the Huns, to western civilization the personification of wanton destruction“, ist historisch als Potentat zu betrachten, der seinen Machtbereich stetig vergrößerte und für die westliche Zivilisation eine existenzielle Bedrohung darstellte. Der mittelalterliche Historiker Jordanes berichtet von ihm als „most savage tyrant and conqueror of the whole earth“, ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich keineswegs um einen seinen Feinden gegenüber wohl-wollenden Monarchen handelte. Die Darstellungen in mittelalterlichen Chroniken – „usually as terror to Christendom“ – greifen Attila letztlich als anti-christliche Instanz auf, welcher durch sein Heidentum dem christlichen Weltbild entgegenstand.
Grundlage dieser Arbeit sollen das Nibelungenlied (NL) sowie die Nibelungenklage (KL) sein, welche die Person Attilas als „Etzel“ aufgreifen und ihn gemäß der historischen Figur als Hunnenkönig in ihre Handlung aufnehmen. Etzel heiratet in den literarischen Werken die Burgunderin Kriemhild, die durch Hagens Mord an ihrem Ehemann Siegfried verwitwet wird und in der Heirat mit dem heidnischen König eine Chance sieht, den Meuchelmord an ihrem ersten Gatten zu rächen. Infolge ihres Verlangens nach Rache werden alle burgun-dischen Verwandten und wichtige hunnische Lehnsleute getötet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die Hunnen
- 1.1 Struktur des „Hiunen lant“
- 1.2 Hunnen als mutige Krieger?
- 1.3 Einzelindividualität im Hunnenreich
- 2. Der Herrscher
- 2.1 „Etzel der rîche“ als König eines literarischen Reiches
- 2.1.1 Einladung und Empfang der Burgunder
- 2.1.2 Akteur während des Burgundenuntergangs
- 2.1.3 Der klagende Monarch
- 2.2 König mit Privatleben
- 2.2.1,,Helche diu vil rîche“
- 2.2.2. Kriemhilt als neue Königin
- 2.1 „Etzel der rîche“ als König eines literarischen Reiches
- 3. Verhältnis der Hunnen zum Christentum
- 1. Die Hunnen
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Hunnen und ihres Königs Attila (alias Etzel) im Nibelungenlied und der Nibelungenklage. Im Fokus steht die Frage, ob die literarischen Werke ein ähnliches Bild von Attila und seinem Volk zeichnen wie die historischen Quellen, die ihn oft als machtvollen und brutalen Herrscher beschreiben. Zudem werden die Beziehungen zwischen Hunnen und Christentum sowie Etzels Charakter und seine Rolle innerhalb seines Reiches analysiert.
- Die Darstellung der Hunnen im Nibelungenlied und der Nibelungenklage im Vergleich zu historischen Quellen
- Das Verhältnis von Hunnen und Christentum in den literarischen Werken
- Die Charakterisierung von Attila als "Etzel" im Nibelungenlied und in der Nibelungenklage
- Die Struktur des Hunnenreiches und die Rolle der einzelnen Personen im Herrschaftsgefüge
- Die religiösen und politischen Implikationen des Zusammenlebens von Hunnen und anderen Völkern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext dar und führt in die Forschungsfrage ein, welche die Darstellung der Hunnen und ihres Königs Attila im Nibelungenlied und der Nibelungenklage untersucht. Anschließend wird im Hauptteil zunächst die Struktur des Hunnenreiches im Nibelungenlied analysiert, um die Machtposition von Attila im Verhältnis zu seinen Vasallen und seinen Einfluss auf die anderen Völker zu verdeutlichen. Im weiteren Verlauf wird die Darstellung der Hunnen als Krieger im Nibelungenlied beleuchtet und mit historischen Quellen verglichen. Abschließend wird die Persönlichkeit von Attila als "Etzel" und sein Verhältnis zum Christentum näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Nibelungenlied, Nibelungenklage, Hunnen, Attila, Etzel, Christentum, Heidentum, Macht, Herrschaft, Krieger, Literatur, Geschichte.
- Quote paper
- Matthias Billen (Author), 2007, Die Hunnen im 'Nibelungenlied', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162172