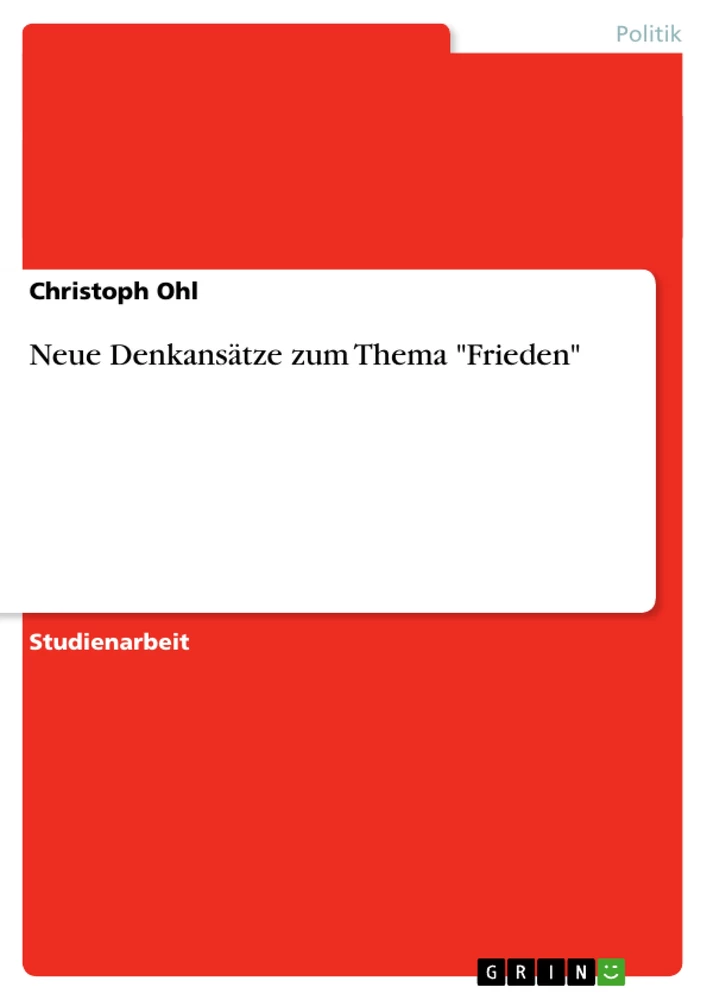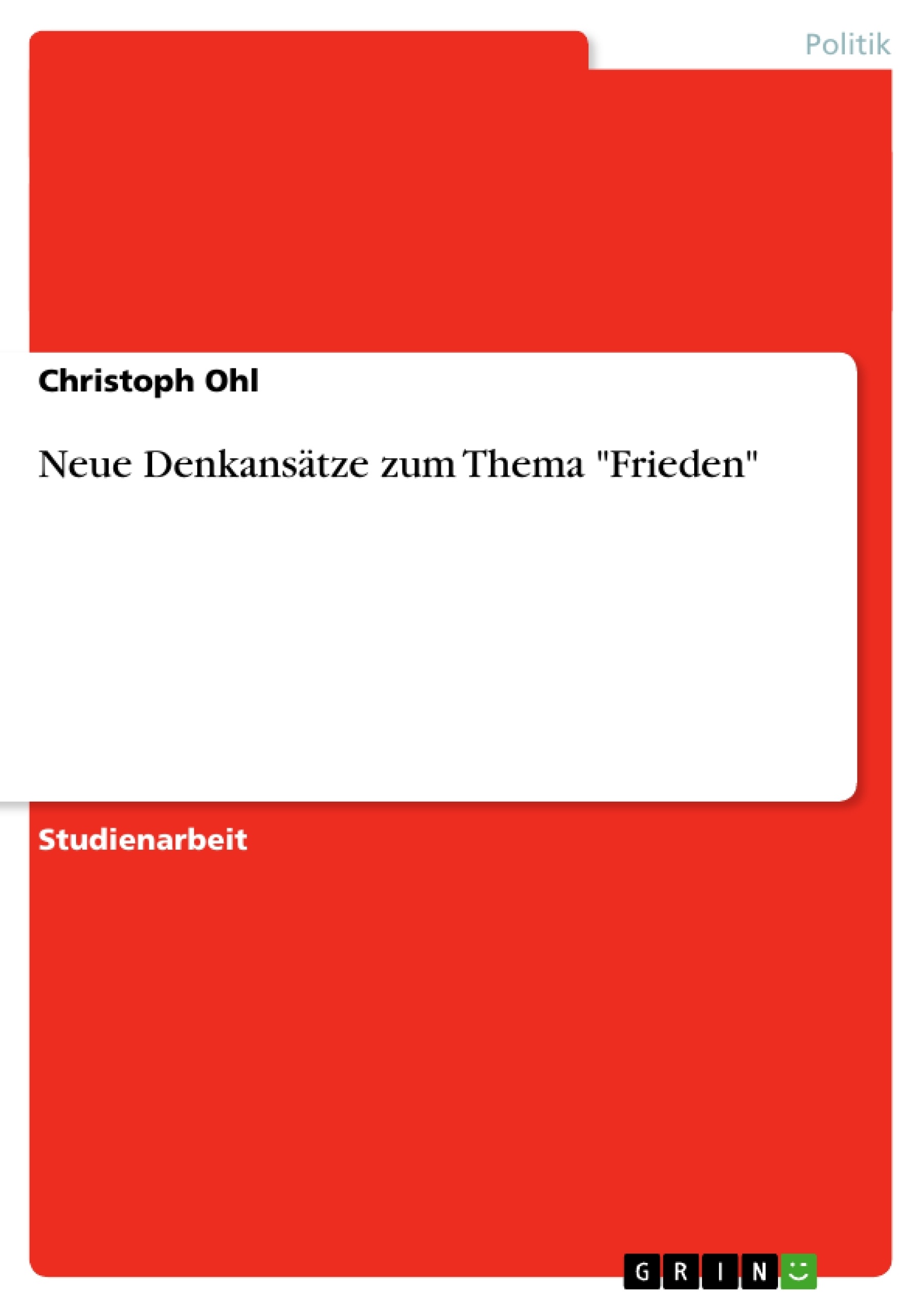[...] Vor diesem Hintergrund steht die Friedens- und Konfliktforschung vor neuen
Aufgaben. So muss z.B. anerkannt werden, dass Kriege nicht mehr allein unter
souveränen Staaten stattfinden, sondern immer häufiger zwischen Staaten und
privaten Akteuren, wie es in der jüngeren Vergangenheit im Kampf der westlichen
Allianz gegen den Terrorismus der Fall ist. Somit sind einige Theorien, bezüglich der
Erzielung und Sicherung des Friedens im internationalen System, überholt, wie
beispielsweise die realistische Ansicht, dass Frieden im internationalen System durch
ein Machtgleichgewicht zwischen souveränen Staaten zu Stande kommen kann. Die
Friedens- und Konfliktforschung muss sich diesen veränderten Sachlagen stellen.
In dieser soll versucht werden, neue Denkansätze zum Thema „Frieden“ zu
diskutieren.
Hierzu wird zunächst eine ausführliche Begriffsbestimmung vorgenommen, in der
Frieden aus zweierlei Perspektive betrachtet wird. In der ersten Perspektive wird
Frieden als ein Zustand gesehen. Die zweite Perspektive sieht Frieden als einen
Prozess.
In einem nächsten Schritt werden Friedensursachen diskutiert. Hierbei wird zunächst
auf allgemeine Friedensursachen eingegangen. Danach werden Friedensursachen
aus Sicht der drei Großtheorien der Internationalen Beziehungen (Realismus,
Liberalismus und Konstruktivismus) begutachtet.
4
Als Drittes soll der häufig diskutierte Zusammenhang zwischen demokratischen
Herrschaftsformen und Frieden noch einmal kurz reflektiert werden, insbesondere
vor dem Hintergrund, ob Demokratie einen friedensfördernden Beitrag leisten kann.
Zum Abschluss wird der Versuch unternommen, inwieweit ein Weltstaat, bzw.
weltstaatliche Organisationsformen, zur Vermeidung von kriegerischen
Auseinandersetzungen und weiterführend zu einer Sicherung des Friedens auf
globaler Ebene beitragen kann.
Das Thema „Frieden“ ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt in der Literatur
unzählige Schriften zu diesem Thema und nahezu jeder bedeutende Politologe oder
Philosoph hat sich zu diesem Thema geäußert. Diese Arbeit stellt daher nicht den
Anspruch, eine abschließende Stellung zum Thema „Frieden“ zu beziehen. Es sollen
lediglich ausgewählte Aspekte dargestellt und diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Gerechtigkeit als Bestandteil des Friedens
- Frieden als Beziehungsbegriff
- Frieden und Interaktion
- Frieden als Prozess
- Frieden als Zivilisierungsprozess
- Frieden aus Sicht des Zivilisationsprozesses nach Elias
- Friedensursachen
- Realismus, Neorealismus
- Institutionalismus
- Konstruktivismus
- Frieden und Demokratie
- Weltstaat als Garant von Frieden
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit neuen Denkansätzen zum Thema „Frieden“. Sie analysiert den Friedensbegriff aus verschiedenen Perspektiven und untersucht die Faktoren, die zu Frieden führen können. Ziel ist es, das komplexe Thema „Frieden“ in seinen verschiedenen Facetten zu beleuchten und die Relevanz der Friedens- und Konfliktforschung im Kontext globaler Herausforderungen aufzuzeigen.
- Begriffsbestimmung von Frieden als Zustand und als Prozess
- Analyse von Friedensursachen aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven
- Zusammenhang zwischen Demokratie und Frieden
- Bewertung der Rolle eines Weltstaates für die Sicherung des Friedens
- Reflexion der Bedeutung des Friedensbegriffs im Kontext internationaler Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema „Frieden“ ein und beleuchtet die Herausforderungen der Friedens- und Konfliktforschung im Kontext der Globalisierung und internationaler Konflikte. Sie stellt den Rahmen für die anschließenden Kapitel dar.
- Das Kapitel „Begriffsbestimmung“ analysiert den Friedensbegriff aus verschiedenen Perspektiven. Es diskutiert die Abwesenheit von Gewalt, den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Frieden sowie die Unterscheidung zwischen einem negativen und einem positiven Friedensbegriff.
- Im Kapitel „Frieden als Prozess“ wird der Fokus auf die Dynamik des Friedens gelegt. Es untersucht die Bedeutung des Zivilisationsprozesses und die Rolle von Kultur und Gesellschaft für die Entstehung und Entwicklung des Friedens.
- Das Kapitel „Friedensursachen“ analysiert verschiedene theoretische Ansätze zur Erklärung von Frieden. Es befasst sich mit den Konzepten des Realismus, des Neorealismus, des Institutionalismus und des Konstruktivismus und diskutiert deren jeweilige Perspektive auf Frieden und Konflikt.
- Das Kapitel „Frieden und Demokratie“ erörtert den Zusammenhang zwischen demokratischen Herrschaftsformen und Frieden. Es beleuchtet die Frage, ob und inwieweit Demokratie einen friedensfördernden Beitrag leisten kann.
Schlüsselwörter
Frieden, Konflikt, Internationale Beziehungen, Globalisierung, Zivilisationsprozess, Gerechtigkeit, Gewalt, Realismus, Neorealismus, Institutionalismus, Konstruktivismus, Demokratie, Weltstaat
- Quote paper
- Christoph Ohl (Author), 2002, Neue Denkansätze zum Thema "Frieden", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16211