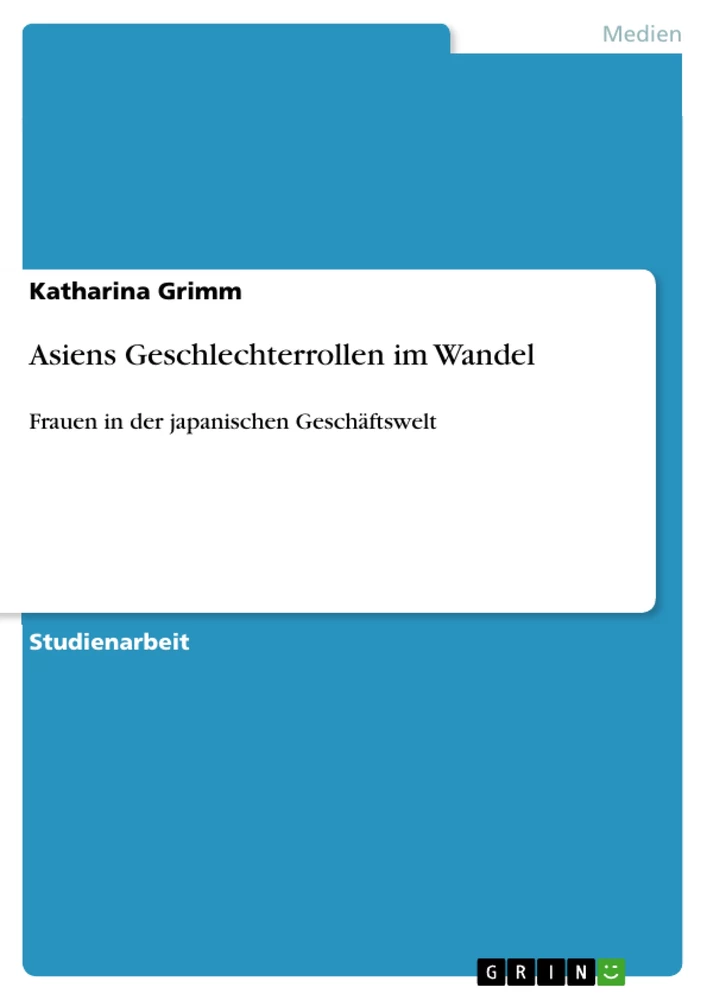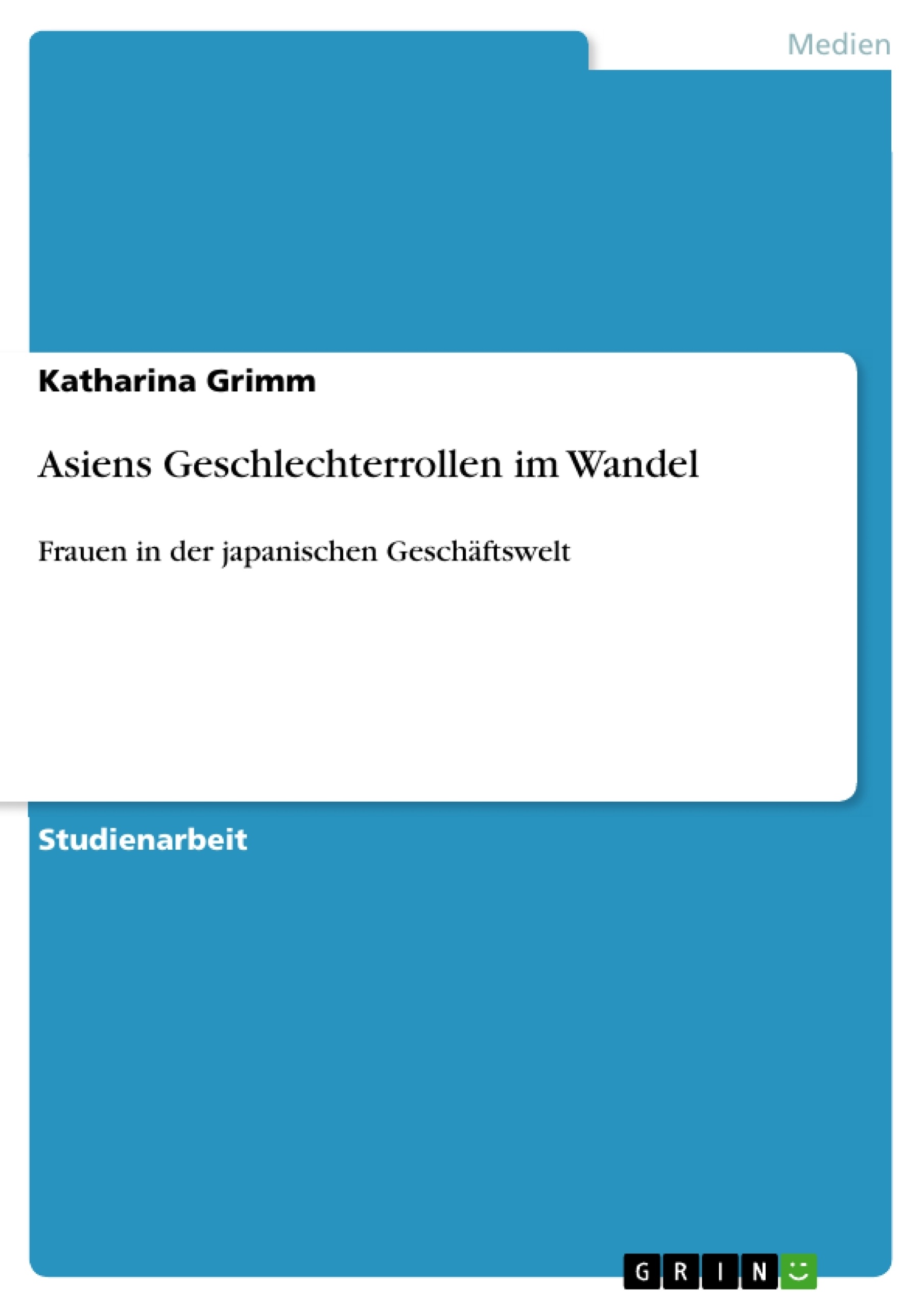Japan ist wie einige weitere ostasiatische Länder in der westlichen Presse oft Gegenstand von Kritik, weil das als wirtschaftlich stark und technologisch weit entwickelte Volk aus westlicher Sicht diskriminierend und veraltet wirkt, wenn es um die Rolle der Frau geht. Die Kritik baut auf Fakten auf, beleuchten doch Statistiken und Untersuchungen viele Ungleichheiten im Geschäftsleben von verschiedenen Seiten. Sie dokumentieren eine absolute Minderzahl von Frauen in Führungspositionen und eine Vielzahl von weiblichen Hochschulabsolventen, die trotz erfolgreichen Abschlusses Tätigkeiten mit geringen Verantwortlichkeiten wie der Positioneiner sogenannten „Office Lady“ wahrnehmen . Andere verzichten völlig auf eine berufliche Karriere. Doch reichen bloße Zahlen für ein wirklich treffendes Urteil?
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Arbeitswelt ist im interkulturellen Dialog ein sensibles Thema und um ihm gerecht zu werden, bedarf es dem Heranziehen von verschiedenen Faktoren. Meine Arbeit soll eben diese Tatsache verdeutlichen, indem etwa die Einflüsse des japanischen Wertesystems und das Verständnis von Rollenverteilung im Alltag klar gemacht werden. Zudem ist jeder Befund schwer zu bewerten, sofern er ohne Vergleich beurteilt wird. Es gilt also außerdem herauszufinden, ob die v ermeintlich benachteiligte Stellung der Frau im Beruf in Japan tatsächlich als absolut konservativ zu sehen ist, bzw. ob etwa westeuropäische Länder diesbezüglich andere Strukturen aufweisen.
Auch ist es unerlässlich, über die zahlenbelasteten Theorie der Statistiken hinauszugehen und einen Blick in die Praxis zu werfen. Dies kann besonders bedeutsam sein, um festzustellen, ob es entweder Akzeptanz oder Ablehnung der gegebenen Umstände gibt. Die Gleichstellung von Mann und Frau wird für interkulturelle Vergleiche oft zur Verdeutlichung von Unterschieden gewählt. Um dadurch Verhältnisse mit Begriffen wie „diskriminierend“ bewerten zu können, ist die Art und Weise, wie eine Gesellschaft selbst mit den Gegebenheiten umgeht, von großer Bedeutung.
Schließlich geht es nicht nur darum, Bewusstsein, sondern ein Verständnis für kulturelle Unterschiede zu entwickeln, um die Situation in einer anderen Kultur nicht anhand des eigenen Wertesystems zu beurteilen. Diese Arbeit soll einen Ansatz zur Herangehensweise an solche Problematiken darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft
- 2.1 Relevante Aspekte des japanischen Wertesystems
- 2.2 Die japanische Rollenverteilung im Alltag
- 3. Die Position der Frau in der japanischen Geschäftswelt
- 3.1 Schul- und Berufslaufbahn japanischer Frauen
- 3.2 Spuren des gesellschaftlichen Wandels
- 3.3 Bisherige Folgen des Wandels
- 4. Die Bedeutung der Rollenverteilung bei interkulturellen Begegnungen
- 4.1 Hürden und Chancen
- 4.2 Der Umgang in der Praxis
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft und Wirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Gleichstellungsbestrebungen und der Realität. Ziel ist es, ein differenziertes Bild zu zeichnen, indem kulturelle Werte, traditionelle Rollenverständnisse und deren Auswirkungen auf den interkulturellen Dialog beleuchtet werden. Ein Vergleich mit westlichen Gesellschaften soll helfen, die Situation in Japan besser einzuordnen.
- Das japanische Wertesystem und seine Auswirkungen auf die Geschlechterrollen
- Traditionelle Rollenverteilung im japanischen Alltag und Berufsleben
- Die Position der Frau in der japanischen Geschäftswelt und die Herausforderungen für Frauen
- Der Einfluss kultureller Unterschiede auf den interkulturellen Dialog zum Thema Gleichberechtigung
- Bewertung der vermeintlichen Benachteiligung japanischer Frauen im beruflichen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung stellt die Problematik der scheinbar widersprüchlichen Darstellung der Rolle der Frau im modernen Japan dar. Westliche Kritik an Diskriminierung wird mit Statistiken über die geringe Anzahl von Frauen in Führungspositionen belegt. Der Text betont jedoch die Notwendigkeit, über reine Zahlen hinauszugehen und kulturelle Faktoren zu berücksichtigen, um ein umfassendes Verständnis zu entwickeln. Das Ziel der Arbeit ist es, die Einflüsse des japanischen Wertesystems und die Rolle der Geschlechterverteilung im Alltag zu analysieren und einen differenzierten interkulturellen Vergleich anzustreben. Die Arbeit soll einen Ansatz zur Herangehensweise an solche Problematiken darstellen.
2. Die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft: Dieses Kapitel analysiert die tief verwurzelten kulturellen Werte, die die Rolle der Frau in Japan prägen. Es wird argumentiert, dass die langsame Veränderung von Geschlechterrollen mit den Werten und Moralvorstellungen der Bevölkerung korreliert. Der Einfluss von Buddhismus und Schintoismus auf ein starkes Gemeinschaftsgefühl und die Betonung von Selbstlosigkeit gegenüber der Familie werden hervorgehoben. Die traditionelle Arbeitsteilung in der Familie und der Glaube an eine natürliche Ordnung, die die Stärken von Männern und Frauen unterschiedlich verteilt sieht, werden als wichtige Faktoren für die Berufsentscheidungen von Frauen diskutiert. Die Entscheidung für die Kindererziehung und die häusliche Versorgung wird nicht nur als Folge von Benachteiligung, sondern auch als Ausdruck von Verantwortung und Selbstverpflichtung betrachtet.
2.2 Die japanische Rollenverteilung im Alltag: Im Gegensatz zur oft pauschalisierten Darstellung einer benachteiligten Rolle der Frau in Japan, wird hier argumentiert, dass die Rollenverteilung nicht automatisch mit Ungleichheit gleichzusetzen ist. Der westliche Blick, der Selbstverwirklichung hoch bewertet, steht dem japanischen Wertesystem gegenüber, in dem die Selbstlosigkeit für das Wohl der Familie eine zentrale Rolle spielt. Das traditionelle Bild des berufstätigen Mannes und der Hausfrau wird im japanischen Kontext anders bewertet, wobei die Rolle der Hausfrau nicht unbedingt mit Unterdrückung gleichgesetzt wird. Die finanzielle Versorgung der Familie durch den Mann wird als wichtiger Teil seiner Selbstverwirklichung gesehen.
Schlüsselwörter
Japan, Frauenrolle, Geschlechterrollen, Wertesystem, interkultureller Vergleich, Gleichberechtigung, Familie, Tradition, Buddhismus, Schintoismus, Arbeitsteilung, Selbstlosigkeit, westliche Kultur, Berufskarriere, Gleichstellungsgesetze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Rolle der Frau im modernen Japan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft und Wirtschaft. Sie untersucht die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Gleichstellungsbestrebungen und der Realität, beleuchtet kulturelle Werte und traditionelle Rollenverständnisse und deren Auswirkungen auf den interkulturellen Dialog. Ein Vergleich mit westlichen Gesellschaften hilft, die Situation in Japan einzuordnen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das japanische Wertesystem und dessen Einfluss auf Geschlechterrollen, die traditionelle Rollenverteilung im Alltag und Berufsleben, die Position der Frau in der japanischen Geschäftswelt und die damit verbundenen Herausforderungen, den Einfluss kultureller Unterschiede auf den interkulturellen Dialog zum Thema Gleichberechtigung und eine Bewertung der vermeintlichen Benachteiligung japanischer Frauen im beruflichen Kontext.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einführung, ein Kapitel über die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft (einschließlich der relevanten Aspekte des japanischen Wertesystems und der Rollenverteilung im Alltag), ein Kapitel über die Position der Frau in der japanischen Geschäftswelt (mit Unterkapiteln zu Schul- und Berufslaufbahn, Spuren des gesellschaftlichen Wandels und dessen Folgen), ein Kapitel über die Bedeutung der Rollenverteilung bei interkulturellen Begegnungen (Hürden und Chancen, sowie den Umgang in der Praxis) und abschließend ein Fazit.
Welche Schlüsselkonzepte werden untersucht?
Schlüsselkonzepte sind das japanische Wertesystem, traditionelle Geschlechterrollen, interkulturelle Unterschiede, Gleichberechtigung, Familie, Buddhismus, Schintoismus, Arbeitsteilung, Selbstlosigkeit und der Vergleich mit westlichen Kulturen.
Wie wird die Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft dargestellt?
Die Arbeit argumentiert, dass die langsame Veränderung von Geschlechterrollen mit den Werten und Moralvorstellungen der Bevölkerung korreliert. Der Einfluss von Buddhismus und Schintoismus, sowie die traditionelle Arbeitsteilung in der Familie und der Glaube an eine natürliche Ordnung, die die Stärken von Männern und Frauen unterschiedlich verteilt sieht, werden als wichtige Faktoren für die Berufsentscheidungen von Frauen diskutiert. Die Entscheidung für die Kindererziehung und die häusliche Versorgung wird nicht nur als Folge von Benachteiligung, sondern auch als Ausdruck von Verantwortung und Selbstverpflichtung betrachtet.
Wie wird die Position der Frau in der japanischen Geschäftswelt beschrieben?
Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen für Frauen in der japanischen Geschäftswelt und untersucht die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Gleichstellungsbestrebungen und der Realität. Sie analysiert Schul- und Berufslaufbahnen japanischer Frauen und die Spuren des gesellschaftlichen Wandels sowie die bisherigen Folgen dieses Wandels.
Wie wird der interkulturelle Aspekt behandelt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss kultureller Unterschiede auf den interkulturellen Dialog zum Thema Gleichberechtigung. Sie analysiert Hürden und Chancen im interkulturellen Austausch und beleuchtet den Umgang mit diesen Unterschieden in der Praxis.
Wie wird der Vergleich mit westlichen Gesellschaften angestellt?
Der Vergleich mit westlichen Gesellschaften dient dazu, die Situation in Japan besser einzuordnen und die unterschiedlichen Wertvorstellungen und deren Auswirkungen auf die Geschlechterrollen zu verdeutlichen. Der westliche Fokus auf Selbstverwirklichung wird dem japanischen Wertesystem gegenübergestellt, in dem Selbstlosigkeit für das Wohl der Familie eine zentrale Rolle spielt.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass ein umfassendes Verständnis der Rolle der Frau in Japan nur durch die Berücksichtigung kultureller Faktoren erreicht werden kann. Eine reine Fokussierung auf Statistiken und westliche Wertmaßstäbe reicht nicht aus, um die Komplexität der Situation angemessen zu erfassen.
- Quote paper
- Katharina Grimm (Author), 2009, Asiens Geschlechterrollen im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162076