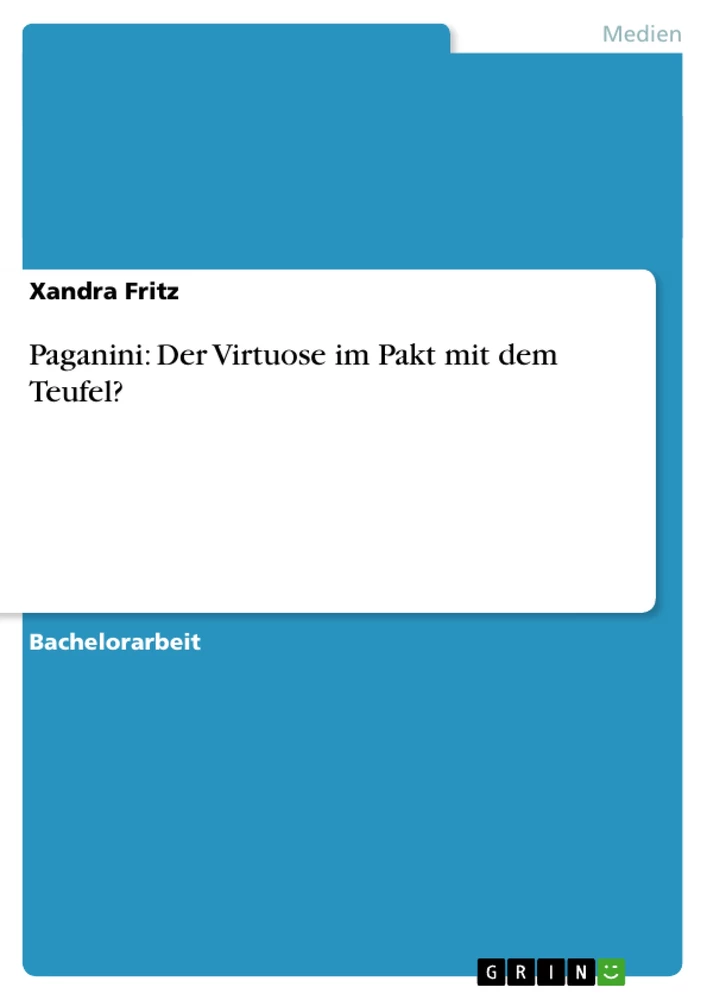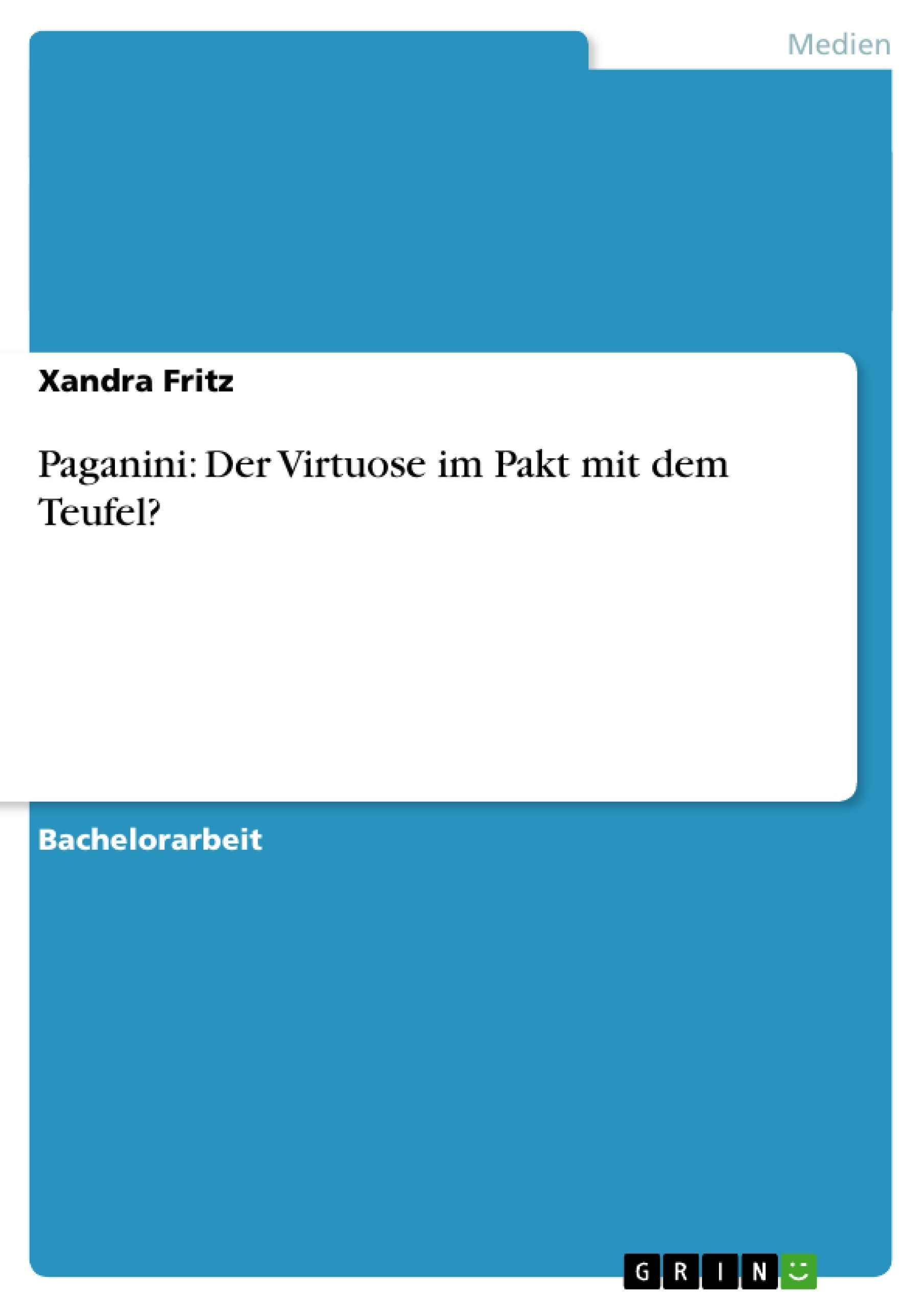Das Magazin P.M. veröffentlichte im Jahre 2002 Ergebnisse einer Umfrage, bei der 1.000 Personen interviewt worden sind. Demnach glaubten 23 % der Teilnehmenden an die Existenz eines Teufels, 14 % hielten es für möglich, mit ihm einen Pakt zu schließen, und 9 %
gaben zu, Angst vor ihm zu haben. Dies zeigt, dass selbst im beginnenden 21. Jahrhundert der Glaube an den Teufel bzw. Aberglaube immer noch existiert. Unter diesem Aspekt verwundert es nicht, dass die Gesellschaft im 19. Jahrhundert ebenfalls an die Existenz eines
Teufels glaubte.
In dieser Arbeit geht es um Niccolò Paganini – einen der erfolgreichsten Violinisten des 19. Jahrhunderts und vermutlich den technisch überragendsten Geiger aller Zeiten. Er beherrschte die Geige wie wahrscheinlich keiner vor ihm und sein Publikum
lag ihm zu Füßen. Doch eine solch bemerkenswerte Leistung ausschließlich auf Begabung und Übung zurückzuführen, konnten seine Zeitgenossen ihm offensichtlich schwerlich zugestehen. Sie suchten in Paganinis Leben und Lebenswandel einen Grund für seine Virtuosität. In ihren Augen hatten die Leistungen des Musikers übermenschliche, übernatürliche Dimensionen, und dementsprechend nannten sie ihn den „Teufelsgeiger“. Ihm haftete der Ruf eines Dämons an. Ich gehe in dieser Arbeit den Gründen für diese Zuschreibung nach und untersuche, warum Paganini, der beim Publikum doch Begeisterungsstürme auslöste, nicht mit positiven, sondern mit negativen Kräften – und zwar mit dem Teufel – in Verbindung gebracht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
- 2.2 Virtuosentum im 19. Jahrhundert
- 2.3 Musikalische Stars
- 3. Paganini
- 3.1 Paganini als Mensch
- 3.1.1 Biographie
- 3.1.2 Legendenbildung
- 3.1.3 Aussehen und Kleidung Paganinis
- 3.2 Paganini als Musiker
- 3.2.1 Die Musik Paganinis
- 3.2.2 Wirkung und Rezeption der Musik Paganinis
- 3.3 Zusammenführung
- 4. Der Teufel
- 4.1 Etymologischer Exkurs
- 4.2 Die Teufelsgenese
- 4.3 Die Physiognomie des Teufels
- 4.4 Der Teufel und die Musik
- 4.4.1 Die Diener des Teufels: Spielleute
- 4.4.1.1 Spielleute als Menschen
- 4.4.1.1.1 Der Stand der Spielleute in der mittelalterlichen Gesellschaft
- 4.4.1.1.2 Vorurteile gegenüber Spielleuten
- 4.4.1.1.3 Aussehen und Kleidung der Spielleute
- 4.4.1.2 Spielleute als Musiker
- 4.4.1.2.1 Die Musik der Spielleute
- 4.4.1.2.2 Die Vorstellungen von der Wirkung der Musik der Spielleute
- 4.5 Zusammenführung
- 5. Fazit
- Der zeitgeschichtliche Hintergrund und die gesellschaftlichen Verhältnisse im 19. Jahrhundert
- Das Phänomen des Virtuosentums und der musikalischen Stars im 19. Jahrhundert
- Paganinis Leben, sein Wirken und die Legenden um seine Person
- Die Vorstellung vom Teufel im 19. Jahrhundert und dessen Verbindung zur Musik
- Vergleich zwischen Paganini und den mittelalterlichen Spielleuten als „Diener des Teufels“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Verbindung zwischen Niccolò Paganini, einem der größten Violinisten des 19. Jahrhunderts, und dem Teufel. Die Arbeit analysiert, warum Paganini trotz seines überwältigenden Erfolgs und seiner Beliebtheit beim Publikum mit dämonischen Kräften assoziiert wurde. Ziel ist es, die Gründe für diese Zuschreibung aufzuzeigen und den historischen Kontext zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie auf eine Umfrage aus dem Jahr 2002 verweist, die den anhaltenden Glauben an den Teufel im 21. Jahrhundert belegt. Sie stellt Niccolò Paganini als herausragenden Violinisten vor und thematisiert die Verbindung seiner Virtuosität mit dem Bild des „Teufelsgeigers“. Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für diese Zuschreibung zu untersuchen und die relevanten Grundlagen zu erörtern.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt den Grundstein für die weitere Analyse. Es skizziert den zeitgeschichtlichen Kontext von Paganinis Leben, beleuchtet das Phänomen des Virtuosentums im 19. Jahrhundert mit seinen charakteristischen Eigenschaften und betrachtet den Aspekt des musikalischen Starwesens als weiteren Faktor für Paganinis Erfolg. Es liefert somit die notwendigen Rahmenbedingungen für das Verständnis von Paganinis Image.
3. Paganini: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Darstellung Paganinis. Es beinhaltet seine Biographie, die Legenden um ihn herum, sein Aussehen und seine Kleidung, seine Musik, ihre Wirkung und Rezeption. Der Fokus liegt darauf, Informationen zusammenzutragen, die zu seinem Image als „Teufelsgeiger“ beitrugen, und diese vor dem Hintergrund des Virtuosentums und des zeitgeschichtlichen Kontextes zu analysieren.
4. Der Teufel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bild des Teufels im 19. Jahrhundert. Es beinhaltet einen etymologischen Exkurs, die Genese des Teufelsbildes, seine Physiognomie und seine Verbindung zur Musik, insbesondere im Hinblick auf die mittelalterlichen Spielleute, die als „Diener des Teufels“ galten. Durch den Vergleich mit Paganini werden Parallelen und mögliche Erklärungen für die Assoziation zwischen dem Violinisten und dem Teufel hergestellt.
Schlüsselwörter
Niccolò Paganini, Virtuosentum, 19. Jahrhundert, Teufel, Legendenbildung, Musik, Spielleute, „Teufelsgeiger“, Zeitgeschichte, Musikalischer Star, Aberglaube.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Paganini und der Teufel
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen dem berühmten Violinisten Niccolò Paganini und dem Teufel. Sie analysiert, warum Paganini trotz seines Erfolgs mit dämonischen Kräften assoziiert wurde und beleuchtet den historischen Kontext dieser Zuschreibung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den zeitgeschichtlichen Hintergrund des 19. Jahrhunderts, das Phänomen des Virtuosentums und der musikalischen Stars, Paganinis Leben und die Legenden um ihn, die Vorstellung vom Teufel im 19. Jahrhundert und dessen Verbindung zur Musik, sowie einen Vergleich zwischen Paganini und mittelalterlichen Spielleuten als „Diener des Teufels“.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen (zeitgeschichtlicher Kontext, Virtuosentum, Musikstars), ein Kapitel über Paganini (Biographie, Legenden, Musik, Rezeption), ein Kapitel über den Teufel (Etymologie, Genese, Physiognomie, Verbindung zur Musik, Spielleute) und ein Fazit.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Vorschau?
Die Vorschau enthält Zusammenfassungen aller Kapitel. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Das Grundlagenkapitel skizziert den historischen Kontext. Das Paganini-Kapitel präsentiert eine umfassende Darstellung seines Lebens und Wirkens. Das Teufelskapitel beleuchtet das Bild des Teufels im 19. Jahrhundert und dessen Verbindung zu Musikern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Niccolò Paganini, Virtuosentum, 19. Jahrhundert, Teufel, Legendenbildung, Musik, Spielleute, „Teufelsgeiger“, Zeitgeschichte, Musikalischer Star, Aberglaube.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Gründe für die Assoziation Paganinis mit dem Teufel aufzuzeigen und den historischen Kontext dieser Zuschreibung zu beleuchten.
Welche Quellen werden vermutlich verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist in der Vorschau nicht enthalten, jedoch lässt sich aus dem Inhalt auf die Verwendung von historischen Quellen, Biographien Paganinis, musikwissenschaftlicher Literatur und möglicherweise theologischen Texten schließen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum, insbesondere an Leser*innen, die sich für Musikgeschichte, die Geschichte des 19. Jahrhunderts, und die Rolle von Aberglauben und Legenden interessieren.
- Quote paper
- Xandra Fritz (Author), 2010, Paganini: Der Virtuose im Pakt mit dem Teufel?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161836