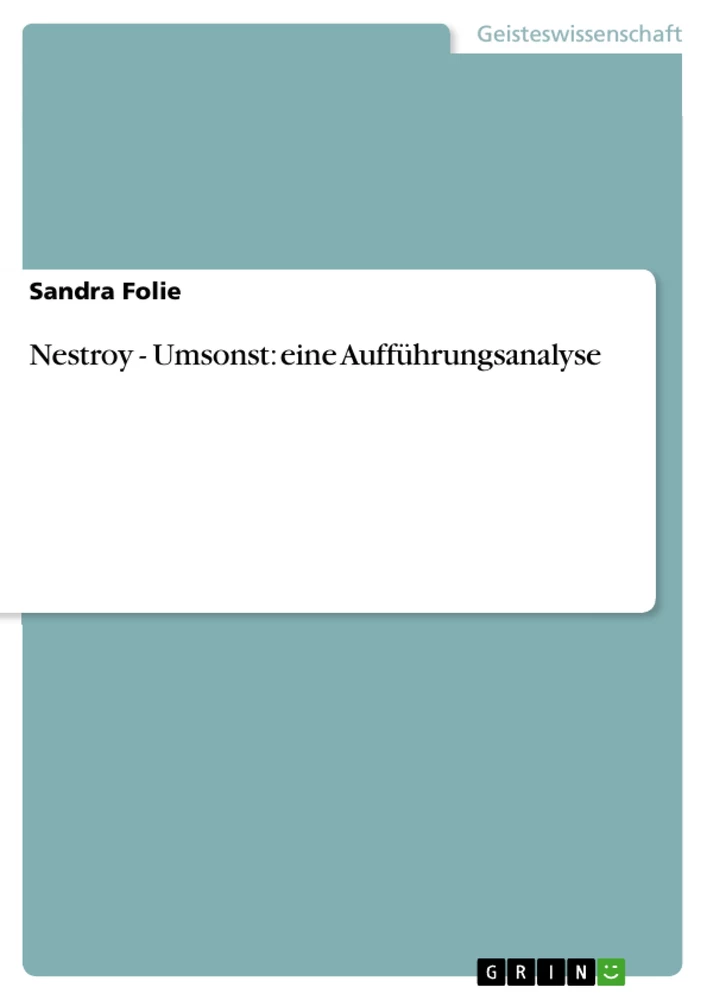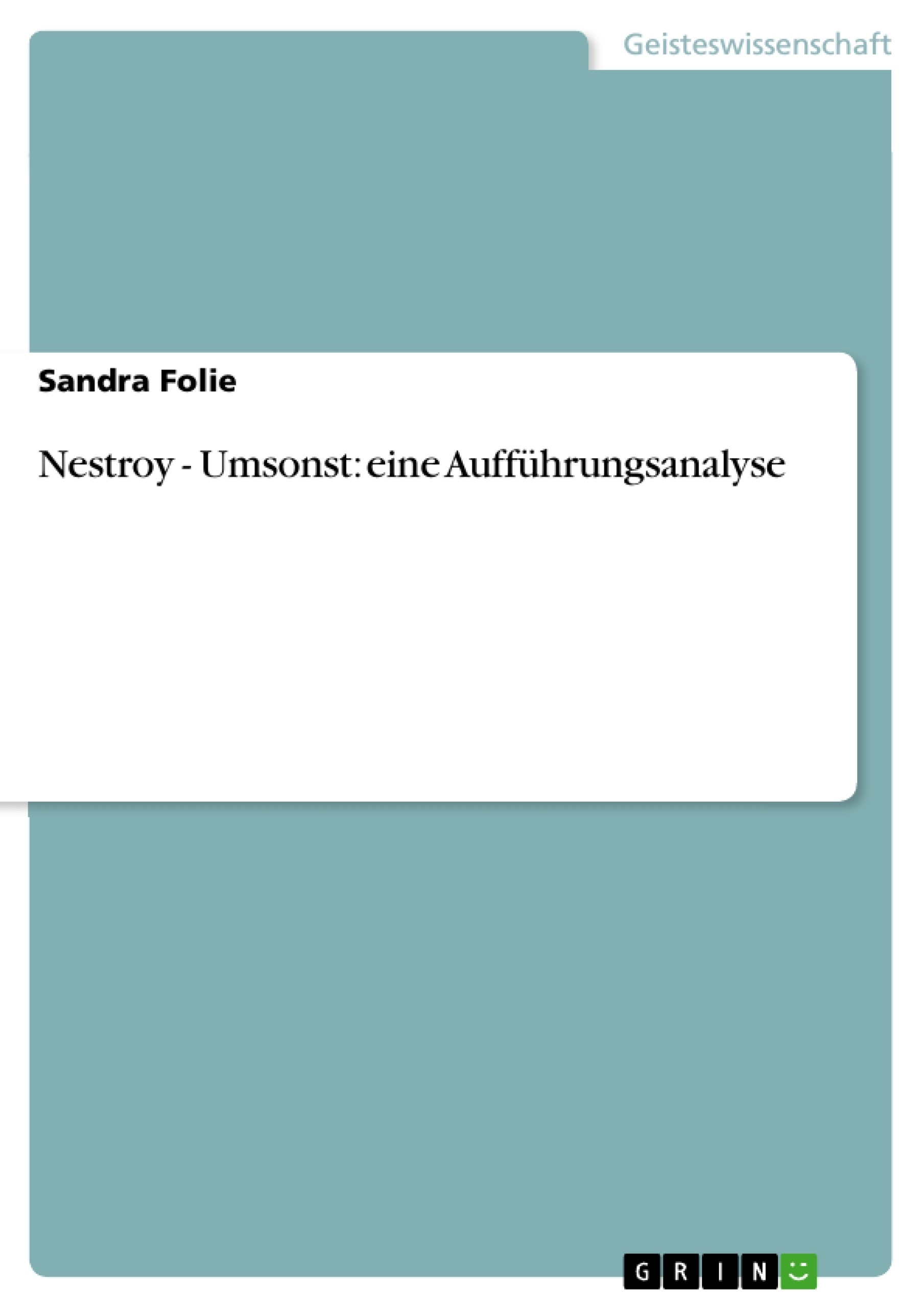Zuallererst verwundern rätselhafte neun Stühle auf der Bühne. Durch eine schmale Tür in der weißen, alles verdeckenden Bühnenwand, spaziert schnell hintereinander eine Personengruppe hervor. Sie setzen sich mit Blick zum Publikum auf die Bühne. Es herrscht eine strenge Teilung nach Geschlecht: links die Frauen, rechts die Männer. Beim Erlischen des Saallichtes stimmen sie eine Art Sprech-, Summ- und Geräuschmusik an; in ihrer Mitte ein Bodypercussionist, dessen Körper als Begleitinstrument dient. Während dieses ‚Katzengesangs’ senkt sich das Podium, bis nur noch die Köpfe der ‚Band’ zu sehen sind, die nun Richtung Bühne schauen. Aus mehreren Türen treten Figuren des Stückes vor, die Wand hebt sich und ermöglicht den Blick in die Guckkastenbühne. Kreuz und quer irren dort Darsteller über eine Drehscheibe, welche aus einem Labyrinth von Räumen besteht – ein Vorgeschmack für die Zuschauer auf eine Handlung, die ebenso impulsiv umherhüpft, in Sackgassen landet und sich wieder herauswindet. Mit dem Verstummen der Musik legt sich das chaotische Treiben auf der Bühne. Eine eigenwillige Ouvertüre, von der bei Nestroy nichts geschrieben steht neigt sich dem Ende zu, der erste Akt beginnt.
Inhaltsverzeichnis
- Umsonst: Eine Modernisierung des Nestroy'schen Stücks
- Der Auftakt und der Beginn des ersten Aktes
- Die Gestaltung des Bühnenbildes
- Verlagerung in eine andere Epoche?
- Die Veränderung der Szene im Wohnhaus
- Die Inszenierung des Wirtshauses in Stinatz
- Die Zeitliche Einordnung der Inszenierung
- Schottbergs Verwandlungen und die Bedeutung des Bühnenbildes
- Die Freigabe von Brüche und die Eigendynamik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Inszenierung von Michael Schottenberg des Nestroy'schen Stücks "Umsonst" im Volkstheater Wien, wobei der Fokus auf der Gestaltung der Bühne und der Verlagerung der Handlung in eine andere Epoche liegt.
- Vergleich zwischen Originaltext und Inszenierung
- Analyse der Veränderung des Bühnenbildes
- Einordnung der Inszenierung in einen zeitlichen Kontext
- Interpretation der symbolischen Bedeutung der Bühnenelemente
- Untersuchung der gesellschaftskritischen Aspekte des Stücks
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit dem ungewöhnlichen Bühnenbild, das mit der traditionellen Nestroy'schen Inszenierung bricht. Die Inszenierung beginnt mit einer ungewöhnlichen Ouvertüre, die den Zuschauern einen ersten Eindruck von der eigenwilligen Interpretation des Stücks vermittelt.
- Anschließend wird der Fokus auf die Gestaltung des Bühnenbildes gelegt, wobei der Schwerpunkt auf den Veränderungen im Vergleich zum Originaltext liegt. Insbesondere wird der Wandel des Kaffeehauses und des Wohnhauses der Frau Wispl analysiert und die symbolische Bedeutung der modernen Elemente beleuchtet.
- Der dritte Abschnitt widmet sich der Frage, ob die Inszenierung in eine andere Epoche verlagert wurde. Die Kostüme, die Ausstattung und einige Details im Bühnenbild werden untersucht, um die Zeitliche Einordnung der Inszenierung zu beleuchten.
- Im vierten Abschnitt wird die Inszenierung des Wirtshauses in Stinatz betrachtet und die Veränderungen im Vergleich zum Originaltext analysiert. Dabei wird auch auf die Bedeutung des Kellers eingegangen, der als symbolischer Ort für die Themen Geiz und Gier interpretiert wird.
- Der fünfte Abschnitt beschäftigt sich mit der Zeitlichen Einordnung der Inszenierung und zeigt Parallelen zwischen der Biedermeierzeit und den 1950er Jahren auf. Die Inszenierung wird in den Kontext der Nachkriegszeit und des Schweigens über den Nationalsozialismus eingeordnet.
- Der letzte Abschnitt fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und befasst sich mit der Bedeutung des Bühnenbildes in der Inszenierung von Schottenberg. Dabei wird deutlich gemacht, dass die Inszenierung zwar von der ursprünglichen Nestroy'schen Vorlage abweicht, aber dennoch deren Kern bewahrt und neu interpretiert.
Schlüsselwörter
Nestroy, Umsonst, Inszenierung, Bühnenbild, Epoche, Zeitverschiebung, Symbolismus, Gesellschaftskritik, Nachkriegszeit, Nationalsozialismus, Biedermeierzeit, Modernisierung, Inszenierungskunst, Theatergeschichte, Vergleich, Analyse, Interpretation.
- Quote paper
- Sandra Folie (Author), 2009, Nestroy - Umsonst: eine Aufführungsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161825