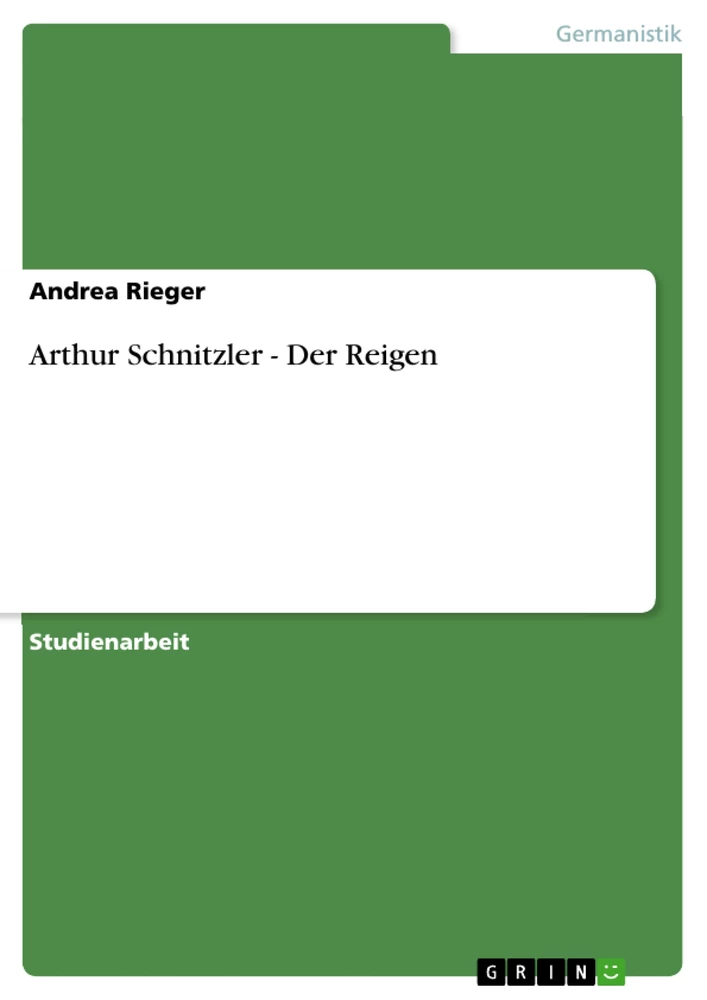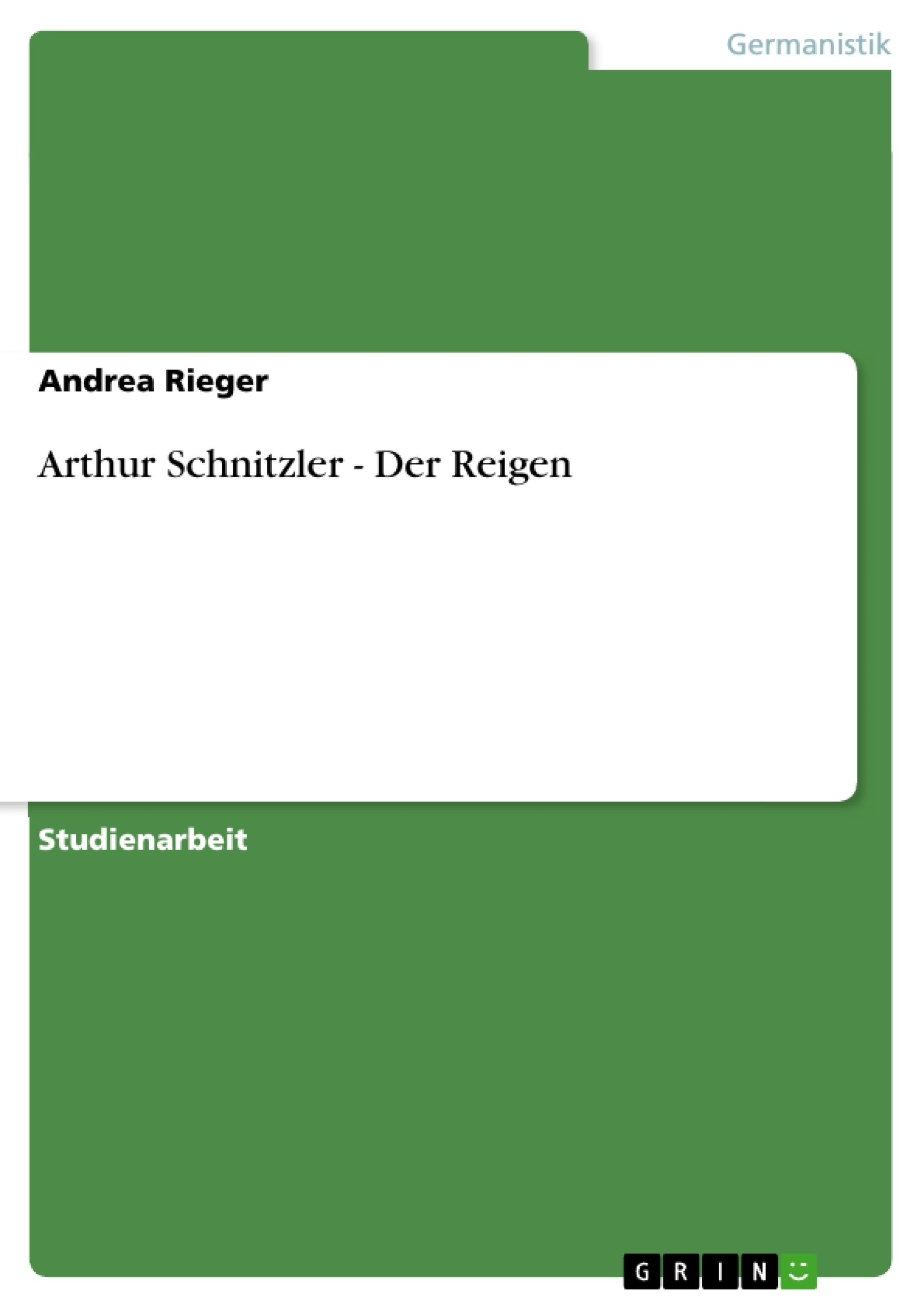Schnitzler zeigt in zehn Szenen wie zehn Menschen unter der physischen Einwirkung des Geschlechtstriebes alle individuell menschlichen Züge verlieren und rein animalisch und uniform ihre Handlungen auf das eine Ziel, die Befriedigung des Triebes, ausrichten.
Das Prinzip des Reigens wird durch das Abspielen einiger Motive von mehreren Partnern und einiger stereotyper Redewendungen durchexerziert. Die Motive bilden eine gedankliche und bildliche Verbindung der einzelnen Szenen und Figuren.
Die Beziehungen zwischen Mann und Frau verlaufen disharmonisch:
Die Frau wechselt von spröder Ablehnung zu zärtlicher Anhänglichkeit, der Mann von sinnlicher Erregung zu kalter Ablehnung. Die Unmöglichkeit gemeinsamen Glücks wird offenbar.
Die Begebnisse des Reigens implizieren die These, daß allen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrem Sozialstatus ein elementares Verlangen zukommt, das keineswegs immer auf Liebe und Ehe zielt.
Inhaltsverzeichnis
- Zehn Motive
- Das Motiv der Eile
- Bemerkungen zu den Licht- und Temperaturverhältnissen
- Die Angst, daß jemand kommt
- Das Heucheln des Verführtwerdens
- Das Ablehnen der Beantwortung persönlicher Fragen
- Die Frage: „Hast mich gern?“
- Komplimente und Schmeicheleien
- Echte und geheuchelte Eifersucht
- Das Küssen
- Essen, Trinken, Rauchen und Geruchsempfindungen
- Die Beziehungen zwischen Mann und Frau verlaufen disharmonisch:
- Schnitzler schrieb in einem Brief:
- Zunächst ist der Reigen gar nicht für die Bühne gedacht, es erscheinen nur 200 Exemplare, die Schnitzler an seine Freunde weitergibt.
- Doch 1920 kommt es dann zur Uraufführung in Berlin.
- Seine Biografie möchte ich aussparen, zu erwähnen scheint mir nur wichtig, was für das Stück interessant ist: Der Arzt in Schnitzler hat Beobachtung und Diagnose des Dichters geprägt und bestimmt. Auch die der eigenen Person.
- Schnitzlers Reigen ist als Zyklus von 10 Einaktern konstruiert, mit einem Personal von 10 Figuren (die ich auf dem Handout angeführt habe).
- Wie die Figuren des Puppentheaters, wie die Gestalten des Totentanzes sind sie Typen - und wie Marionetten reagieren sie alle gleich auf die Anreize od. Antriebe, d.h. Dirne und Ehefrau oder Ehegatte und Soldat sind nicht so himmelweit voneinander unterschieden.
- Die in sich geschlossenen Episoden sind dadurch verknüpft, daß jeweils einer der beiden Akteure im nächsten Akt auf einen neuen Partner trifft, bis sich der amouröse Kreis wieder schließt.
- Mit der Negation der natürlichen Geschlechterdifferenz steht Schnitzler in der Zeit d. Jahrhundertwende mit seiner Auffassung eher alleine da.
- Noch etwas zum sozialen Status:Der Soldat und das Stubenmädchen gehören ebenso wie der junge Herr und die junge Frau derselben Schicht an, können über den anderen nicht verfügen und spielen das Spiel deshalb als Ebenbürtige.
- Unbedingt beachtet werden muß, daß die Reihenfolge der Szenen strikt den sozialen Möglichkeiten folgt, über welche die Figuren verfügen, d.h. die junge Frau und der Soldat wäre eine unmögliche Konstellation gewesen. Die einzige Ausnahme ist der Graf: er verkehrt ganz natürlich sowohl mit der Schauspielerin als auch mit der Dirne.
- Die Szenen mit dem Aufstieg im sozialen Milieu verlängern sich: das hat mit den längeren Umständen zu tun, die man sich in gehoberen Schichten macht, es verlängern sich die Gespräche, die Charaktere werden diffiziler beschrieben, aber die Flüchtigkeit und die neue Begehrlichkeit nach dem nächsten und anderen zeigen sich schnell bei allen.
- Zehnfach variiert wiederholt sich das Ritual der Verführung: die verschiedensten VH-Weisen werden an den Tag gelegt:
- Die Beziehungen zw. Mann und Frau verlaufen disharmonisch:
- Es herrscht totale Beziehungs- und Liebesunfähigkeit.
- Schnitzler führt eine weibliche Figur ein, die sich nicht erniedrigen läßt: Die Schauspielerin.
- Im Moment der körperlichen Vereinigung wird die sozial Schwächere vom Reicheren, wie beim Beispiel Stubenmädchen – junger Herr, ausgenutzt und benutzt.
- Oder der Erfolglose wird vom Erfolgreicheren übervorteilt, wie am Beispiel Dichter und Schauspielerin
- Die 5. Szene hat eine herausragende Bedeutung für das Stück, denn hier wird der legitime eheliche Geschlechtsakt vollzogen.
- Das Gespräch der sich gegenseitig betrügenden Ehegatten, dem Zentrum des Reigens, zeigt vollends die in der Gesellschaft herrschende Doppelmoral.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Arthur Schnitzlers "Reigen" präsentiert in zehn kurzen Szenen die menschliche Natur im Angesicht des Geschlechtstriebes. Die einzelnen Szenen zeichnen das Bild einer Gesellschaft, in der Beziehungen von Oberflächlichkeit und dem Streben nach sexueller Befriedigung geprägt sind.
- Der Einfluss der Gesellschaft und ihre Doppelmoral auf die zwischenmenschlichen Beziehungen
- Die Rolle des Geschlechtstriebes in der menschlichen Natur
- Die unterschiedlichen Rollen von Mann und Frau in der Gesellschaft
- Die Suche nach Liebe und Glück in einer Welt der Oberflächlichkeit
- Die Darstellung der menschlichen Verhaltensmuster in verschiedenen sozialen Schichten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die ersten Szenen des "Reigens" stellen verschiedene Charaktere vor, die alle durch ihren Geschlechtstrieb getrieben werden. Die Motive, die in den einzelnen Szenen wiederholt vorkommen, unterstreichen die wiederkehrenden Muster des menschlichen Verhaltens im Kontext der sexuellen Begegnung.
- Die Beziehungen zwischen Mann und Frau werden in den einzelnen Szenen als disharmonisch dargestellt. Die Figuren zeigen eine Unfähigkeit zu echter Liebe und zu dauerhaften, erfüllten Beziehungen.
- Die soziale Schicht spielt eine wichtige Rolle in den Interaktionen der Figuren. Schnitzlers "Reigen" bietet einen Einblick in die verschiedenen Lebenswelten und die damit verbundenen sozialen Normen und Erwartungen.
- Die Szene zwischen dem Ehemann und der Ehefrau zeigt die herrschende Doppelmoral in der Gesellschaft. Die unterschiedliche Erziehung und Erwartungshaltung gegenüber Mann und Frau führt zu Konflikten und Missverständnissen.
Schlüsselwörter
Schnitzlers "Reigen" beleuchtet mit analytischem Blick die menschliche Psyche in ihren sexuellen Bedürfnissen und die Dynamik der Beziehungen in der Gesellschaft. Schlüsselbegriffe sind hier: Geschlechtstrieb, Doppelmoral, soziale Schichten, Oberflächlichkeit, Beziehungen, Liebe, Glück, Sexualität, Verhaltensmuster und Gesellschaft.
- Quote paper
- Andrea Rieger (Author), 1999, Arthur Schnitzler - Der Reigen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1615