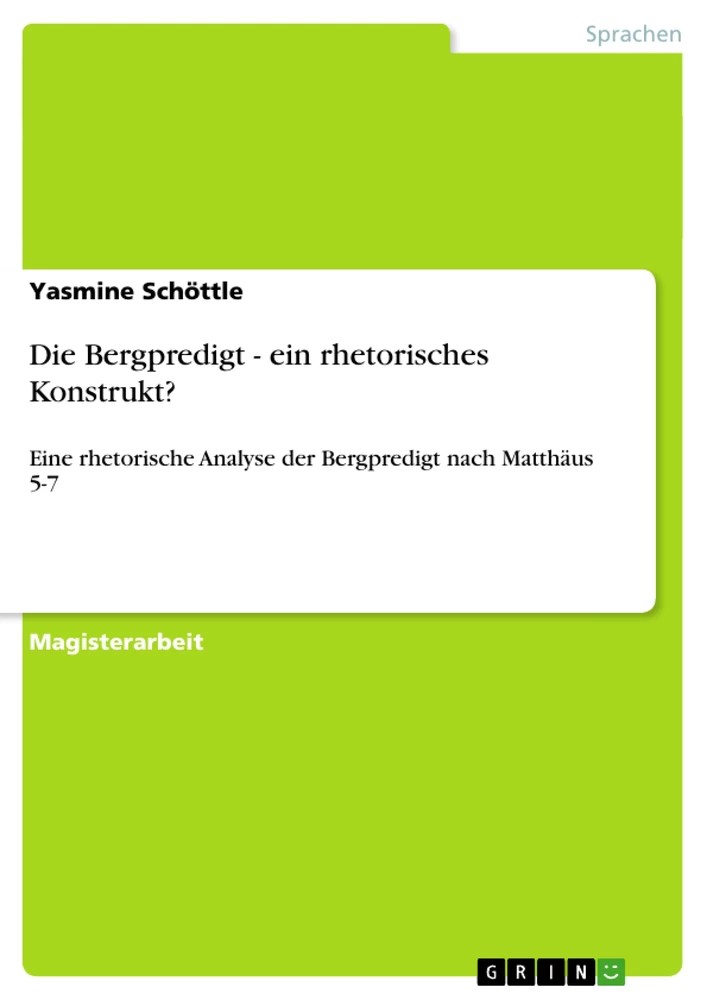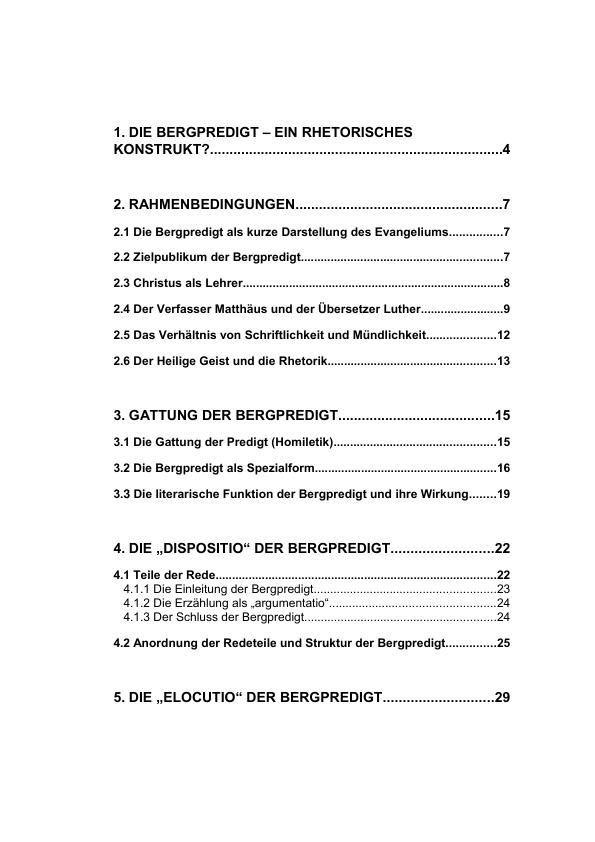Die Bergpredigt – ein rhetorisches Konstrukt? (Eine rhetorische Analyse der Bergpredigt nach Matthäus 5-7)
"Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg
und setzte sich; und seine Jünger traten zu ihm."
Mit diesen Worten beginnt eines der wichtigsten Zeugnisse christlichen Glaubens – die Bergpredigt. Sie steht sowohl im Matthäus- als auch im Lukasevangelium und enthält neben Anweisungen für verschiedene Lebensbereiche auch das für die Christenheit wichtige „Vaterunser“. Nach Überlieferungen soll die Bergpredigt eine der berühmtesten Reden Jesu Christi sein, die nach damaligen Glauben von einem seiner Jünger festgehalten worden sein soll. Die Bergpredigt also als Rede Jesu, die auch als Predigt vom Berg verstanden wurde. Heutige Forschungen gehen jedoch davon aus, dass es sich bei der Bergpredigt wahrscheinlich um eine „redaktionelle Bearbeitung und Komposition von recht verschiedenartigem Überlieferungsgut“1 handelt. Die Bergpredigt sei als Sammlung verschiedener Weisheiten oder Ratschläge zu betrachten – nicht als eine im Ganzen konstruierte Rede.
Doch auch bei solch einer nüchternen Ansichtsweise dieses Textes, ist die Bergpredigt eines der wichtigsten Kernstücke des christlichen Glaubens. Nicht zuletzt weil sie Teil der Bibel ist – das Exempel christlichen Glaubens. Doch was genau ist nun die Bergpredigt? Stellt die Bergpredigt eine speziell für die damalige Zuhörerschaft entworfene „Lebensanleitung“ dar – eine Art Programm, das in dieser Art tatsächlich von Jesus entworfen und später als Rede gehalten wurde? Oder handelt es sich hierbei um ein fein konstruiertes Gebilde späterer Autoren? Und wenn ja, mit welchen rhetorischen Mitteln soll dieses Konstrukt überzeugen?
„Rhetorik lehrte nicht nur, Texte zu machen; dank ihres ausgebauten „Systems“, vor allem im Bereich der Stilistik, ermöglichte sie es auch, Dichtung zu interpretieren." Dies soll auch die Hauptaufgabe in der vorliegenden Arbeit sein. [...] Die Analyse soll zeigen, ob die Bergpredigt als Rede (aus rhetorischer Sicht) betrachtet werden kann und wie sie konstruiert ist. Dabei werde ich mich auf die Bergpredigt nach Matthäus 5-7 stützen. [...]
Insgesamt soll mit den einzelnen Aspekten der Analysearbeit gezeigt werden, dass eine Konstruktion und Kompostition hinter der Bergpredigt steckt. Dies soll nach der Systematik der rhetorischen Produktionsstadien geschehen, soweit dies möglich ist.
Inhaltsverzeichnis
- DIE BERGPREDIGT – EIN RHETORISCHES KONSTRUKT?
- RAHMENDINGUNGEN
- Die Bergpredigt als kurze Darstellung des Evangeliums
- Zielpublikum der Bergpredigt
- Christus als Lehrer
- Der Verfasser Matthäus und der Übersetzer Luther
- Das Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit
- Der Heilige Geist und die Rhetorik
- GATTUNG DER BERGPREDIGT
- Die Gattung der Predigt (Homiletik)
- Die Bergpredigt als Spezialform
- Die literarische Funktion der Bergpredigt und ihre Wirkung
- DIE „DISPOSITIO“ DER BERGPREDIGT
- Teile der Rede
- Die Einleitung der Bergpredigt
- Die Erzählung als „argumentatio“
- Der Schluss der Bergpredigt
- Anordnung der Redeteile und Struktur der Bergpredigt
- Teile der Rede
- DIE „ELOCUTIO“ DER BERGPREDIGT
- Die Tugenden der Bergpredigt
- Der hohe Stil der Bergpredigt
- Ornatus
- Redeschmuck in Einzelwörtern
- Redeschmuck in Wortverbindungen
- Wortfiguren
- Gedanken-, Sinnfiguren
- ACTIO - DIE „INSZENIERUNG“ IN DER BERGPREDIGT
- attentum parare durch principium
- Die Inszenierung durch Jesus und seinen Redaktor
- ERGEBNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Bergpredigt nach Matthäus 5-7 unter rhetorischen Gesichtspunkten. Ziel ist es, die rhetorischen Mittel zu untersuchen, die zur Konstruktion und Überzeugungskraft des Textes beitragen. Die Analyse konzentriert sich auf die Frage, ob die Bergpredigt als eine kohärent konstruierte Rede betrachtet werden kann oder eher als eine Sammlung verschiedener Weisheiten.
- Rhetorische Analyse der Bergpredigt nach Matthäus
- Untersuchung der Gattung und Struktur der Bergpredigt
- Analyse der Stilmittel (Elocutio) und ihrer Wirkung
- Betrachtung der Inszenierung (Actio) der Bergpredigt
- Die Frage nach der Einheitlichkeit und Konstruktion des Textes
Zusammenfassung der Kapitel
1. DIE BERGPREDIGT – EIN RHETORISCHES KONSTRUKT?: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage: Ist die Bergpredigt eine kohärente Rede oder eine Sammlung verschiedener Überlieferungen? Sie diskutiert die verschiedenen Ansichten zur Entstehung und den Stellenwert der Bergpredigt im christlichen Glauben und kündigt den methodischen Ansatz der rhetorischen Analyse an, wobei die Matthäus-Version und Luthers Übersetzung als Grundlage dienen.
2. RAHMENBEDINGUNGEN: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die folgende Analyse. Es beleuchtet verschiedene Aspekte des Kontextes der Bergpredigt, wie ihre kurze Darstellung des Evangeliums, ihr Zielpublikum, Jesus als Lehrer, die Rolle Matthäus und Luthers, das Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit sowie den Einfluss des Heiligen Geistes auf die Rhetorik. Diese Faktoren schaffen das Verständnis für die Entstehung und Interpretation des Textes.
3. GATTUNG DER BERGPREDIGT: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einordnung der Bergpredigt in die Gattungslehre. Da eine eindeutige Zuordnung schwierig ist, werden verschiedene Aspekte untersucht, wie die klassische Predigt (Homiletik) und die Bergpredigt als Spezialform derselben. Der Fokus liegt auf der literarischen Funktion und ihrer Wirkung auf das Publikum.
4. DIE „DISPOSITIO“ DER BERGPREDIGT: Hier wird der Aufbau der Bergpredigt nach einem Modell von Ulrich Luz analysiert. Obwohl die Bergpredigt auf den ersten Blick fragmentiert erscheint, wird mittels einer detaillierten Untersuchung der Teile (Einleitung, Argumentation, Schluss) und ihrer Anordnung gezeigt, dass ein systematischer Aufbau erkennbar ist und der Text strukturiert ist.
5. DIE „ELOCUTIO“ DER BERGPREDIGT: Dieses Kapitel analysiert den Stil der Bergpredigt. Es untersucht die stilistischen Tugenden, den hohen Stil, und den "Ornatus" – den rhetorischen Schmuck. Die Analyse umfasst Einzelwörter (Hyperbeln, Metaphern, Metonymien etc.) und Wortverbindungen (Alliterationen, Anaphern, Chiasmen etc.), sowie Sinnfiguren wie Antithesen und Similituden. Die detaillierte Betrachtung der Stilmittel offenbart die Kunstfertigkeit und Wirkung des Textes.
6. ACTIO - DIE „INSZENIERUNG“ IN DER BERGPREDIGT: Dieses Kapitel untersucht die "Actio", also die Präsentation und Aufführung der Bergpredigt. Obwohl eine direkte Rekonstruktion der Präsentation schwierig ist, werden die verschiedenen Aspekte der Inszenierung, insbesondere die Rolle Jesu und seines Redaktors, analysiert, um das Verständnis der Wirkung und Überzeugungskraft des Textes zu erweitern.
Schlüsselwörter
Bergpredigt, Matthäus, Rhetorik, Dispositio, Elocutio, Actio, Gattungslehre, Stilmittel, Stilfiguren, Biblische Hermeneutik, Christlicher Glaube, Redeanalyse, Textkonstruktion, Überlieferung.
Häufig gestellte Fragen zur rhetorischen Analyse der Bergpredigt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Bergpredigt nach Matthäus 5-7 unter rhetorischen Gesichtspunkten. Das Hauptziel ist die Untersuchung der rhetorischen Mittel, die zur Konstruktion und Überzeugungskraft des Textes beitragen. Es wird untersucht, ob die Bergpredigt als kohärent konstruierte Rede oder eher als eine Sammlung verschiedener Weisheiten betrachtet werden kann.
Welche Aspekte der Bergpredigt werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf verschiedene Aspekte: die rhetorische Analyse der Bergpredigt nach Matthäus, die Untersuchung der Gattung und Struktur, die Analyse der Stilmittel (Elocutio) und ihrer Wirkung, die Betrachtung der Inszenierung (Actio) und die Frage nach der Einheitlichkeit und Konstruktion des Textes.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine rhetorische Analyse, die sich auf die Matthäus-Version und Luthers Übersetzung stützt. Der methodische Ansatz umfasst die Untersuchung der Dispositio (Aufbau), der Elocutio (Stilmittel) und der Actio (Inszenierung) der Bergpredigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Kapitel 1 stellt die Forschungsfrage nach der Kohärenz der Bergpredigt. Kapitel 2 beleuchtet die Rahmenbedingungen wie Zielpublikum und den Einfluss von Matthäus und Luther. Kapitel 3 untersucht die Gattung der Bergpredigt. Kapitel 4 analysiert die Dispositio (Aufbau) der Rede. Kapitel 5 untersucht die Elocutio (Stilmittel und Rhetorik). Kapitel 6 befasst sich mit der Actio (Inszenierung). Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bergpredigt, Matthäus, Rhetorik, Dispositio, Elocutio, Actio, Gattungslehre, Stilmittel, Stilfiguren, Biblische Hermeneutik, Christlicher Glaube, Redeanalyse, Textkonstruktion, Überlieferung.
Welche konkreten Stilmittel werden analysiert?
Die Analyse der Elocutio umfasst Einzelwörter (Hyperbeln, Metaphern, Metonymien etc.) und Wortverbindungen (Alliterationen, Anaphern, Chiasmen etc.), sowie Sinnfiguren wie Antithesen und Similituden.
Wie wird die "Actio" der Bergpredigt betrachtet?
Die "Actio" (Inszenierung) wird analysiert, indem die Rolle Jesu und seines Redaktors untersucht wird, um die Wirkung und Überzeugungskraft des Textes zu verstehen. Eine direkte Rekonstruktion der Präsentation ist jedoch schwierig.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob die Bergpredigt als eine kohärente, rhetorisch konstruierte Rede betrachtet werden kann oder eher als eine Sammlung verschiedener Weisheiten. Die detaillierte Analyse der Dispositio, Elocutio und Actio soll zu dieser Frage beitragen. (Das genaue Ergebnis wird im Kapitel "Ergebnis" zusammengefasst).
- Quote paper
- Yasmine Schöttle (Author), 2009, Die Bergpredigt - ein rhetorisches Konstrukt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161325