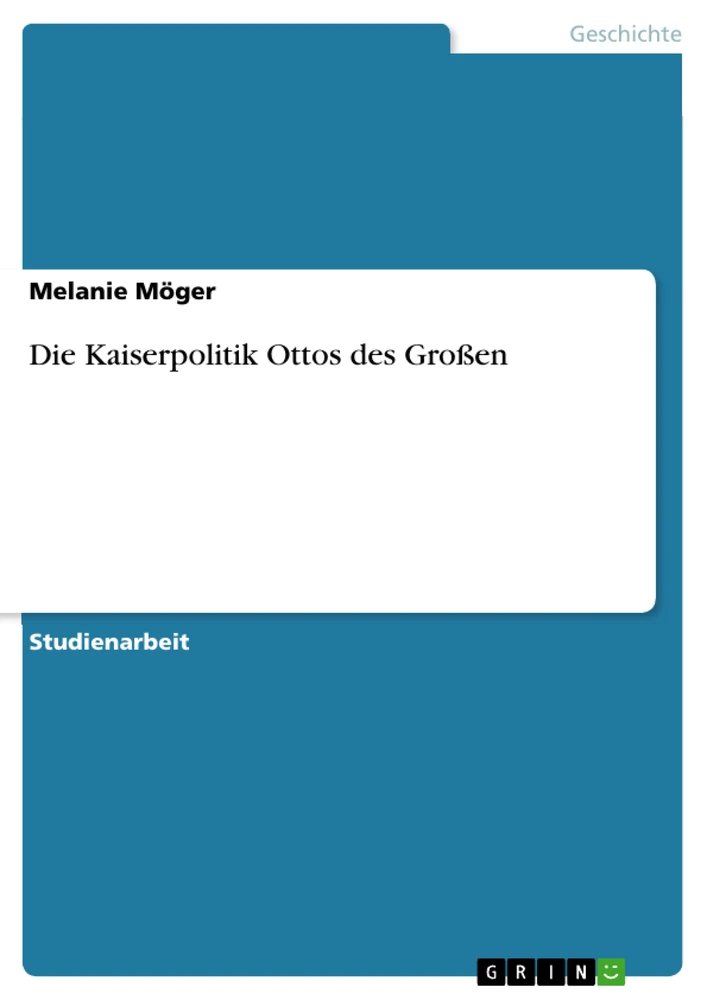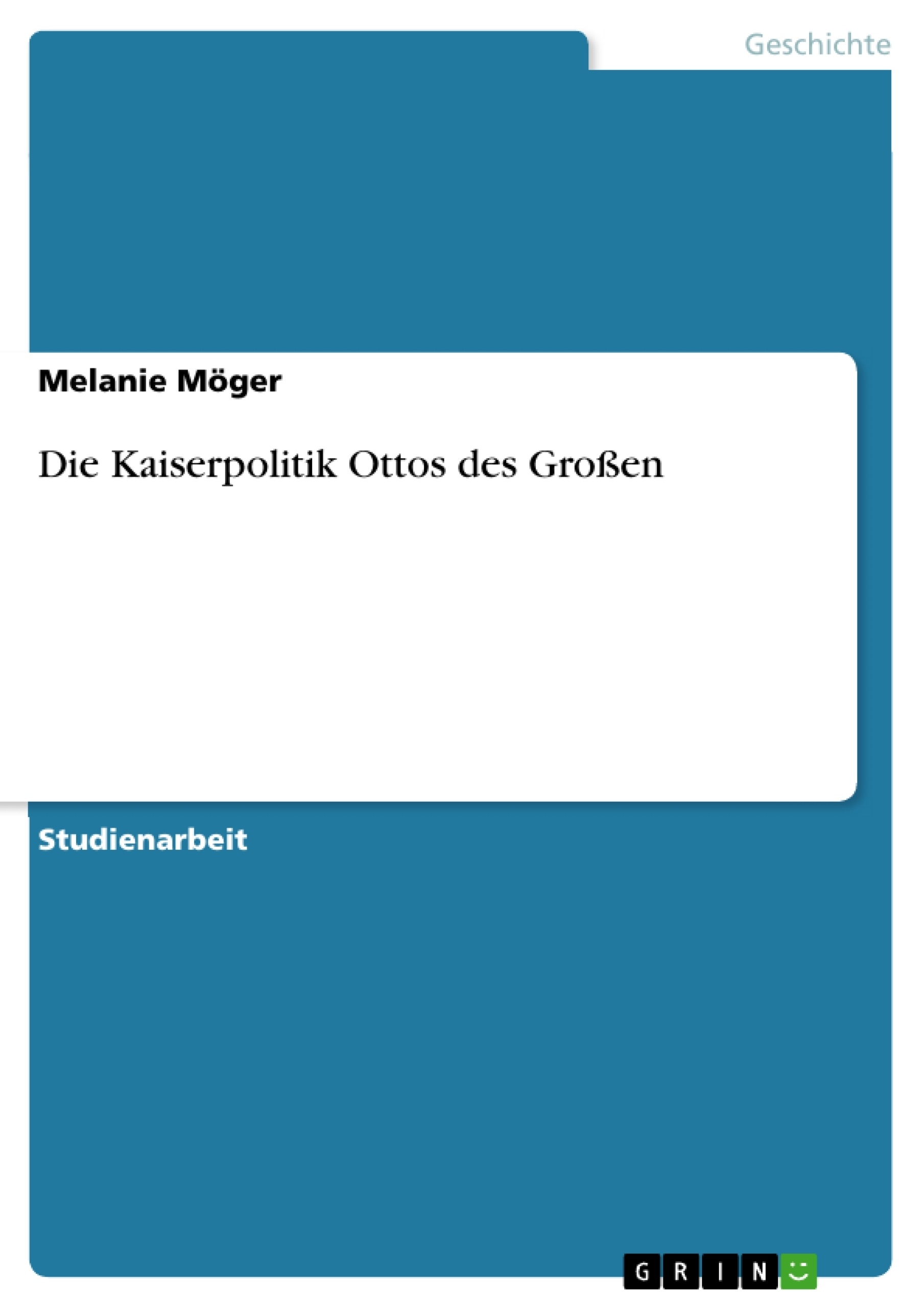Im Mittelalter wurden mehr als nur einmal Kaisertümer geschaffen. Zuerst herrschte das fränkische der Karolinger, gegründet unter Heinrich I., dann das der deutschen Ottonen, an dessen Spitze der Begründer Otto I. stand. Dieses Kaisertum entstand neben demjenigen in Byzanz, das seit der Antike ununterbrochen fortbestand. Daher musste das Verhältnis zwischen dem römisch-abendländischen und dem oströmisch-byzantinischen Kaisertum erforscht werden. Jedoch konzentriert sich die Forschung meist immer noch auf das Gleichbleibende oder Erneuerte am Kaisertum. Man muss jedoch bedenken, dass Ottos I. Kaiserkrönung am 02. Februar 962 nicht nur eine Erneuerung und eine Wiederherstellung des seit 924 unterbrochenen Kaisertums von Heinrich I. darstellte, sondern vielmehr auch Entscheidungen fällte, die für Jahrhunderte folgenreich blieben. Wichtig zu nennen wäre, dass bis zum Ende des alten Reiches der deutsche König immer zum Kaiser gekrönt wurde. Dies konnte nur vom Papst selbst in Rom durchgeführt werden. Vor der Zeit Otto I. hingegen wurden nicht nur Könige zum Kaiser gekrönt. Vor ihm waren es keine karolingischen Frankenkönige, sondern zwei Markgrafen. Als letzter Karolinger wurde 896 der ostfränkische König Arnulf zum Kaiser gekrönt. Daher überrascht es nicht, dass Ottos I. Zeitgenossen von einer Erinnerung an ein machtlos und glanzlos gewordenes Kaisertum gelenkt wurden, wenn man bedenkt, dass es in Byzanz nicht notwendig war, aus einem angestammt Herrschergeschlecht zu stammen, um Kaiser zu werden. Eine kirchliche Salbung und Krönung war im byzantinischen Reich ebenfalls nicht notwendig. Weiterhin waren die Zeitgenossen zur Zeit Ottos des Großen überzeugt, davon, dass ihr König auch durch eigene Kraft Kaiser werden könne, wie es Widukind in seiner Sachsengeschichte darstellt, nämlich dass Otto I. schon 955 auf dem Lechfeld nach der gewonnenen Schlacht gegen die Ungarn von seinem Heer zum Kaiser ausgerufen wurde.
Otto I. wünschte sich, dass die Nachfolge im Kaisertum jeweils durch eine päpstliche Kaiserkrönung in Rom und zu Lebzeiten des Vaters durchgeführt wird. Daher ließ Otto der Große seinen Sohn Otto II. am Weihnachtstag 967 zum Mitkaiser erheben.
Nun stellt sich nach den ersten Betrachtungen die Frage: Welche Voraussetzungen waren für das Kaisertum Ottos des Großen entscheidend? Welchen genauen Verlauf nahm seine Kaiserpolitik? Und vor allem: Welche entscheidenden Erfolge konnte er erzielen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Voraussetzungen der Kaiserpolitik Ottos des Großen
- 2.1.1 Historische Voraussetzungen
- 2.1.2 Die Schlacht auf dem Lechfeld.
- 2.2 Der Verlauf der Kaiserpolitik Ottos des Großen
- 2.2.1 Die Kaiserkrönung in Rom.
- 2.2.2. Kaisertum, Rom und Papstbezug in der Zeit Ottos I.
- 2.2.3 Die Gründung der Kirchenprovinz Magdeburg
- 2.2.4 Die,,nasse Grenze\" im Osten
- 2.3. Die Erfolge der Kaiserpolitik Ottos des Großen
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kaiserpolitik Ottos des Großen und untersucht die Voraussetzungen, den Verlauf und die Erfolge seiner Herrschaft. Sie analysiert die historischen Bedingungen, die zu Ottos Kaiserkrönung führten, und beleuchtet die Herausforderungen und Erfolge seiner Politik im Kontext der Zeit.
- Die historische Entwicklung des Kaisertums im frühen Mittelalter
- Die Rolle der Kaiserkrönung Ottos I. in Rom
- Die Bedeutung der Kirchenprovinz Magdeburg für Ottos Politik
- Die Beziehungen zwischen Kaiser und Papst im 10. Jahrhundert
- Die Erfolge Ottos des Großen in der Sicherung der Grenzen und der Ausweitung seines Herrschaftsbereichs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert eine kurze Einführung in das Thema und beleuchtet die verschiedenen Anschauungen zur Kaiserkrönung Ottos I. Sie setzt die Kaiserkrönung Ottos in den Kontext des „Zweikaiserproblems" und erläutert die Bedeutung der Krönung für die weitere Entwicklung des Kaisertums.
Der Hauptteil befasst sich zunächst mit den Voraussetzungen der Kaiserpolitik Ottos des Großen. Hierbei werden die historischen Bedingungen, die zu Ottos Herrschaft führten, sowie die politische Situation im ostfränkischen Reich analysiert.
Im zweiten Teil des Hauptteils wird der Verlauf der Kaiserpolitik Ottos des Großen beleuchtet. Dieser Teil behandelt die Kaiserkrönung in Rom, die Beziehungen zu Rom und dem Papst, die Gründung der Kirchenprovinz Magdeburg und die Herausforderungen im Osten des Reiches.
Der dritte Teil des Hauptteils widmet sich den Erfolgen der Kaiserpolitik Ottos des Großen. Hier werden die Auswirkungen seiner Politik auf die Sicherung der Grenzen und die Ausweitung seines Herrschaftsbereichs betrachtet.
Schlüsselwörter
Kaiserkrönung, Otto der Große, Kaisertum, Papsttum, Kirchenprovinz Magdeburg, Lechfeld, Zweikaiserproblem, ostfränkisches Reich, Italien, Langobarden, Sachsen.
- Quote paper
- Melanie Möger (Author), 2005, Die Kaiserpolitik Ottos des Großen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161247