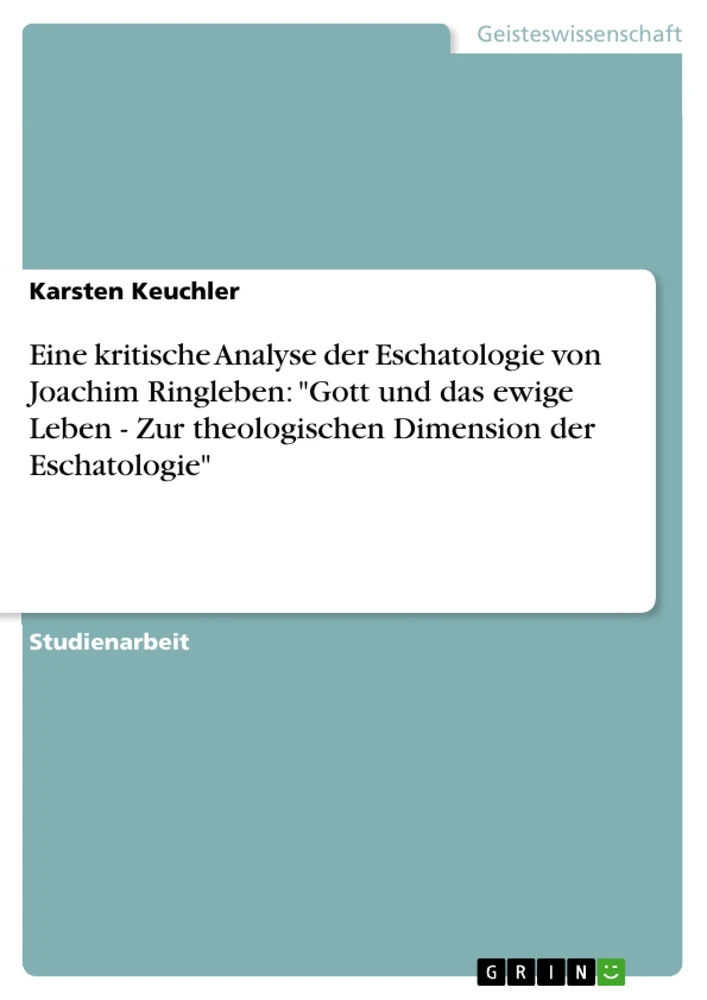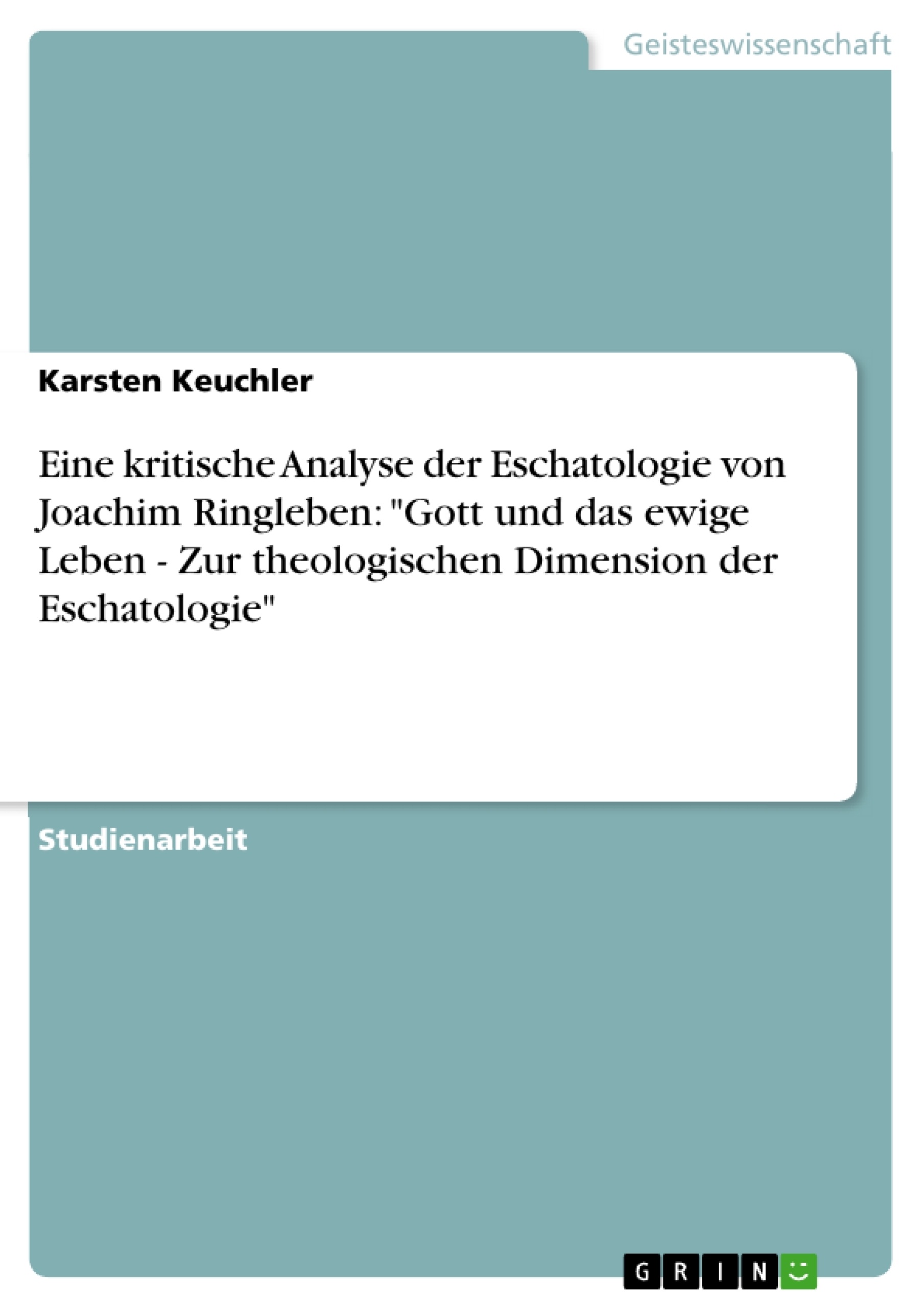Die Frage, was mit dem Menschen nach seinem Tod geschieht, ist so alt wie die Menschheit selbst. Und trotzdem gibt es dafür bisher keine sichere Antwort, obgleich die meisten an eine Art ewiges Überleben der menschlichen Seele zu glauben scheinen. Zu diesem Thema gibt es eine schier endlose Fülle an Auffassungen. Diese Arbeit wird sich jedoch ausschließlich mit dem theologischen Aspekt dieser Frage beschäftigen, so wie es vom Autor des zu behandelnden Texts, Joachim Ringleben, vorgegeben ist. In seinem Text "Gott und das Ewige Leben" kämpft er sich sprichwörtlich nicht nur durch die Zeilen der Bibel, insbesondere die des Neuen Testaments, sondern auch durch die Literatur großer Philosophen und Theologen wie Boethius, Barth und Luther, um zu einem eigenen Ergebnis zu kommen. Wer bei Ringleben einen gespannten Bogen zwischen religiösem Glauben und wissenschaftlicher Erkenntnis erwartet, den muss ich enttäuschen, da die absolute Voraussetzung zum Verständnis und zur Akzeptanz des Textes ganz klar zum Vorschein kommen. Für Ringleben hängt unser ewiges Leben einzig und allein von Gott ab. Sein Ansatz ist also ein Theozentrischer, seine Argumentation damit ganz von Gott hergeleitet. Dass damit der biblische Gott gemeint ist, verdeutlicht er, indem er im weiteren Verlauf seines Texts christologische Argumente anwendet. Um sich mit den Aussagen seines Texts vollkommen identifizieren zu können, ist also die persönliche Erkenntnis von Nöten, Gott als den Schöpfer, der lebendig alles in allem verkörpert, zu sehen und Jesus Christus als unseren Erretter, der den "neuen Bund" zwischen Gott und Menschheit repräsentiert, mit seinem Tod für die Vergebung unserer Sünden steht und uns somit als wahrer Gott und wahrer Mensch das ewige Leben schenkt und die Auferstehung der Toten zum ewigen Leben ankündigt. Ringleben versucht sich an einer Definition der "Ewigkeit", wobei er beabsichtigt, den Unterschied zu unserem zeitlichen Denken herauszustellen und er ist bemüht, uns nahe zu bringen als was bzw. wie man sich Gottes Leben vorzustellen hat. Nur als Teilhabe des Menschen daran sieht er die Möglichkeit unseres individuellen ewigen Lebens, dem wahren Leben, dass durch unseren Tod eingeleitet wird...
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Tod und Ewigkeit
- III. Gott und Ewigkeit
- III.1. Der Ewige und der Lebendige
- III.2. Gottes ewige Lebendigkeit
- IV. Unser ewiges Leben
- IV.1. Verhältnis Irdisches Leben & "Wahres" Leben
- IV.2. Verhältnis Tod & ewiges Leben
- IV.3. Gott & unsere Verewigung
- IV.4. "Ewige, schöpferische Erinnerung"
- IV.5. "Ewige, schöpferische Anrede"
- IV. 6. Unser individuelles Überleben
- V. Ewiges Leben durch Jesus Christus
- VI. Gott alles in allem
- VII. Kritische Reflexion über Ringlebens Verständnis zum Thema Gott und das ewige Leben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und kritisiert die theologischen Ansichten von Joachim Ringleben zum Thema Gott und das ewige Leben, wie sie in seinem Text "Gott und das Ewige Leben" dargestellt werden. Ringlebens Argumentation ist theozentrisch und basiert auf einer christlichen Interpretation der Bibel und der Werke bedeutender Philosophen und Theologen.
- Die Verbindung von Glauben und wissenschaftlicher Erkenntnis im Hinblick auf das ewige Leben.
- Die Konzeption des ewigen Lebens als Umkehrung des Zeitlichen und die Rolle des Todes als Wendepunkt.
- Die Beziehung zwischen Gottes ewiger Lebendigkeit und der Möglichkeit des menschlichen ewigen Lebens.
- Die Rolle Jesu Christi als Mittler zwischen Gott und Mensch und seine Bedeutung für das ewige Leben.
- Die kritische Auseinandersetzung mit Ringlebens Verständnis von Ewigkeit und dem Verhältnis von irdischem und ewigem Leben.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung des Textes vor: Was geschieht mit dem Menschen nach dem Tod? Ringlebens theologische Sichtweise auf das ewige Leben und sein Ansatz, der sich auf die Bibel, insbesondere das Neue Testament, sowie auf die Werke von Boethius, Barth und Luther stützt, werden skizziert. Die Bedeutung der christlichen Gottesvorstellung für die Akzeptanz des Textes wird betont.
II. Tod und Ewigkeit
In diesem Kapitel untersucht Ringleben die menschliche Vorstellung von Ewigkeit und ewiges Leben. Er kritisiert gängige Ansichten, die das ewige Leben als einfache Fortsetzung des irdischen Lebens verstehen oder die Ewigkeit als etwas getrennt von der Zeitlichkeit betrachten. Für Ringleben stellt der Tod einen Wendepunkt dar, der nicht das Ende, sondern den Beginn eines neuen, geisthafteren Lebens bedeutet. Die Ewigkeit setzt sich nach seiner Ansicht aus Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit zusammen, wobei die Zeit anders als in unserem irdischen Leben fließt.
III. Gott und Ewigkeit
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Verbindung von Gott und Ewigkeit. Die ewige Lebendigkeit Gottes und ihre Bedeutung für das menschliche ewige Leben stehen im Mittelpunkt. Die Beziehung zwischen irdischem Leben und "wahrem" Leben, der Tod und das ewige Leben sowie Gottes Rolle bei der Verewigung des Menschen werden erläutert.
IV. Unser ewiges Leben
Dieses Kapitel erörtert die verschiedenen Aspekte unseres ewigen Lebens. Es wird das Verhältnis zwischen irdischem Leben und "wahrem" Leben, zwischen Tod und ewiges Leben und zwischen Gott und unserer Verewigung betrachtet. Darüber hinaus werden Ringlebens Vorstellungen von der "ewigen, schöpferischen Erinnerung" und der "ewigen, schöpferischen Anrede" erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Textes sind Gott, Ewigkeit, Tod, Leben nach dem Tod, christliche Eschatologie, theozentrische Sichtweise, Jesus Christus, biblisches Verständnis, "wahres" Leben, Umkehrung der Zeit, Verewigung, schöpferische Erinnerung und schöpferische Anrede. Der Text befasst sich mit der Verbindung von Glauben und wissenschaftlicher Erkenntnis im Hinblick auf das ewige Leben und hinterfragt traditionelle Ansichten über die menschliche Existenz nach dem Tod.
- Citar trabajo
- Karsten Keuchler (Autor), 2004, Eine kritische Analyse der Eschatologie von Joachim Ringleben: "Gott und das ewige Leben - Zur theologischen Dimension der Eschatologie", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161023