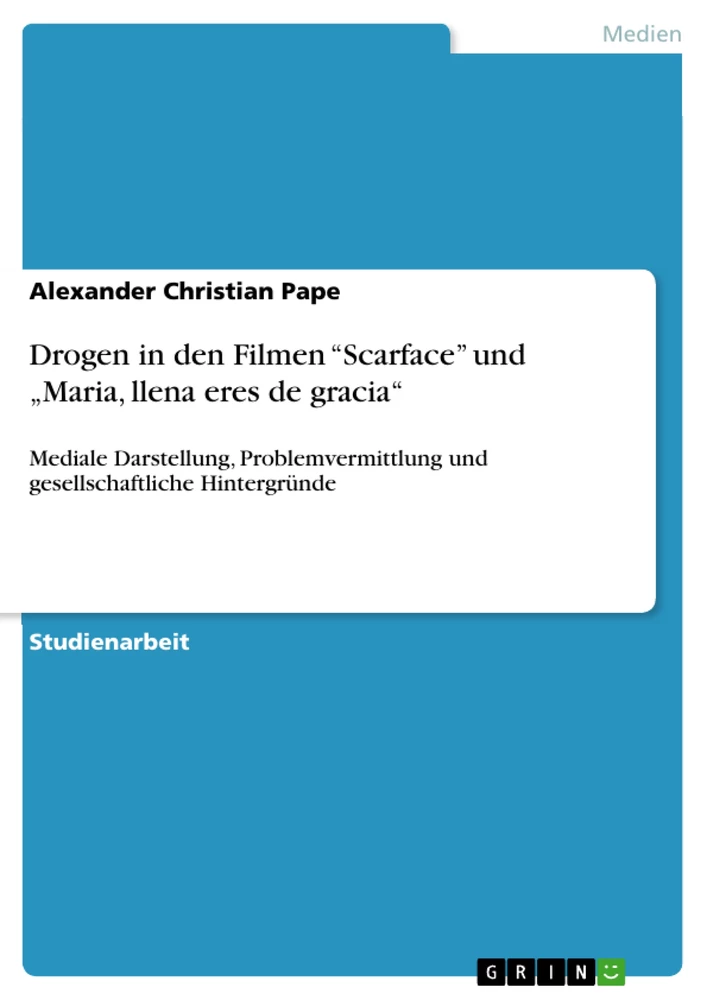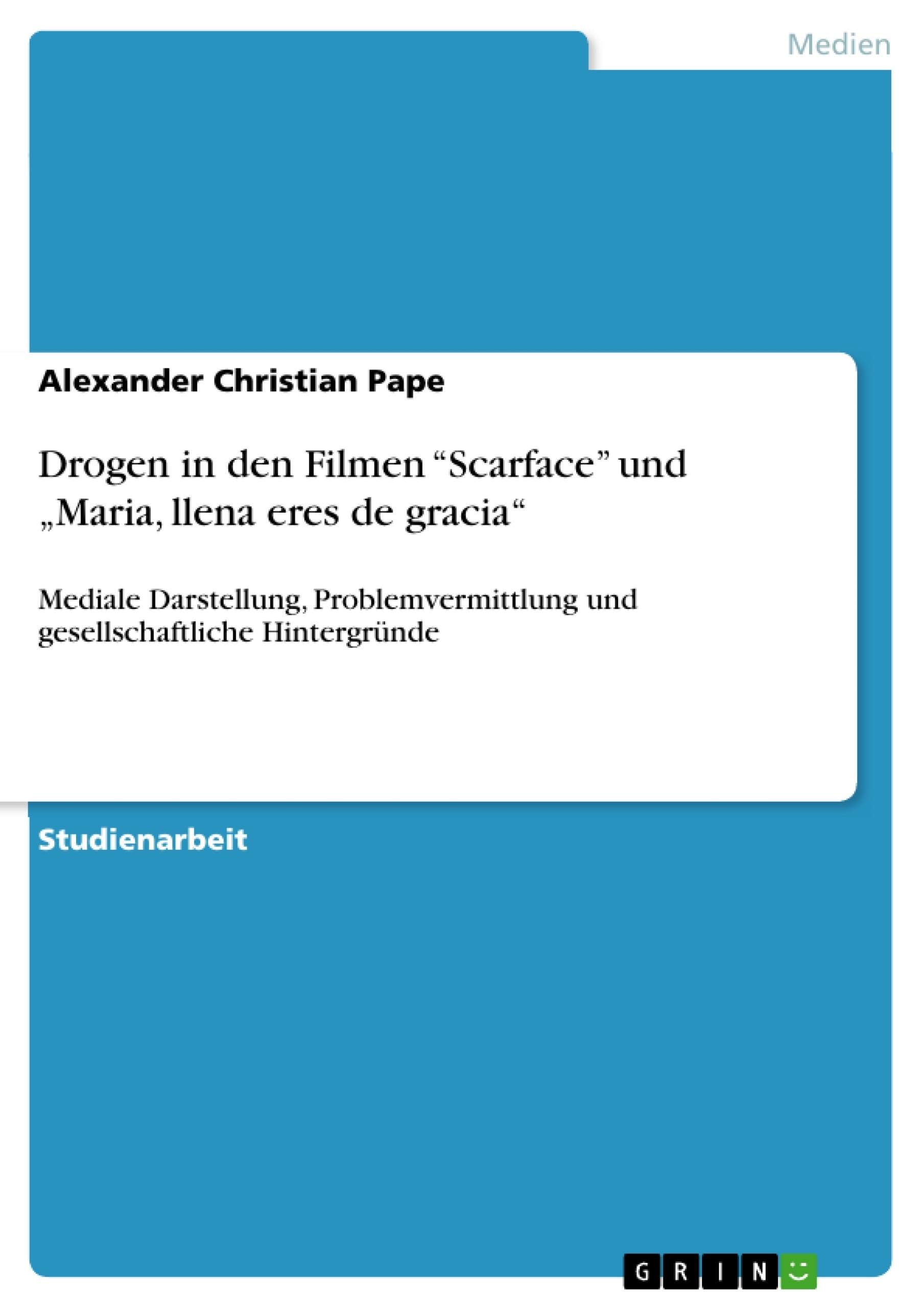Einleitung
Jeder Drogenkonsument hat seine eigene Geschichte. Der Kontakt des Einzelnen mit legalen oder illegalen Mitteln ist nur aus dem Kontext heraus verständlich. In welchem sozialen Umfeld befindet er sich, wer oder was hat ihn bisher geprägt, welche Ziele hat er für seinen persönlichen Werdegang? Was verspricht er sich von den Drogen? Ähnliches gilt für die Drogenproduzenten und die Personen, welche in irgendeiner Weise am Vertriebssystem teilnehmen. Diese Beweggründe stehen fast immer in einer Verbindung mit den gesellschaftlichen Bedingungen eines Landes oder einer Region, aber auch mit den politischen Strukturen der Drogenpolitik. [...] Das Prinzip der Eigenverantwortung des vermeintlich selbstständig denkenden Staatsbürgers der westlichen Länder bleibt somit weitgehend auf der Strecke. Scheinen auch die Rahmenbedingungen bei dieser Thematik selten und nur langsam Veränderungen unterworfen zu sein, ist ein spezieller Einflussfaktor auf die Drogenperzeption in besonderem Maße hervorzuheben: Die Macht der Medien, im speziellen die Macht der bewegten Bilder. Filme, sofern sie nicht indiziert oder gar verboten werden, die einem Massenpublikum zugänglich gemacht werden können, besitzen die Fähigkeit Blickwinkel zu verändern. [...] Sie können aber auch bestehende Klischees kolportieren durch die Visualisierung politisierter Drogenopfer und Rauschgifttäter aus bestimmten Milieus. Deshalb sollte sich dem Zuschauer bei der Analyse von Filmen, die die Drogenthematik aufgreifen, direkt die Frage stellen, welche Konstruktionsform gewählt worden ist und welche Botschaft möglicherweise vermittelt werden soll. Fast immer wird der Drogenkonsum als etwas Furchtbares und Schreckliches dargestellt werden. Regisseure, die eine andere Vorgehensweise bevorzugen, ernten häufig aus konservativen Kreisen der Gesellschaft Kritik. Anhand der zwei Spielfilme „Scarface“ von Brian de Palma und „Maria, llena eres de gracia“ von Joshua Marston werde ich die dargestellten Drogenproblematiken untersuchen. Hierfür beginne ich jeweils mit kurzen Inhaltsangaben, erläutere dann die historischen bzw. sozialen Hintergründe und beschreibe anschließend die Darstellungs- und Funktionsweise der Drogen im Film. Letztendlich werde ich auf die Hauptaussagen und Botschaften der Filme zu sprechen kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Meinungsbildung durch Bildereinsatz
- Scarface
- Inhalt
- Historischer Hintergrund
- Politisches Statement und gesellschaftskritische Aussage
- Inszenierung eines bildgewaltigen Abstiegs
- Das Wesen des Protagonisten im Zuge des Kokainkonsums
- Die Funktion der Droge im Film
- Maria, llena eres de gracia
- Inhalt
- Filmische Herangehensweise und Umsetzung
- Grundsatzproblematik der Machtverhältnisse und sozialen Ursachen
- Verwendung und Funktionalität der Droge
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die mediale Darstellung von Drogenproblemen in den Filmen "Scarface" und "Maria, llena eres de gracia". Ziel ist es, die jeweilige Problemvermittlung und die gesellschaftlichen Hintergründe zu analysieren und die unterschiedlichen filmischen Strategien zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Filmen auf die Meinungsbildung zum Thema Drogenkonsum.
- Mediale Darstellung von Drogenkonsum
- Gesellschaftliche Hintergründe des Drogenkonsums
- Filmische Strategien der Problemvermittlung
- Einfluss von Filmen auf die Meinungsbildung
- Vergleichende Analyse zweier unterschiedlicher Filmdarstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung des sozialen Kontextes beim Drogenkonsum. Sie hebt die Rolle gesellschaftlicher Bedingungen und politischer Strukturen hervor und diskutiert die Wandelbarkeit der Definition von „Drogen“ im Laufe der Zeit. Der Einfluss der Medien, insbesondere des Films, auf die Drogenperzeption wird als zentraler Aspekt herausgestellt, wobei Filme sowohl soziale Strukturen kritisieren als auch Klischees reproduzieren können. Die Arbeit fokussiert sich auf die Analyse von "Scarface" und "Maria, llena eres de gracia" um diese Aspekte zu untersuchen.
Meinungsbildung durch Bildereinsatz: Dieses Kapitel analysiert die Wirkung filmischer Darstellungen von Drogenkonsum auf die Meinungsbildung. Es wird gezeigt, wie verschiedene Drogen mit spezifischen sozialen Klassen und Lebensweisen assoziiert werden (Alkohol mit dem sozialen Abstieg, Heroin mit dem totalen Verfall, Marihuana mit Fröhlichkeit und Kokain mit dem Leben der Reichen). Der Film wird als besonders wirkmächtiges Medium zur Prägung kollektiver Vorstellungen über Drogen identifiziert.
Scarface: Dieser Abschnitt beginnt mit einer Inhaltsangabe des Films "Scarface" (1983). Es folgt eine Analyse des historischen Hintergrundes und der politischen sowie gesellschaftskritischen Aussage des Films. Besonders im Fokus steht die Darstellung des Protagonisten Tony Montana und sein Abstieg durch den Kokainkonsum. Der Abschnitt untersucht, wie die Droge im Film funktioniert, welche Rolle sie für die Handlung spielt, und welche Botschaft der Film letztendlich vermittelt. Der Aufstieg und Fall des Protagonisten wird im Kontext des Miami der frühen 80er Jahre und der US-amerikanischen Drogenpolitik betrachtet.
Maria, llena eres de gracia: Dieser Abschnitt bietet eine Inhaltsangabe und eine Analyse des Films "Maria, llena eres de gracia". Die filmische Herangehensweise und Umsetzung werden ebenso betrachtet wie die Problematik der Machtverhältnisse und sozialen Ursachen, die zum Drogenkonsum führen. Im Zentrum steht die Analyse der Verwendung und Funktionalität der Droge im Film und der daraus resultierenden Aussage des Films, im Kontext der sozialen und politischen Realität Kolumbiens.
Schlüsselwörter
Drogen, Film, Mediale Darstellung, Meinungsbildung, "Scarface", "Maria, llena eres de gracia", Gesellschaftliche Hintergründe, Drogenpolitik, Kokain, soziale Strukturen, Klischees, Problemvermittlung, visuelle Projektionskraft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der medialen Darstellung von Drogenproblemen in "Scarface" und "Maria, llena eres de gracia"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert die mediale Darstellung von Drogenproblemen in den Filmen "Scarface" und "Maria, llena eres de gracia". Sie untersucht die jeweilige Problemvermittlung, die gesellschaftlichen Hintergründe und vergleicht die unterschiedlichen filmischen Strategien. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss der Filme auf die Meinungsbildung zum Thema Drogenkonsum.
Welche Filme werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die detaillierte Analyse von Brian De Palmas "Scarface" (1983) und Joshua Marshs "Maria, llena eres de gracia". Beide Filme werden im Hinblick auf ihre Darstellung von Drogenkonsum und dessen gesellschaftlichen Kontext untersucht.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die mediale Darstellung von Drogenkonsum in den beiden Filmen zu analysieren und zu vergleichen. Sie untersucht die gesellschaftlichen Hintergründe des Drogenkonsums, die filmischen Strategien der Problemvermittlung und den Einfluss der Filme auf die Meinungsbildung. Der Vergleich der beiden Filme soll die unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema verdeutlichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Mediale Darstellung von Drogenkonsum, gesellschaftliche Hintergründe des Drogenkonsums, filmische Strategien der Problemvermittlung, Einfluss von Filmen auf die Meinungsbildung und vergleichende Analyse zweier unterschiedlicher Filmdarstellungen. Dabei wird auch der Einfluss von Bildsprache auf die Meinungsbildung analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Meinungsbildung durch Bildereinsatz, Kapitel zur Analyse von "Scarface" und "Maria, llena eres de gracia" und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel enthält eine detaillierte Analyse des jeweiligen Films und seiner Botschaft.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in die Thematik ein, betont den sozialen Kontext von Drogenkonsum und die Rolle gesellschaftlicher Bedingungen und politischer Strukturen. Sie diskutiert die Wandelbarkeit der Definition von "Drogen" und den Einfluss der Medien, insbesondere des Films, auf die Drogenperzeption. Die Bedeutung des sozialen Kontextes beim Drogenkonsum wird hervorgehoben.
Was wird im Kapitel zur Meinungsbildung durch Bildereinsatz analysiert?
Dieses Kapitel untersucht die Wirkung filmischer Darstellungen von Drogenkonsum auf die Meinungsbildung. Es wird gezeigt, wie verschiedene Drogen mit sozialen Klassen und Lebensweisen assoziiert werden und die besondere Wirkmacht des Films als Medium zur Prägung kollektiver Vorstellungen über Drogen hervorgehoben.
Wie wird "Scarface" analysiert?
Der Abschnitt zu "Scarface" enthält eine Inhaltsangabe, eine Analyse des historischen Hintergrunds und der politischen/gesellschaftskritischen Aussage des Films. Im Fokus steht die Darstellung des Protagonisten Tony Montana und sein Abstieg durch den Kokainkonsum. Die Funktion der Droge im Film und die Botschaft des Films werden untersucht. Der Aufstieg und Fall des Protagonisten wird im Kontext des Miami der frühen 80er Jahre und der US-amerikanischen Drogenpolitik betrachtet.
Wie wird "Maria, llena eres de gracia" analysiert?
Der Abschnitt zu "Maria, llena eres de gracia" beinhaltet eine Inhaltsangabe und eine Analyse der filmischen Herangehensweise und Umsetzung. Die Problematik der Machtverhältnisse und sozialen Ursachen, die zum Drogenkonsum führen, wird betrachtet. Die Verwendung und Funktionalität der Droge im Film und die daraus resultierende Aussage werden im Kontext der sozialen und politischen Realität Kolumbiens analysiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Drogen, Film, Mediale Darstellung, Meinungsbildung, "Scarface", "Maria, llena eres de gracia", Gesellschaftliche Hintergründe, Drogenpolitik, Kokain, soziale Strukturen, Klischees, Problemvermittlung, visuelle Projektionskraft.
- Quote paper
- Alexander Christian Pape (Author), 2010, Drogen in den Filmen “Scarface” und „Maria, llena eres de gracia“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160968