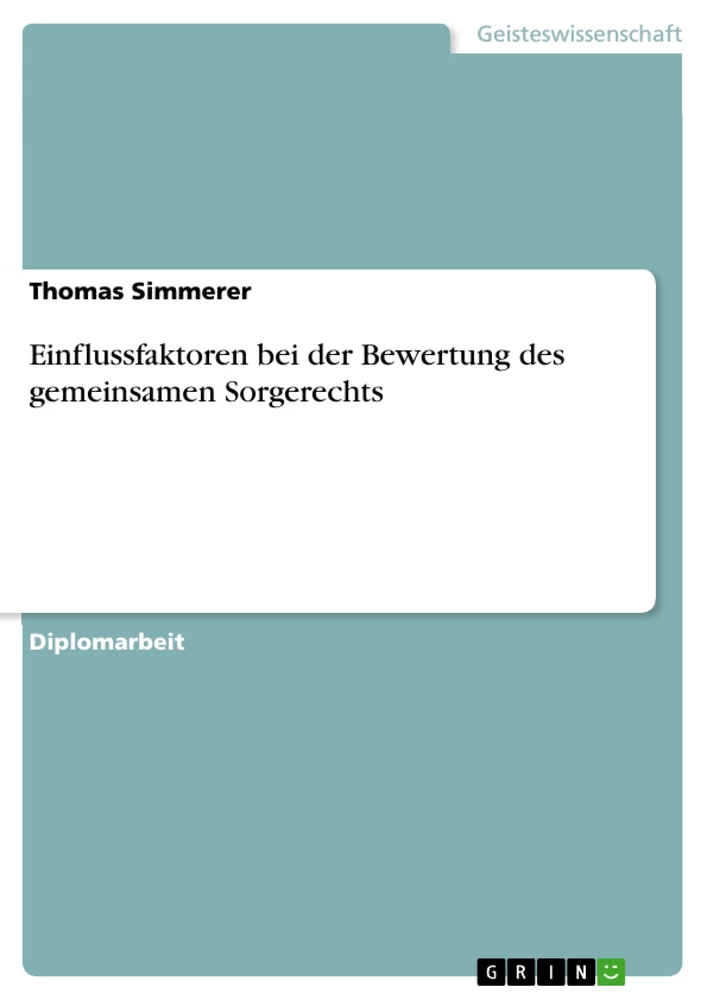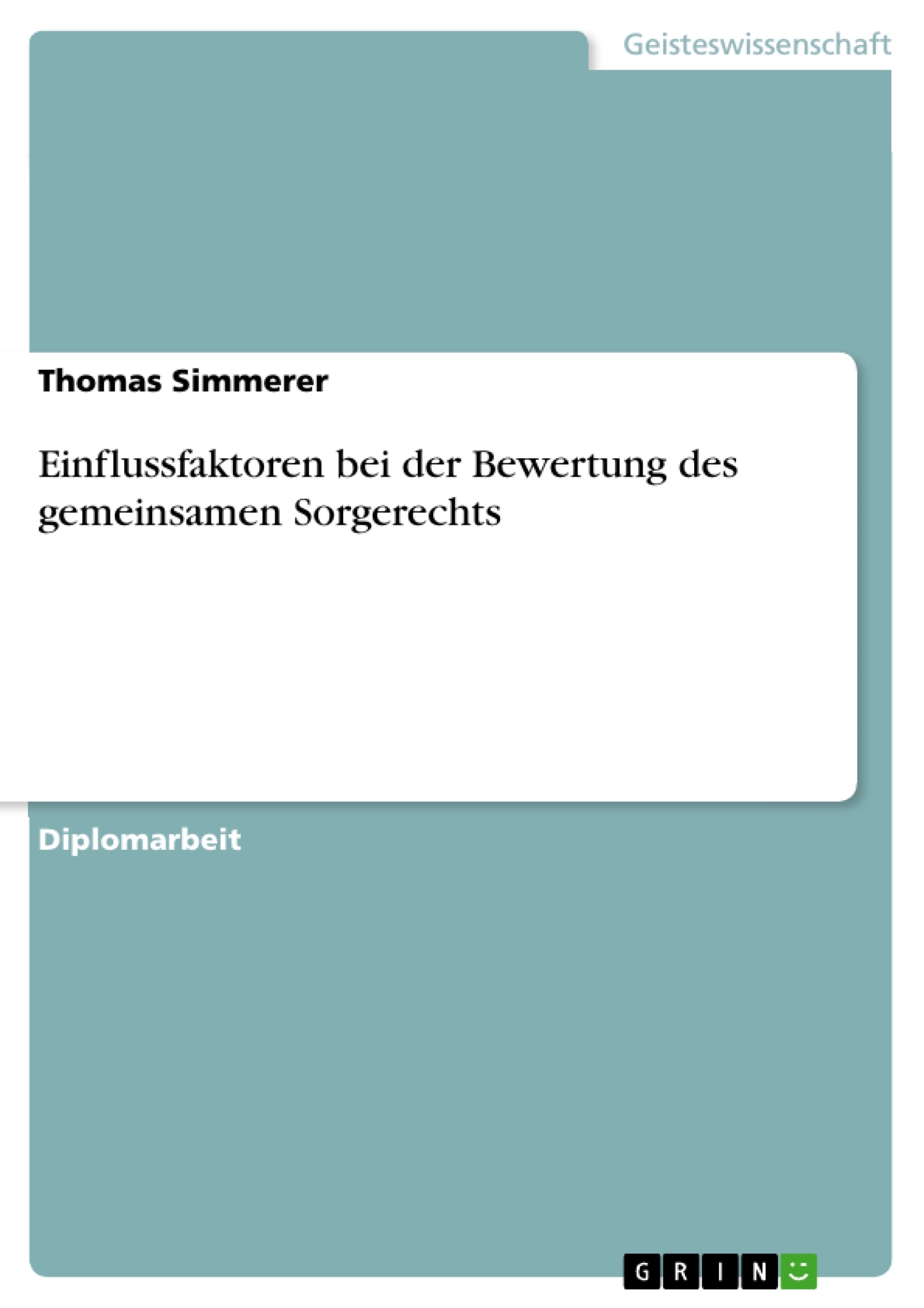Diese Diplomarbeit wurde durch die Implementierung des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 angeregt. Es soll beschrieben werden, welche Aufgaben den beiden Elternteilen zukommen, zu welchen Problemen es durch das Fehlen eines Elternteils kommt und wie sich unterschiedliche Sorgerechtsformen auf die Anpassung und das Wohlbefinden der Kinder auswirken.
In der Praxis zeigten sich einige Vor- sowie Nachteile des Sorgerechts beider Elternteile. Es zeigte sich, dass einige Elternteile durchaus zufrieden mit dieser Regelung sind, andere hingegen sind es weniger wieder andere sind nicht zufrieden. Die sich hier aufdrängende Fragestellung lautet nun, auf welche Faktoren es zurückzuführen ist, ob die Beibehaltung des Sorgerechts beider Elterneile von diesen „hoch“ bzw. „niedrig“ oder „positiv“ bzw. „negativ“ bewertet wird.
In diesem Zusammenhang wurde angestrebt, Einflussfaktoren zu ermitteln, die auf die Bewertung der gemeinsamen Obsorge eine Wirkung ausüben. Als mögliche Einflussfaktoren wurden demografische Faktoren sowie die co-elterliche Interaktion, die Einstellungen, die psychosoziale Situation, die Beziehung zwischen Kind und Elternteil, der Konfliktlösungsstil und die Persönlichkeit des Kindes als unabhängige Variablen definiert.
Um diese Faktoren zu erheben, wurden drei Fragebögen vorgegeben. Diese waren FAGS – Fragebogen zur Analyse des gemeinsamen Sorgerechts nach Scheidung oder Trennung (Stupka, 2002), KLSE – Fragebogen zu Konfliktlösungsstilen im Elternhaus (Böhm, 1993) und FFFK - Fünf-Faktoren-Fragebogen für Kinder (Asendorpf, 1998). Um die Stichprobe zu rekrutieren, wurden diese Fragebögen als Internetseiten erstellt. Dadurch wurde es möglich, die entsprechenden Antworten auf die Fragen der Fragebögen online zu geben. Ein Link zu diesem Fragebogen wurde in zahlreichen inhaltlich entsprechenden Online-Foren gepostet. Um die Stichprobe zu vergrößern, wurde der Fragebogen auch in einer Papier und Bleistift Form verteilt. Der Großteil der 62 Teilenehmer dieser Studie konnte allerdings über das Internet rekrutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindeswohl und Sorgerecht
- Wohl des Kindes – Versuch einer Definition
- Der Begriff des „Kindeswohls" im juristischen Sinn
- Sorgerechtsformen
- Erwartungen an die gemeinsame Obsorge in Österreich
- Pro und kontra für das Sorgerecht beider Elternteile
- Erkenntnisse der Bindungstheorie
- Der Begriff Bindung
- Bindung und Sorgerecht
- Erkenntnisse der Scheidungs- und Sorgerechtsforschung
- Trennungsprozess
- Beziehung zum Vater
- Folgen der Scheidung
- Langzeitfolgen
- Folgen der Scheidung auf drei Ebenen (individuelle, familiale, soziale)
- Individuelle Ebene
- Bedeutung der Scheidung für das Kind
- Schulleistungen
- Sozialverhalten
- Selbstwert
- Familiale Ebene
- Auswirkung elterlicher Konflikte
- Qualität der Beziehung zwischen Kind und nicht betreuendem Elternteil
- Soziale Ebene
- Individuelle Ebene
- Stresserleben und Coping bei Kritischen Familienereignissen (Dettenborn & Walter, 2002)
- Methodik
- UntersuchungsTeilnehmerInnen
- Untersuchungsplan
- Hypothesen
- Untersuchungsmaterialien
- FAGS
- KLSE
- FFFK
- Untersuchungsdurchführung
- Auswertung der Fragebögen
- Ergebnisse
- Explorative Datenanalyse
- Logistische Regressionsanalyse
- Vergleich der Skalenwerte dieser Erhebung mit derjenigen von Stupka (2002)
- Testung der Hypothsen
- Mittelwertsvergleiche
- Erstellung des AMOS-Modells
- Interpretation
- Diskussion und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Sorgerechtsformen auf die Anpassung und das Wohlbefinden von Kindern nach einer Scheidung oder Trennung. Die Studie analysiert den Einfluss verschiedener Konfliktlösungsstile auf die Bewertung des Sorgerechts beider Elternteile und betrachtet zudem den Einfluss von Persönlichkeitsvariablen des Kindes auf die Bewertung der Elternteile.
- Das Wohl des Kindes im Kontext von Scheidung und Trennung
- Der Einfluss verschiedener Sorgerechtsformen auf die Anpassung und das Wohlbefinden von Kindern
- Die Rolle von Konfliktlösungsstilen in der Nachscheidungssituation
- Die Bedeutung von Persönlichkeitsvariablen des Kindes für die Bewertung der Elternteile
- Die Relevanz der gemeinsamen Obsorge und deren Auswirkungen auf das Kindeswohl
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung legt die Grundlage für die Diplomarbeit, indem sie die Relevanz der Thematik im Kontext der hohen Scheidungsraten und der damit verbundenen Auswirkungen auf Kinder beleuchtet. Im zweiten Kapitel wird das Kindeswohl und die verschiedenen Sorgerechtsformen definiert und im österreichischen Kontext betrachtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit Erkenntnissen der Bindungstheorie und deren Relevanz für das Sorgerecht. Die Erkenntnisse der Scheidungs- und Sorgerechtsforschung werden im vierten Kapitel präsentiert, wobei der Fokus auf den Trennungsprozess und die Beziehung zum Vater liegt. Kapitel fünf untersucht die Folgen der Scheidung auf individueller, familialer und sozialer Ebene. Die Methodik der Studie wird im sechsten Kapitel beschrieben, während das siebte Kapitel den Untersuchungsplan, die Hypothesen und die verwendeten Untersuchungsmaterialien präsentiert. Die Durchführung der Untersuchung und die Auswertung der Fragebögen werden in den Kapiteln acht und neun beleuchtet. Im zehnten Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Studie präsentiert und interpretiert. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt im elften Kapitel, während das zwölfte Kapitel die Diskussion und Kritik der Studienergebnisse beinhaltet.
Schlüsselwörter
Kindeswohl, Sorgerecht, gemeinsame Obsorge, Scheidung, Trennung, Bindungstheorie, Konfliktlösungsstil, Persönlichkeitsvariablen, Anpassung, Wohlbefinden, empirische Studie.
- Quote paper
- Mag. Thomas Simmerer (Author), 2005, Einflussfaktoren bei der Bewertung des gemeinsamen Sorgerechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160455