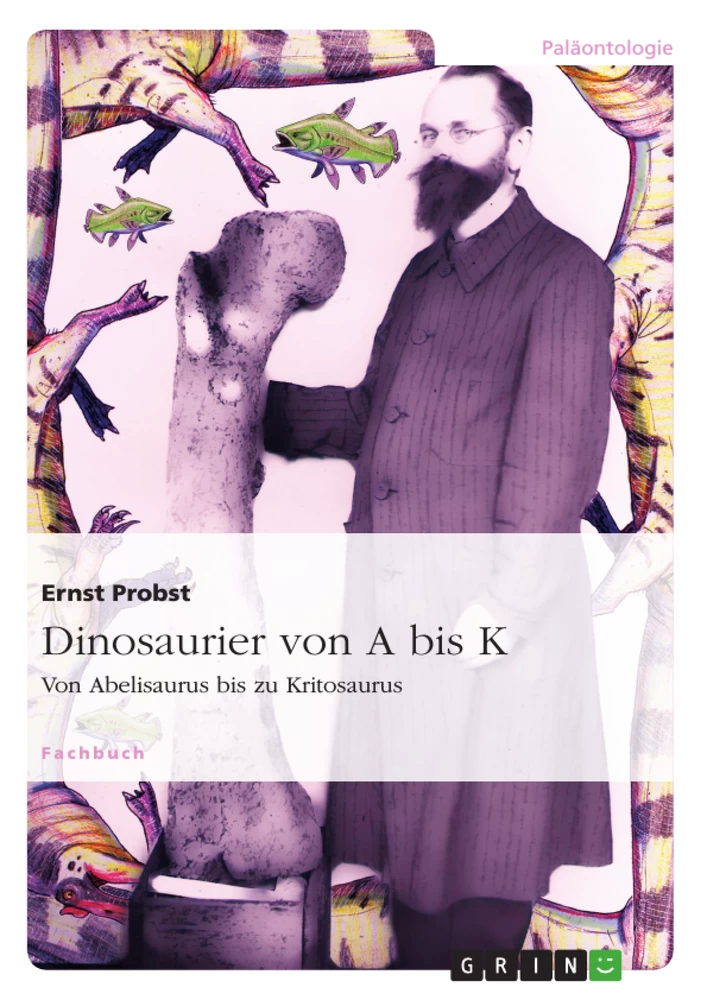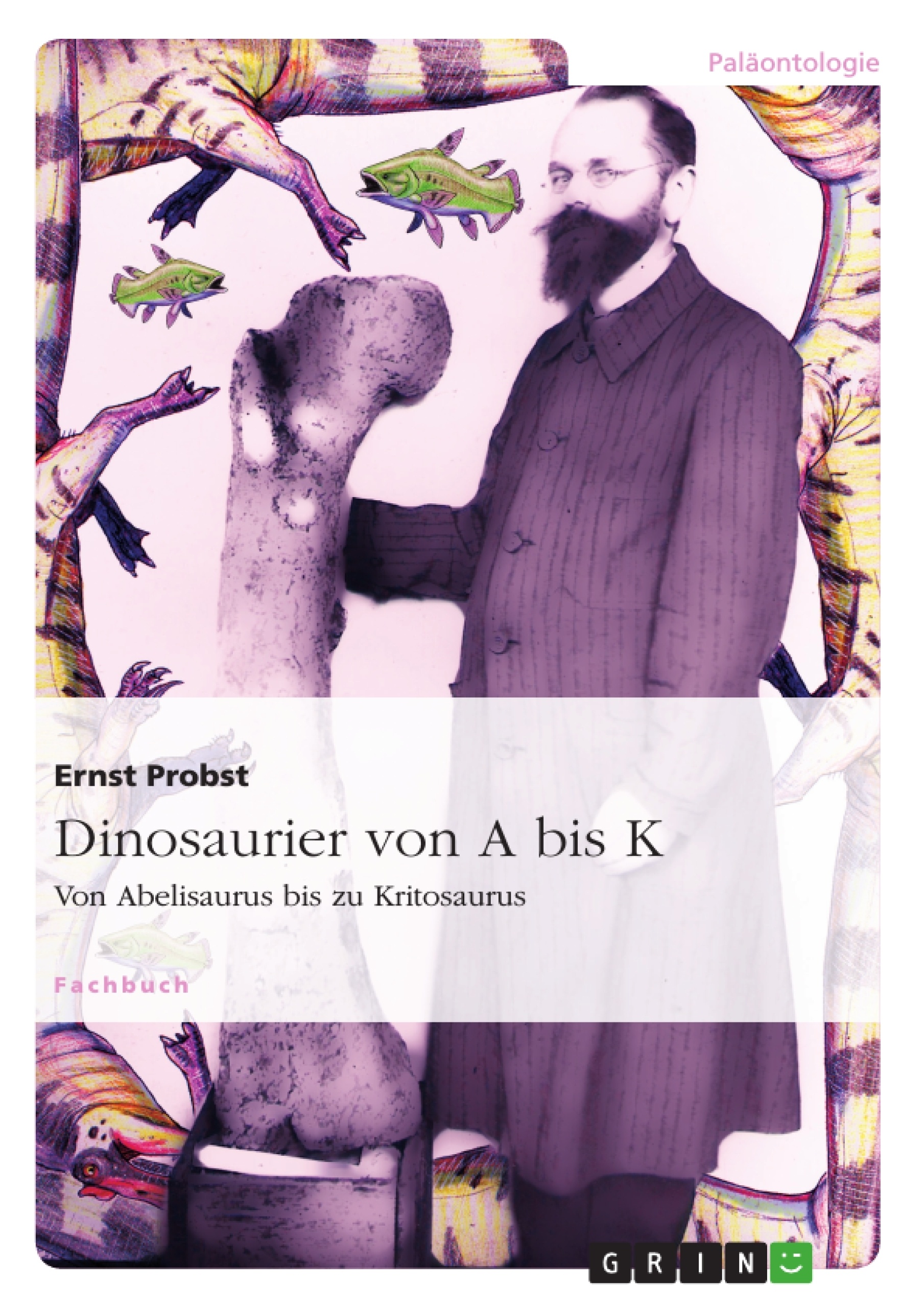Dinosaurier von A bis K werden in dem gleichnamigen Taschenbuch des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst vorgestellt. Bei jeder Dinosaurier-Gattung erfährt man, worauf deren wissenschaftlicher Name beruht. Es folgen Angaben über die Größe, das zeitliche und geographische Vorkommen, die systematische Stellung und über die wissenschaftliche Erstbeschreibung. „Dinosaurier von A bis K“ beschreibt die wichtigsten Gattungen der „schrecklichen Echsen von Abelisaurus bis zu Kritosaurus. Über „Dinosaurier von L bis Z“ informiert ein zweiter Band. Ernst Probst hat sich durch zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher einen Namen gemacht. Bekannte Werke aus seiner Feder sind: „Deutschland in der Urzeit“, „Rekorde der Urzeit“, „Dinosaurier in Deutschland“ (letzterer Titel zusammen mit Raymund Windolf), „Der Ur-Rhein“, „Der Rhein-Elefant“, „Deutschland im Eiszeitalter“, „Der Mosbacher Löwe“ „Höhlenlöwen“, „Säbelzahnkatzen“, „Der Höhlenbär“, „Monstern auf der Spur“, „Nessie“, „Affenmenschen“ und „Seeungeheuer“.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abelisaurus
- Abrictosaurus
- Abydosaurus
- Achillesaurus
- Achillobator
- Acrocanthosaurus
- Adasaurus
- Aegyptosaurus
- Aeolosaurus
- Afrovenator
- Agustinia
- Alamosaurus
- Alaskacephale
- Albertaceratops
- Albertonykus
- Albertosaurus
- Alectrosaurus
- Alioramus
- Allosaurus
- Alvarezsaurus
- Alxasaurus
- Amargasaurus
- Ammosaurus
- Ampelosaurus
- Amurosaurus
- Anchiceratops
- Anchiornis
- Anchisaurus
- Andesaurus
- Ankylosaurus
- Anserimimus
- Antarctosaurus
- Apatosaurus
- Archaeoceratops
- Archaeornithoides
- Archaeornithomimus
- Argentinosaurus
- Argyrosaurus
- Aristosuchus
- Arrhinoceratops
- Astrodon
- Atlassaurus
- Atrociraptor
- Aucasaurus
- Auroraceratops
- Austroraptor
- Austrosaurus
- Avaceratops
- Avimimus
- Bactrosaurus
- Bagaceratops
- Bagaraatan
- Bahariasaurus
- Bambiraptor
- Banji
- Barapasaurus
- Barosaurus
- Barsboldia
- Baryonyx
- Becklespinax
- Beipiaosaurus
- Beishanlong
- Bellusaurus
- Blikanasaurus
- Borogovia
- Brachiosaurus
- Brachyceratops
- Brachylophosaurus
- Brachytrachelopan
- Brevibaropus
- Buitreraptor
- Byronosaurus
- Caenagnathasia
- Camarasaurus
- Camptosaurus
- Carcharodontosaurus
- Carnotaurus
- Cathartesaura
- Caudipteryx
- Cedarosaurus
- Centrosaurus
- Cerasinops
- Ceratops
- Ceratosaurus
- Cetiosauriscus
- Cetiosaurus
- Charonosaurus
- Chasmosaurus
- Chialingosaurus
- Chilantaisaurus
- Chirostenotes
- Chubutisaurus
- Citipati
- Coelophysis
- Coelurus
- Colepiocephale
- Coloradia
- Compsognathus
- Conchoraptor
- Corythosaurus
- Craterosaurus
- Cryolophosaurus
- Dacentrurus
- Daspletosaurus
- Deinocheirus
- Deinonychus
- Deltadromeus
- Diamantinasaurus
- Dicraeosaurus
- Dilophosaurus
- Diplodocus
- Dracopelta
- Draxorex
- Dracovenator
- Dravidosaurus
- Drinker
- Dromaeosaurus
- Dromiceiomimus
- Dryosaurus
- Dryptosaurus
- Edmontonia
- Edmontosaurus
- Efraasia
- Elaphrosaurus
- Elephantopoides
- Elmisaurus
- Emausaurus
- Enigmosaurus
- Eocarcharia
- Eoraptor
- Eotyrannus
- Epachthosaurus
- Erecotopus
- Erliansaurus
- Erlikosaurus
- Euhelopus
- Euoplocephalus
- Europasaurus
- Euskelosaurus
- Eustreptospondylus
- Fabrosaurus
- Falcarius
- Fukuiraptor
- Gallimimus
- Gargoyleosaurus
- Garudimimus
- Gasosaurus
- Gastonia
- Genyodectes
- Gigantosauropus
- Giganotosaurus
- Gilmoreosaurus
- Gobisaurus
- Gondwanatitan
- Gongbusaurus
- Goyocephale
- Graciliceratops
- Graciliraptor
- Gresslyosaurus
- Guaibasaurus
- Guanlong
- Hadrosaurus
- Hagryphus
- Halticosaurus
- Hanssuesia
- Haplocanthosaurus
- Haplocheirus
- Harpymimus
- Herrerasaurus
- Hesperonychus
- Hesperosaurus
- Heterodontosaurus
- Heyuannia
- Homalocephale
- Huayangosaurus
- Hulsanpes
- Hylaeosaurus
- Hypacrosaurus
- Hypselosaurus
- Hypsilophodon
- Iguanodon
- Iliosuchus
- Incisivosaurus
- Indosaurus
- Indosuchus
- Ingenia
- Irritator
- Isanosaurus
- Itemirus
- Jainosaurus
- Janenschia
- Jiangshanosaurus
- Jobaria
- Juravenator
- Kakuru
- Kangnasaurus
- Kentrosaurus
- Khaan
- Kritosaurus
- Was ist ein Dinosaurier?
- Wie die Dinosaurier zu ihrem Namen kamen
- Der Autor
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Taschenbuch „Dinosaurier von A bis K“ von Ernst Probst hat zum Ziel, einen umfassenden Überblick über ausgewählte Dinosauriergattungen zu geben. Es bietet Informationen zur wissenschaftlichen Namensgebung, Größe, geographischem und zeitlichem Vorkommen, systematischer Stellung und Erstbeschreibung. Der Fokus liegt auf einer leicht verständlichen Darstellung für ein breiteres Publikum.
- Wissenschaftliche Namensgebung von Dinosauriern
- Vielfalt der Dinosaurierarten
- Geographische Verbreitung und zeitliche Einordnung
- Systematische Klassifizierung und Verwandtschaftsbeziehungen
- Paläontologische Fundgeschichte und Forschungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Abelisaurus: Der Text beschreibt Abelisaurus, einen Theropoden aus der Oberen Kreidezeit Argentiniens, anhand seines gefundenen Schädels. Die Besonderheiten des Schädels, wie der rundliche Aufbau und die relativ kleinen Zähne, werden detailliert erläutert. Die Bedeutung des Namens und die Schwierigkeiten der Rekonstruktion aufgrund fehlender Skelettteile werden hervorgehoben. Die Einordnung in die Familie der Abelisauridae und die Verwandtschaftsverhältnisse zu anderen Theropoden werden diskutiert.
Abrictosaurus: Abrictosaurus, ein Ornithopode aus der Unteren Jurazeit Südafrikas, ist hauptsächlich durch einen Schädelfund bekannt. Der Text vergleicht ihn mit Heterodontosaurus und diskutiert die Möglichkeit, dass es sich um ein weibliches Exemplar dieser Gattung handeln könnte. Die Anpassungen an trockene und feuchte Jahreszeiten sowie die Hypothese eines Sommerschlafs werden erläutert. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Thulborn wird erwähnt.
Abydosaurus: Der Sauropode Abydosaurus aus der Unteren Kreidezeit Utahs ist bemerkenswert für seine gut erhaltenen Schädelfunde, was bei Sauropoden eher selten ist. Der Text beschreibt die Schädelanatomie im Detail, inklusive Zahnstruktur und -anzahl. Der Gattungsname wird in Bezug auf die ägyptische Stadt Abydos erklärt. Die systematische Einordnung als Schwestergattung von Brachiosaurus wird hervorgehoben. Die Seltenheit vollständiger Schädelfunde bei Sauropoden wird betont.
Achillesaurus: Achillesaurus, ein Alvarezsauride aus der Oberen Kreidezeit Argentiniens, ist durch einen Teilskelettfund bekannt. Der Text konzentriert sich auf die Namensgebung in Bezug auf die Achillesferse des griechischen Helden und die Bedeutung der kurzen Arme. Die Einordnung in die Alvarezsauridae und die geschätzte Körpermasse werden erläutert. Die Unterstützung der Forschung durch Professor Manazzone wird erwähnt.
Achillobator: Der Dromaeosauride Achillobator aus der Oberen Kreidezeit der Mongolei wird anhand seines einzigartigen und unvollständigen Skelettfunds beschrieben. Der Text diskutiert die Namensgebung (Achilles-Held), die Größe im Vergleich zu anderen Dromaeosauriden, sowie die Kontroverse um die mögliche Chimären-Natur des Fundes. Die Verwandtschaftsbeziehungen zu Utahraptor und Dromaeosaurus werden diskutiert.
Acrocanthosaurus: Acrocanthosaurus, ein großer Allosauroide aus der Unteren Kreidezeit Nordamerikas, wird anhand mehrerer Funde (inklusive des Skeletts „Fran“) präsentiert. Der Text betont die hohen Dornfortsätze der Rückenwirbel und das vermutete Hautsegel. Die Zuschreibung von Dinosaurierspuren und die Hypothese, dass Acrocanthosaurus den Elefantenfuß-Dinosauriern folgte, werden erläutert. Die Bedeutung der Glen-Rose-Spuren wird erwähnt.
Adasaurus: Der Dromaeosauride Adasaurus aus der Oberen Kreidezeit der Mongolei wird aufgrund seiner geringen Bekanntheit und des spärlichen Fossilmaterials kurz beschrieben. Der Text konzentriert sich auf die Namensgebung, die Besonderheiten der zweiten Zehe und die Einordnung in die Dromaeosauridae.
Aegyptosaurus: Aegyptosaurus, ein Titanosaurier aus der Oberen Kreidezeit Ägyptens, ist hauptsächlich durch Funde bekannt, die leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Der Text beschreibt die geschätzte Größe und das Gewicht, den Körperbau und die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Stromer. Der Verlust der Fossilien wird bedauert.
Aeolosaurus: Aeolosaurus, ein Titanosaurier aus der Oberen Kreidezeit Argentiniens, wird anhand mehrerer Funde beschrieben, die jedoch keine vollständige Rekonstruktion des Tieres erlauben. Der Text erläutert die Namensgebung in Bezug auf den griechischen Gott der Winde und die Möglichkeit einer Panzerung. Die Einordnung in die Titanosauria wird erwähnt.
Afrovenator: Afrovenator, ein Megalosauride aus der Unteren Kreidezeit des Niger, wird anhand eines relativ vollständigen Skelettfunds beschrieben. Der Text betont die Bedeutung dieses Fundes für das Verständnis von Theropoden in Afrika und die anfängliche Schwierigkeit bei seiner systematischen Einordnung.
Agustinia: Agustinia, ein Titanosaurier aus der Unteren Kreidezeit Argentiniens, ist durch unvollständige Fossilien bekannt, die Hautplatten aufweisen. Der Text hebt die Namensgebung zu Ehren von Agustin Martinelli hervor und diskutiert die Schwierigkeiten der systematischen Einordnung aufgrund der unvollständigen Fossilien. Die Ähnlichkeiten mit Diplodociden und Lithostrotia werden erwähnt.
Alamosaurus: Alamosaurus, ein Titanosaurier aus der Oberen Kreidezeit Nordamerikas, wird als einer der letzten Sauropoden vor dem Massenaussterben beschrieben. Der Text erwähnt seine potenziellen Feinde wie Deinosuchus und beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Gilmore. Das Fehlen von Schädelfunden wird hervorgehoben.
Alaskacephale: Alaskacephale, ein Pachycephalosaurier aus der Oberen Kreidezeit Alaskas, ist lediglich durch einen Schädelknochen (Schuppenbein) bekannt. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Sullivan und hebt die Besonderheiten des Schuppenbeins hervor.
Albertaceratops: Albertaceratops, ein Centrosaurine aus der Oberen Kreidezeit Nordamerikas, wird anhand seiner Schädelmerkmale (Nasenkamm, Hörner, Nackenschild) beschrieben. Der Text erwähnt die Fundgeschichte und die Namensgebung zu Ehren von Cecil Nesmo. Die frühere Bezeichnung als Medusaceratops wird erwähnt.
Albertonykus: Albertonykus, ein Alvarezsauride aus der Oberen Kreidezeit Nordamerikas, gilt als der kleinste bekannte Dinosaurier Nordamerikas. Der Text beschreibt den Fundort, die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Longrich und Currie, sowie die Hypothese über seine insektenfressende Lebensweise. Die Bedeutung des „Albertosaurus-Bonebed“ wird erwähnt.
Albertosaurus: Albertosaurus, ein Tyrannosauride aus der Oberen Kreidezeit Nordamerikas, wird anhand seiner Fundgeschichte und seiner anatomischen Merkmale detailliert dargestellt. Der Text beschreibt die Namensgebung, die Verwandtschaft zu Gorgosaurus, und die Möglichkeit, dass Albertosaurus in Rudeln lebte. Die Bedeutung des Fundes von 22 Individuen in einem Steinbruch wird hervorgehoben.
Alectrosaurus: Alectrosaurus, ein Tyrannosauroide aus der Oberen Kreidezeit, ist durch spärliche Funde schlecht bekannt, daher werden seine mögliche Zugehörigkeit zu den Tyrannosauriern und seine geschätzte Größe und das Gewicht diskutiert. Die anfängliche Fehlinterpretation der Armknochen wird erläutert.
Alioramus: Alioramus, ein Tyrannosauride aus der Oberen Kreidezeit der Mongolei, zeichnet sich durch seinen niedrigen Schädel und die lange Schnauze mit Knochenhöckern aus. Der Text erwähnt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Kurzanov, die Anzahl der Zähne und die Debatte um seine mögliche Verwandtschaft mit Tarbosaurus.
Allosaurus: Allosaurus, ein Allosauride aus der Oberen Jurazeit, wird als gefährlichster Raubdinosaurier der Jurazeit Nordamerikas beschrieben. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Marsh, die anatomischen Merkmale und die Debatte um seine Lebensweise (Jäger oder Aasfresser). Die Bissspuren an Apatosaurus-Knochen werden erwähnt.
Alvarezsaurus: Alvarezsaurus, ein Alvarezsauride aus der Oberen Kreidezeit Argentiniens, wird anhand seines unvollständigen Skeletts beschrieben. Der Text erwähnt die Namensgebung und die Hypothese über seine insektenfressende Lebensweise. Die Bedeutung des langen Schwanzes wird hervorgehoben.
Alxasaurus: Alxasaurus, ein Therizinosauroide aus der Unteren Kreidezeit Chinas, wird anhand von mehreren Skelettfunden beschrieben. Der Text betont die Namensgebung in Bezug auf die Alxa-Wüste und die Einordnung in die Therizinosauroidea. Das Gewicht und die vermutete Lebensweise werden erläutert.
Amargasaurus: Amargasaurus, ein Dicraeosauride aus der Unteren Kreidezeit Argentiniens, ist bemerkenswert für seine verlängerten Neuralfortsätze der Wirbel. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Salgado und Bonaparte und die Besonderheiten seiner Wirbelsäulenstruktur. Seine geringe Größe im Vergleich zu anderen Sauropoden wird hervorgehoben.
Ammosaurus: Ammosaurus, ein Prosauropode aus der Unteren Jurazeit Nordamerikas, ist mit Anchisaurus eng verwandt und wird von manchen Paläontologen als Synonym dieser Gattung betrachtet. Der Text beschreibt die Ähnlichkeiten zu Anchisaurus und die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Marsh. Die vermutete Lebensweise wird erwähnt.
Ampelosaurus: Ampelosaurus, ein Titanosauride aus der Oberen Kreidezeit Frankreichs, wird anhand der Fundgeschichte und der anatomischen Merkmale beschrieben. Der Text erläutert die Namensgebung und die Einordnung in die Titanosauridae. Die Möglichkeit einer Panzerung wird erwähnt.
Amurosaurus: Amurosaurus, ein Lambeosaurine aus der Oberen Kreidezeit Russlands, wird anhand eines umfangreichen Knochenlagers beschrieben. Der Text erwähnt die Namensgebung, die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Bolotsky und Kurzanov und die systematische Einordnung. Die Unsicherheit über die genaue Form des Knochenkamms wird betont.
Anchiceratops: Anchiceratops, ein Chasmosaurine aus der Oberen Kreidezeit Kanadas, wird anhand seines Schädels (Schnabel, Hörner, Nackenschild) und seines Körperbaus beschrieben. Der Text diskutiert die vermutete Funktion des Kopfschmucks und die Hypothese über seine Lebensweise als Sumpfbewohner. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Brown wird erwähnt.
Anchiornis: Anchiornis, ein Troodontide aus der Oberen Jurazeit Chinas, ist ein kleiner, gefiederter Dinosaurier, älter als Archaeopteryx. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Hu et al., die Federtypen und die vermutete Lebensweise als Läufer. Die Informationen zur Färbung der Federn werden erwähnt.
Anchisaurus: Anchisaurus, ein Prosauropode aus der Unteren Jurazeit Nordamerikas und Südafrikas, wird anhand seiner anatomischen Merkmale (Kopf, Körperbau, Extremitäten, Zähne) und seiner Fundgeschichte beschrieben. Der Text erwähnt die Verwechslung der ersten Funde mit menschlichen Knochen und die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Marsh.
Andesaurus: Andesaurus, ein Titanosaurier aus der Oberen Kreidezeit Argentiniens, wird anhand eines Teilskeletts beschrieben. Der Text erwähnt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Calvo und Bonaparte und die geschätzte Größe und das Gewicht. Seine Einordnung in die Titanosauria und seine vermutete Lebensweise werden erläutert.
Ankylosaurus: Ankylosaurus, ein Ankylosauride aus der Oberen Kreidezeit Nordamerikas, wird anhand seines Schädels, der Panzerung und der Schwanzkeule beschrieben. Der Text betont die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Brown und diskutiert die vermutete Funktion der Panzerung und der Schwanzkeule. Die Hypothese über die Verteidigungsstrategie und die Rolle bei Paarungskämpfen wird erwähnt.
Anserimimus: Anserimimus, ein Ornithomimide aus der Oberen Kreidezeit der Mongolei, ist nur durch Becken- und Fußknochen bekannt. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Barsbold und hebt die Besonderheiten des Körperbaus und die vermutete Lebensweise als schneller Läufer hervor.
Antarctosaurus: Antarctosaurus, ein Titanosauride aus der Oberen Kreidezeit, wird als einer der größten bekannten Dinosaurier beschrieben. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Huene und die Möglichkeit einer Panzerung. Die geschätzte Größe und das Gewicht werden erläutert. Die Funktion der Magensteine wird erwähnt.
Apatosaurus: Apatosaurus, ein Diplodocide aus der Oberen Jurazeit Nordamerikas, wird anhand seiner Fundgeschichte und der anatomischen Merkmale beschrieben. Der Text beschreibt die Verwechslung mit Brontosaurus und die Schwierigkeiten der Rekonstruktion in der Vergangenheit. Die Hypothese von Bakker über die mögliche Lebendgeburt wird erwähnt.
Archaeoceratops: Archaeoceratops, ein Ceratopsie aus der Unteren Kreidezeit Chinas, gilt als einer der ältesten bekannten Horn-Dinosaurier. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Dong und Azuma und die anatomischen Merkmale (Schädel, Zähne, Beine). Die vermutete Lebensweise wird erwähnt.
Archaeornithoides: Archaeornithoides, ein möglicherweise Troodontide aus der Oberen Kreidezeit der Mongolei, ist nur durch Schädelreste eines Jungtieres bekannt. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Elzanowski und Wellnhofer und die Debatte über seine systematische Einordnung. Die Hypothese über die Bissspuren wird erwähnt.
Archaeornithomimus: Archaeornithomimus, ein Ornithomimide aus der Oberen Kreidezeit Chinas, wird anhand der Fundgeschichte und der anatomischen Merkmale (Schädel, Zähne, Extremitäten) beschrieben. Der Text erwähnt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Gilmore und Russel und die Hypothese über seine Lebensweise in Gruppen. Die vermutete Ernährung wird diskutiert.
Argentinosaurus: Argentinosaurus, ein Titanosaurier aus der Unteren Kreidezeit Argentiniens, gilt als einer der größten bekannten Dinosaurier. Der Text beschreibt die Fundgeschichte, die geschätzte Größe und das Gewicht, und die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Coria und Bonaparte. Der potentielle Feind Giganotosaurus wird erwähnt.
Argyrosaurus: Argyrosaurus, ein Titanosauride aus der Oberen Kreidezeit Südamerikas, wird anhand spärlicher Funde beschrieben. Der Text erläutert die Namensgebung und die geschätzte Größe. Die Einordnung in die Titanosauridae und die geographische Verbreitung werden erwähnt.
Aristosuchus: Aristosuchus, ein Compsognathide aus der Unteren Kreidezeit Englands, wird anhand seiner Funde und Merkmale beschrieben. Der Text erläutert die Namensgebung und die Ähnlichkeiten zu Compsognathus und fossilen Vögeln. Die Debatte über seine mögliche Identität mit Compsognathus wird erwähnt.
Arrhinoceratops: Arrhinoceratops, ein Chasmosaurine aus der Oberen Kreidezeit Kanadas, ist durch einen Schädelfund bekannt. Der Text beschreibt den Irrtum in der Namensgebung (Nasenloses Horngesicht) und erläutert die tatsächlichen Schädelmerkmale (Hörner, Nackenschild). Die vermutete Ernährung wird erwähnt.
Astrodon: Astrodon, ein Titanosauriforme aus der Unteren Kreidezeit Nordamerikas, wird anhand seiner Fundgeschichte und der Merkmale beschrieben. Der Text beschreibt die Namensgebung und die Verwechslung mit Pleurocoelus. Die Einordnung in die Titanosauriformes und die vermutete Verwandtschaft mit Brachiosaurus werden erwähnt.
Atlassaurus: Atlassaurus, ein Sauropode aus der Mittleren Jurazeit Marokkos, ist durch einen fast vollständigen Skelettfund bekannt. Der Text erläutert die Namensgebung und beschreibt die Größe und die anatomischen Merkmale. Die Einordnung an die Basis der Sauropoda wird erwähnt.
Atrociraptor: Atrociraptor, ein Dromaeosauride aus der Oberen Kreidezeit Kanadas, wird anhand seines ungewöhnlich kurzen und hohen Schädels und der Zähne beschrieben. Der Text erwähnt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Currie und Varricchio und die Diskussion über seine systematische Einordnung. Die Anzahl der Zähne wird erwähnt.
Aucasaurus: Aucasaurus, ein Abelisauride aus der Oberen Kreidezeit Argentiniens, ist durch ein fast vollständiges Skelett bekannt. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Coria et al. und hebt die ungewöhnlich langen Arme im Vergleich zu anderen Abelisauriden hervor. Die Größe und das Gewicht werden erwähnt.
Auroraceratops: Auroraceratops, ein Neoceratopsie aus der Unteren Kreidezeit Chinas, ist nur durch einen Schädel bekannt. Der Text erläutert die Namensgebung und beschreibt die Schädelmerkmale. Die vermutete Lebensweise als zweibeiniger Pflanzenfresser wird erwähnt.
Austroraptor: Austroraptor, ein Unenlagiine aus der Oberen Kreidezeit Südamerikas, ist der größte bekannte Dromaeosaurier der südlichen Hemisphäre. Der Text beschreibt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Novas et al. und die anatomischen Merkmale (Schädel, Zähne, Arme). Die Einordnung in die Unenlagiinae wird erwähnt.
Austrosaurus: Austrosaurus, ein Titanosaurier aus der Unteren Kreidezeit Australiens, wird anhand der Fundgeschichte und der anatomischen Merkmale beschrieben. Der Text erwähnt die wissenschaftliche Erstbeschreibung durch Longman und die Besonderheit der Länge der Vorder- und Hinterbeine. Die Einordnung in die Titanosauria wird erwähnt.
Avaceratops: Avaceratops, ein Centrosaurine aus der Oberen Kreidezeit Nordamerikas, ist durch schlecht erhaltene Schädel und ein Teilskelett bekannt. Der Text erläutert die Namensgebung und beschreibt die vermutete Lebensweise als Küstendinosauer. Die Unsicherheit über die Anzahl der Hörner wird hervorgehoben.
Avimimus: Avimimus, ein Avimimidae aus der Oberen Kreidezeit Asiens, wird anhand seiner anatomischen Merkmale (Körperbau, Schädel, Arme, Beine) beschrieben. Der Text erläutert die Namensgebung, diskutiert die Ernährung und die Hypothese über seine Rolle als möglicher Vorläufer im Zusammenhang mit dem Vogelflug. Die Fundgeschichte und die Möglichkeit, dass Avimimus in Gruppen lebte, werden erwähnt.
Schlüsselwörter
Dinosaurier, Paläontologie, Kreidezeit, Jurazeit, Triaszeit, Theropoda, Sauropoda, Ornithischia, Raubdinosaurier, Pflanzenfresser, Fossilien, Skelett, Schädel, Systematik, Verwandtschaftsbeziehungen, Geographische Verbreitung, Evolution.
Häufig gestellte Fragen zu „Dinosaurier von A bis K“
Was ist der Inhalt des Buches „Dinosaurier von A bis K“?
Das Taschenbuch „Dinosaurier von A bis K“ von Ernst Probst bietet einen umfassenden Überblick über ausgewählte Dinosauriergattungen von A bis K. Es enthält ein Vorwort, ein Inhaltsverzeichnis, Informationen zu Zielen und Schwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen zu einzelnen Dinosaurierarten, und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf einer leicht verständlichen Darstellung für ein breiteres Publikum, wobei wissenschaftliche Fakten prägnant zusammengefasst werden.
Welche Dinosaurierarten werden im Buch behandelt?
Das Buch behandelt eine Vielzahl von Dinosauriergattungen, alphabetisch geordnet von Abelisaurus bis hin zu Amurosaurus. Jede Gattung wird in einem eigenen Kapitel mit Informationen zu ihrer wissenschaftlichen Namensgebung, Größe, geographischem und zeitlichem Vorkommen, systematischer Stellung und Erstbeschreibung vorgestellt. Eine vollständige Liste der behandelten Gattungen findet sich im Inhaltsverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden im Buch behandelt?
Die Themenschwerpunkte des Buches umfassen die wissenschaftliche Namensgebung von Dinosauriern, die Vielfalt der Dinosaurierarten, die geographische Verbreitung und zeitliche Einordnung, die systematische Klassifizierung und Verwandtschaftsbeziehungen sowie die paläontologische Fundgeschichte und Forschungsmethoden. Das Buch zielt darauf ab, ein breites Verständnis der Dinosaurierwelt zu vermitteln.
Wie sind die Kapitel des Buches aufgebaut?
Jedes Kapitel konzentriert sich auf eine einzelne Dinosauriergattung. Die Kapitelzusammenfassungen bieten prägnante Informationen zu den wichtigsten Merkmalen des jeweiligen Dinosauriers, wie z.B. seiner anatomischen Struktur, seiner Größe und seines Lebensraumes. Fundgeschichte, wissenschaftliche Erstbeschreibung und Einordnung in die systematische Klassifizierung werden ebenfalls behandelt. Die Beschreibungen sind für ein breites Publikum verständlich gehalten.
Für wen ist das Buch geeignet?
Das Buch ist für ein breites Publikum konzipiert, insbesondere für Leser, die sich allgemein für Dinosaurier interessieren und einen leicht verständlichen Überblick über eine Auswahl von Dinosauriergattungen erhalten möchten. Es eignet sich auch als Nachschlagewerk für Schüler und Studenten, die sich mit dem Thema im Rahmen ihrer akademischen Arbeit befassen.
Welche Art von Informationen finde ich in den Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen geben einen knappen Überblick über die wichtigsten Informationen zu jeder Dinosauriergattung. Dies beinhaltet den Fundort, die Zeitperiode, die anatomischen Merkmale (z.B. Schädel, Zähne, Größe, Körperbau), die systematische Einordnung (z.B. Theropode, Sauropode), die Erstbeschreibung, und relevante wissenschaftliche Debatten oder Besonderheiten der jeweiligen Art.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Buches?
Schlüsselwörter, die den Inhalt des Buches „Dinosaurier von A bis K“ treffend beschreiben, sind: Dinosaurier, Paläontologie, Kreidezeit, Jurazeit, Triaszeit, Theropoda, Sauropoda, Ornithischia, Raubdinosaurier, Pflanzenfresser, Fossilien, Skelett, Schädel, Systematik, Verwandtschaftsbeziehungen, Geographische Verbreitung, und Evolution.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2010, Dinosaurier von A bis K, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/160426