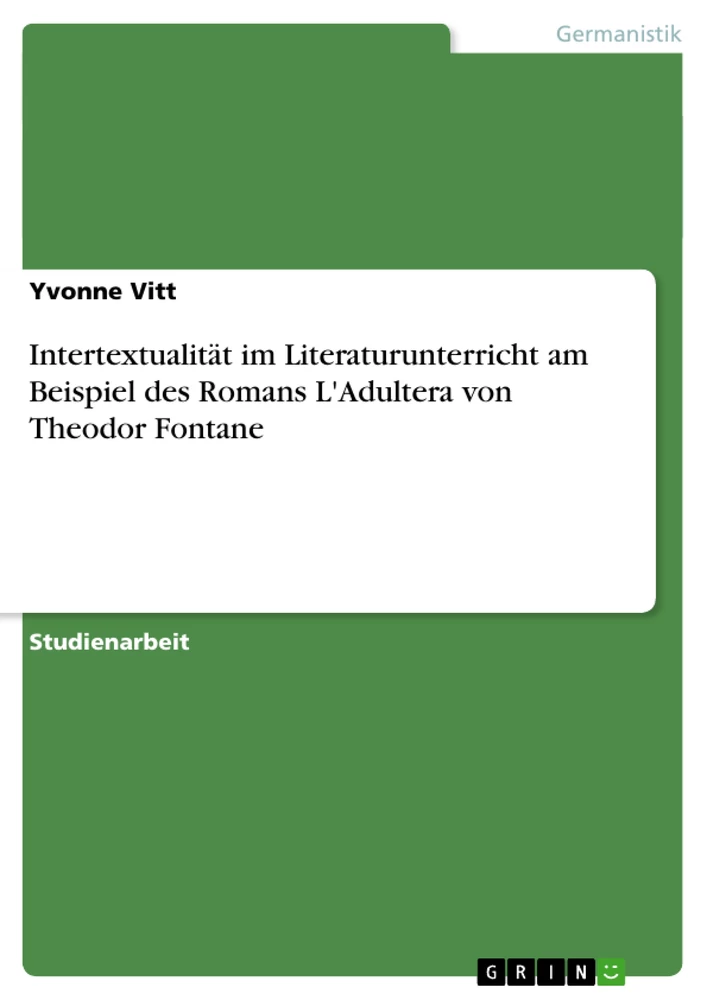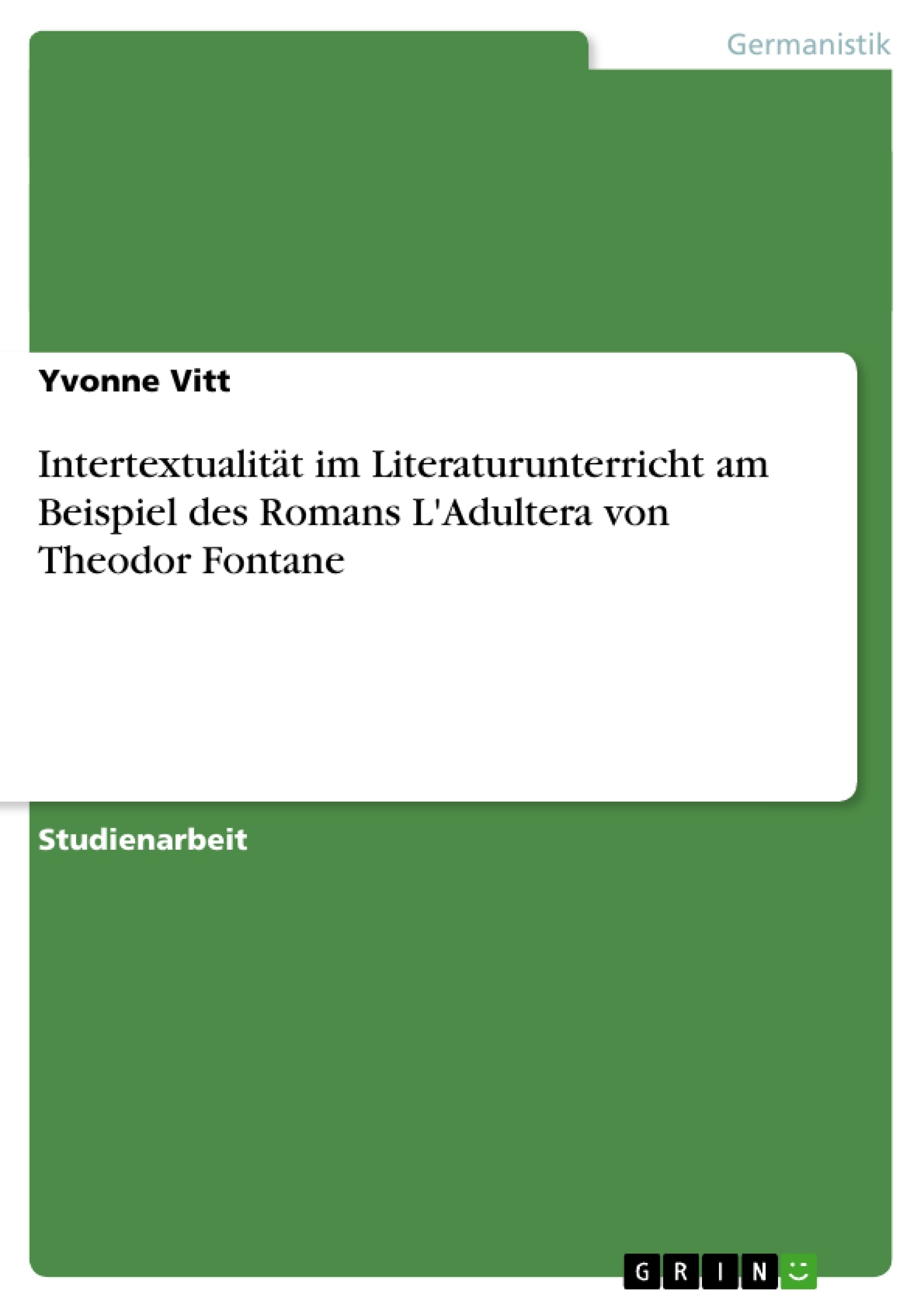Das Zitat ist ein Phänomen, das uns, alltäglich begleitend, in Literatur, Wissenschaft, Politik und in den Medien - insbesondere in der Werbungbegegnet. Als Rezipienten nehmen wir „fremde Worte“, wozu Zitate, aber auch Anspielungen zählen, zunächst in unseren passiven Wortschatz auf und können diese schließlich durch Aktivierung und einen Transfer vom passiven in den aktiven Sprachschatz, in einem Wechsel von Empfänger- zu Senderrolle, weiterverwenden. Allein in mündlichen Diskursen bedienen wir uns geflügelter Worte, Sprichwörter und anderer Zitate, oftmals ohne uns derer Verwendung bewusst zu sein. Anders erscheint dies im schriftlichen Gebrauch: In einem Text, der für andere zugänglich gemacht und rezipiert werden soll, werden „fremde Worte“, wie Zitate und Anspielungen, von Seiten des Verfassers üblicherweise kenntlich gemacht. Dies geschieht gewöhnlich durch eine direkte Markierung, also durch Anführungszeichen oder, wie oftmals in wissenschaftlichen Arbeiten, durch Fußnoten. Abgesehen von den wissenschaftlichen Arbeiten finden sich in der Literatur ein Vielzahl an Zitaten und Anspielungen, die - teils kenntlich gemacht, teils unmarkiert - für den Rezipienten nicht immer gleich ersichtlich ist, und deren Aufdeckung „ganz und gar von der Sensibilität, der Gestimmtheit, der Aufnahmebereitschaft und Aufnahmewilligkeit des Empfängers“, also vom kritischen Textumgang des Rezipienten, abhängt. Kritischer Textumgang ermöglicht dem Rezipienten umfassende und vielschichtige Texte zu erschließen, und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass dies im Rahmen des Deutsch- bzw. Literaturunterrichts ein Ziel darstellt, das bereits ab der sechsten Klasse stetig verfolgt wird und spätestens nach Beendigung der Schullaufbahn der jeweiligen Schülerinnen und Schüler erreicht werden sollte. Kritischem Textumgang geht eine Einübung in Textverständnis voraus, die ab der gymnasialen Mittelstufe durch Wiedergeben, Beschreiben, und Deuten, schließlich durch Erörtern und Beurteilen erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Intertextualität und Literaturunterricht
- 3. Zitat und Allusion
- 4. Intertextualität in Theodor Fontanes Roman „L' Adultera“
- 4.1 L' Adultera - Die Ehebrecherin vor Christus
- 4.2 Das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Intertextualität im Literaturunterricht am Beispiel von Theodor Fontanes Roman „L'Adultera“. Das Hauptziel ist es, aufzuzeigen, wie die Auseinandersetzung mit intertextuellen Bezügen das Textverständnis und den kritischen Umgang mit Literatur fördern kann. Die Arbeit analysiert, wie Zitate und Anspielungen im Roman funktionieren und wie diese im Unterricht didaktisch sinnvoll eingesetzt werden können.
- Intertextualität als didaktisches Konzept im Literaturunterricht
- Analyse von Zitaten und Anspielungen in literarischen Texten
- Der Roman „L'Adultera“ als Fallbeispiel für intertextuelle Verflechtungen
- Förderung des kritischen Textverständnisses durch Intertextualitätsanalyse
- Didaktische Implikationen der Intertextualitätsanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Intertextualität ein und betont deren allgegenwärtige Präsenz in verschiedenen Bereichen wie Literatur, Wissenschaft und Medien. Sie hebt die Bedeutung des kritischen Textumgangs hervor, der im Literaturunterricht angestrebt wird und durch die Analyse intertextueller Bezüge gefördert werden kann. Der Fokus liegt auf der Rolle von Zitaten und Anspielungen als zentrale Bestandteile der Intertextualität und deren didaktisches Potential im Literaturunterricht der gymnasialen Oberstufe. Der Roman "L'Adultera" von Theodor Fontane dient als Fallbeispiel für die Untersuchung der Möglichkeiten und Probleme, die sich im Kontext von Intertextualität im Unterricht ergeben.
2. Intertextualität und Literaturunterricht: Dieses Kapitel beleuchtet die Notwendigkeit, Schülerinnen und Schüler mit dem Konzept der Intertextualität vertraut zu machen, bevor eine Textanalyse begonnen wird. Es wird eine deduktive Vorgehensweise empfohlen, bei der das Verständnis der Intertextualitätsstrukturen den Schülern vorab vermittelt wird. Der Text betont, dass Intertextualität mehr umfasst als nur Zitate, obwohl diese einen wichtigen Bestandteil darstellen. Die didaktische Umsetzung zielt darauf ab, die im Lehrplan geforderten Lernziele zu erreichen, indem sie ein vertieftes Textverständnis und einen kritischen Textumgang fördert. Dadurch werden die weiteren Lernziele des Literaturunterrichts in der gymnasialen Oberstufe unterstützt.
3. Zitat und Allusion: (Annahme: Kapitel 3 behandelt die Unterscheidung und die Wirkung von Zitaten und Allusionen). Dieses Kapitel behandelt wahrscheinlich die Unterscheidung zwischen direkten Zitaten und indirekten Anspielungen (Allusionen). Es wird die unterschiedliche Wirkung beider Techniken auf den Leser untersucht, und wie der Rezipient diese identifizieren und interpretieren kann. Der Text analysiert vermutlich die Rolle des Kontextes für die Interpretation und die Bedeutung von sowohl expliziten als auch impliziten intertextuellen Bezügen. Dies bildet die Grundlage für die spätere Analyse von Fontanes Roman, da es hilft, die verschiedenen Arten der Intertextualität zu verstehen, die in "L'Adultera" vorkommen.
4. Intertextualität in Theodor Fontanes Roman „L' Adultera“: (Annahme: Kapitel 4 untersucht die Intertextualität in Fontanes Roman, unterteilt in die beiden Unterkapitel). Dieses Kapitel analysiert die intertextuellen Bezüge in Fontanes "L'Adultera". Es wird erwartet, dass die Analyse sowohl explizite als auch implizite Verweise auf andere Texte, historische Ereignisse oder kulturelle Kontexte umfasst. Die Unterkapitel könnten sich auf spezifische Aspekte des Romans konzentrieren, wie z.B. die historische Einbettung der Geschichte oder die Verwendung literarischer Traditionen. Die Analyse untersucht, wie diese Bezüge die Bedeutung und Interpretation des Romans beeinflussen und welche Rolle sie im Aufbau der Geschichte spielen.
Schlüsselwörter
Intertextualität, Literaturunterricht, Theodor Fontane, L'Adultera, Zitat, Allusion, Textverständnis, kritischer Textumgang, Didaktik, Romananalyse.
Häufig gestellte Fragen zu "Intertextualität in Theodor Fontanes Roman „L'Adultera“"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Intertextualität im Literaturunterricht anhand von Theodor Fontanes Roman „L'Adultera“. Das Hauptziel ist aufzuzeigen, wie die Auseinandersetzung mit intertextuellen Bezügen das Textverständnis und den kritischen Umgang mit Literatur fördert.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Intertextualität als didaktisches Konzept, die Analyse von Zitaten und Anspielungen in literarischen Texten, „L'Adultera“ als Fallbeispiel für intertextuelle Verflechtungen, die Förderung des kritischen Textverständnisses durch Intertextualitätsanalyse und die didaktischen Implikationen der Intertextualitätsanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema Intertextualität ein und stellt den Roman „L'Adultera“ als Fallbeispiel vor. Kapitel 2 (Intertextualität und Literaturunterricht) beleuchtet die didaktische Umsetzung der Intertextualität im Unterricht. Kapitel 3 (Zitat und Allusion) behandelt die Unterscheidung und Wirkung von Zitaten und Allusionen. Kapitel 4 (Intertextualität in Theodor Fontanes Roman „L'Adultera“) analysiert die intertextuellen Bezüge in Fontanes Roman, unterteilt in Unterkapitel zu "L'Adultera - Die Ehebrecherin vor Christus" und "Das Bildungsbürgertum des 19. Jahrhunderts". Kapitel 5 (Schlussbetrachtung) fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird Intertextualität im Literaturunterricht eingesetzt?
Die Arbeit empfiehlt eine deduktive Vorgehensweise, bei der das Verständnis der Intertextualitätsstrukturen den Schülern vorab vermittelt wird. Der Fokus liegt auf der Förderung eines vertieften Textverständnisses und eines kritischen Textumgangs durch die Analyse von Zitaten und Anspielungen.
Welche Rolle spielen Zitate und Allusionen in der Arbeit?
Zitate und Allusionen werden als zentrale Bestandteile der Intertextualität betrachtet und ihre unterschiedliche Wirkung auf den Leser und deren Identifizierung und Interpretation analysiert. Der Kontext spielt dabei eine entscheidende Rolle für die Interpretation.
Wie wird Fontanes Roman „L'Adultera“ in der Arbeit analysiert?
Die Analyse umfasst sowohl explizite als auch implizite Verweise auf andere Texte, historische Ereignisse oder kulturelle Kontexte. Es wird untersucht, wie diese Bezüge die Bedeutung und Interpretation des Romans beeinflussen und welche Rolle sie im Aufbau der Geschichte spielen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Intertextualität, Literaturunterricht, Theodor Fontane, L'Adultera, Zitat, Allusion, Textverständnis, kritischer Textumgang, Didaktik, Romananalyse.
- Citation du texte
- Yvonne Vitt (Auteur), 2003, Intertextualität im Literaturunterricht am Beispiel des Romans L'Adultera von Theodor Fontane, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16035